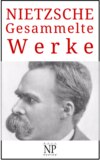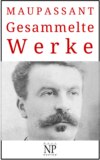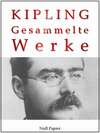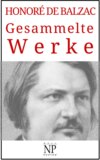Loe raamatut: «Friedrich Wilhelm Nietzsche – Gesammelte Werke», lehekülg 11
Von den Erhabenen
Still ist der Grund meines Meeres: wer erriethe wohl, dass er scherzhafte Ungeheuer birgt!
Unerschütterlich ist meine Tiefe: aber sie glänzt von schwimmenden Räthseln und Gelächtern.
Einen Erhabenen sah ich heute, einen Feierlichen, einen Büsser des Geistes: oh wie lachte meine Seele ob seiner Hässlichkeit!
Mit erhobener Brust und Denen gleich, welche den Athem an sich ziehn: also stand er da, der Erhabene, und schweigsam:
Behängt mit hässlichen Wahrheiten, seiner Jagdbeute, und reich an zerrissenen Kleidern; auch viele Dornen hiengen an ihm – aber noch sah ich keine Rose.
Noch lernte er das Lachen nicht und die Schönheit. Finster kam dieser Jäger zurück aus dem Walde der Erkenntniss.
Vom Kampfe kehrte er heim mit wilden Thieren: aber aus seinem Ernste blickt auch noch ein wildes Thier – ein unüberwundenes!
Wie ein Tiger steht er immer noch da, der springen will; aber ich mag diese gespannten Seelen nicht, unhold ist mein Geschmack allen diesen Zurückgezognen.
Und ihr sagt mir, Freunde, dass nicht zu streiten sei über Geschmack und Schmecken? Aber alles Leben ist Streit um Geschmack und Schmecken!
Geschmack: das ist Gewicht zugleich und Wagschale und Wägender; und wehe allem Lebendigen, das ohne Streit um Gewicht und Wagschale und Wägende leben wollte!
Wenn er seiner Erhabenheit müde würde, dieser Erhabene: dann erst würde seine Schönheit anheben, – und dann erst will ich ihn schmecken und schmackhaft finden.
Und erst, wenn er sich von sich selber abwendet, wird er über seinen eignen Schatten springen – und, wahrlich! hinein in seine Sonne.
Allzulange sass er im Schatten, die Wangen bleichten dem Büsser des Geistes; fast verhungerte er an seinen Erwartungen.
Verachtung ist noch in seinem Auge; und Ekel birgt sich an seinem Munde. Zwar ruht er jetzt, aber seine Ruhe hat sich noch nicht in die Sonne gelegt.
Dem Stiere gleich sollte er thun; und sein Glück sollte nach Erde riechen und nicht nach Verachtung der Erde.
Als weissen Stier möchte ich ihn sehn, wie er schnaubend und brüllend der Pflugschar vorangeht: und sein Gebrüll sollte noch alles Irdische preisen!
Dunkel noch ist sein Antlitz; der Hand Schatten spielt auf ihm. Verschattet ist noch der Sinn seines Auges.
Seine That selber ist noch der Schatten auf ihm: die Hand verdunkelt den Handelnden. Noch hat er seine That nicht überwunden.
Wohl liebe ich an ihm den Nacken des Stiers: aber nun will ich auch noch das Auge des Engels sehn.
Auch seinen Helden-Willen muss er noch verlernen: ein Gehobener soll er mir sein und nicht nur ein Erhabener: – der Aether selber sollte ihn heben, den Willenlosen!
Er bezwang Unthiere, er löste Räthsel: aber erlösen sollte er auch noch seine Unthiere und Räthsel, zu himmlischen Kindern sollte er sie noch verwandeln.
Noch hat seine Erkenntniss nicht lächeln gelernt und ohne Eifersucht sein; noch ist seine strömende Leidenschaft nicht stille geworden in der Schönheit.
Wahrlich, nicht in der Sattheit soll sein Verlangen schweigen und untertauchen, sondern in der Schönheit! Die Anmuth gehört zur Grossmuth des Grossgesinnten.
Den Arm über das Haupt gelegt: so sollte der Held ausruhn, so sollte er auch noch sein Ausruhen überwinden.
Aber gerade dem Helden ist das Schöne aller Dinge Schwerstes. Unerringbar ist das Schöne allem heftigen Willen.
Ein Wenig mehr, ein Wenig weniger: das gerade ist hier Viel, das ist hier das Meiste.
Mit lässigen Muskeln stehn und mit abgeschirrtem Willen: das ist das Schwerste euch Allen, ihr Erhabenen!
Wenn die Macht gnädig wird und herabkommt in’s Sichtbare: Schönheit heisse ich solches Herabkommen.
Und von Niemandem will ich so als von dir gerade Schönheit, du Gewaltiger: deine Güte sei deine letzte Selbst- Überwältigung.
Alles Böse traue ich dir zu: darum will ich von dir das Gute.
Wahrlich, ich lachte oft der Schwächlinge, welche sich gut glauben, weil sie lahme Tatzen haben!
Der Säule Tugend sollst du nachstreben: schöner wird sie immer und zarter, aber inwendig härter und tragsamer, je mehr sie aufsteigt.
Ja, du Erhabener, einst sollst du noch schön sein und deiner eignen Schönheit den Spiegel vorhalten.
Dann wird deine Seele vor göttlichen Begierden schaudern; und Anbetung wird noch in deiner Eitelkeit sein!
Diess nämlich ist das Geheimniss der Seele: erst, wenn sie der Held verlassen hat, naht ihr, im Traume, – der Über-Held.
Also sprach Zarathustra.
Vom Lande der Bildung
Zu weit hinein flog ich in die Zukunft: ein Grauen überfiel mich.
Und als ich um mich sah, siehe! da war die Zeit mein einziger Zeitgenosse.
Da floh ich rückwärts, heimwärts – und immer eilender: so kam ich zu euch, ihr Gegenwärtigen, und in’s Land der Bildung.
Zum ersten Male brachte ich ein Auge mit für euch, und gute Begierde: wahrlich, mit Sehnsucht im Herzen kam ich.
Aber wie geschah mir? So angst mir auch war, – ich musste lachen! Nie sah mein Auge etwas so Buntgesprenkeltes!
Ich lachte und lachte, während der Fuss mir noch zitterte und das Herz dazu: »hier ist ja die Heimat aller Farbentöpfe!« – sagte ich.
Mit fünfzig Klexen bemalt an Gesicht und Gliedern: so sasset ihr da zu meinem Staunen, ihr Gegenwärtigen!
Und mit fünfzig Spiegeln um euch, die eurem Farbenspiele schmeichelten und nachredeten!
Wahrlich, ihr könntet gar keine bessere Maske tragen, ihr Gegenwärtigen, als euer eignes Gesicht ist! Wer könnte euch – erkennen!
Vollgeschrieben mit den Zeichen der Vergangenheit, und auch diese Zeichen überpinselt mit neuen Zeichen: also habt ihr euch gut versteckt vor allen Zeichendeutern!
Und wenn man auch Nierenprüfer ist: wer glaubt wohl noch, dass ihr Nieren habt! Aus Farben scheint ihr gebacken und aus geleimten Zetteln.
Alle Zeiten und Völker blicken bunt aus euren Schleiern; alle Sitten und Glauben reden bunt aus euren Gebärden.
Wer von euch Schleier und Überwürfe und Farben und Gebärden abzöge: gerade genug würde er übrig behalten, um die Vögel damit zu erschrecken.
Wahrlich, ich selber bin der erschreckte Vogel, der euch einmal nackt sah und ohne Farbe; und ich flog davon, als das Gerippe mir Liebe zuwinkte.
Lieber wollte ich doch noch Tagelöhner sein in der Unterwelt und bei den Schatten des Ehemals! – feister und voller als ihr sind ja noch die Unterweltlichen!
Diess, ja diess ist Bitterniss meinen Gedärmen, dass ich euch weder nackt, noch bekleidet aushalte, ihr Gegenwärtigen!
Alles Unheimliche der Zukunft, und was je verflogenen Vögeln Schauder machte, ist wahrlich heimlicher noch und traulicher als eure »Wirklichkeit«.
Denn so sprecht ihr: »Wirkliche sind wir ganz, und ohne Glauben und Aberglauben«: also brüstet ihr euch – ach, auch noch ohne Brüste!
Ja, wie solltet ihr glauben können, ihr Buntgesprenkelten! – die ihr Gemälde seid von Allem, was je geglaubt wurde!
Wandelnde Widerlegungen seid ihr des Glaubens selber, und aller Gedanken Gliederbrechen. Unglaubwürdige : also heisse ich euch, ihr Wirklichen!
Alle Zeiten schwätzen wider einander in euren Geistern; und aller Zeiten Träume und Geschwätz waren wirklicher noch als euer Wachsein ist!
Unfruchtbare seid ihr: darum fehlt es euch an Glauben. Aber wer schaffen musste, der hatte auch immer seine Wahr-Träume und Stern-Zeichen – und glaubte an Glauben! –
Halboffne Thore seid ihr, an denen Todtengräber warten. Und das ist eure Wirklichkeit: »Alles ist werth, dass es zu Grunde geht.«
Ach, wie ihr mir dasteht, ihr Unfruchtbaren, wie mager in den Rippen! Und Mancher von euch hatte wohl dessen selber ein Einsehen.
Und er sprach: »es hat wohl da ein Gott, als ich schlief, mir heimlich Etwas entwendet? Wahrlich, genug, sich ein Weibchen daraus zu bilden!
Wundersam ist die Armuth meiner Rippen!« also sprach schon mancher Gegenwärtige.
Ja, zum Lachen seid ihr mir, ihr Gegenwärtigen! Und sonderlich, wenn ihr euch über euch selber wundert!
Und wehe mir, wenn ich nicht lachen könnte über eure Verwunderung, und alles Widrige aus euren Näpfen hinunter trinken müsste!
So aber will ich’s mit euch leichter nehmen, da ich Schweres zu tragen habe; und was thut’s mir, wenn sich Käfer und Flügelwürmer noch auf mein Bündel setzen!
Wahrlich, es soll mir darob nicht schwerer werden! Und nicht aus euch, ihr Gegenwärtigen, soll mir die grosse Müdigkeit kommen. – Ach, wohin soll ich nun noch steigen mit meiner Sehnsucht! Von allen Bergen schaue ich aus nach Vater- und Mutterländern.
Aber Heimat fand ich nirgends: unstät bin ich in allen Städten und ein Aufbruch an allen Thoren.
Fremd sind mir und ein Spott die Gegenwärtigen, zu denen mich jüngst das Herz trieb; und vertrieben bin ich aus Vater- und Mutterländern.
So liebe ich allein noch meiner Kinder Land, das unentdeckte, im fernsten Meere: nach ihm heisse ich meine Segel suchen und suchen.
An meinen Kindern will ich es gut machen, dass ich meiner Väter Kind bin: und an aller Zukunft – diese Gegenwart!
Also sprach Zarathustra.
Von der unbefleckten Erkenntniss
Als gestern der Mond aufgieng, wähnte ich, dass er eine Sonne gebären wolle: so breit und trächtig lag er am Horizonte.
Aber ein Lügner war er mir mit seiner Schwangerschaft; und eher noch will ich an den Mann im Monde glauben als an das Weib.
Freilich, wenig Mann ist er auch, dieser schüchterne Nachtschwärmer. Wahrlich, mit schlechtem Gewissen wandelt er über die Dächer.
Denn er ist lüstern und eifersüchtig, der Mönch im Monde, lüstern nach der Erde und nach allen Freuden der Liebenden.
Nein, ich mag ihn nicht, diesen Kater auf den Dächern! Widerlich sind mir Alle, die um halbverschlossne Fenster schleichen!
Fromm und schweigsam wandelt er hin auf Sternen-Teppichen: – aber ich mag alle leisetretenden Mannsfüsse nicht, an denen auch nicht ein Sporen klirrt.
Jedes Redlichen Schritt redet; die Katze aber stiehlt sich über den Boden weg. Siehe, katzenhaft kommt der Mond daher und unredlich. –
Dieses Gleichniss gebe ich euch empfindsamen Heuchlern, euch, den "Rein-Erkennenden!« Euch heisse ich – Lüsterne!
Auch ihr liebt die Erde und das Irdische: ich errieth euch wohl! – aber Scham ist in eurer Liebe und schlechtes Gewissen, – dem Monde gleicht ihr!
Zur Verachtung des Irdischen hat man euren Geist überredet, aber nicht eure Eingeweide: die aber sind das Stärkste an euch!
Und nun schämt sich euer Geist, dass er euren Eingeweiden zu willen ist und geht vor seiner eignen Scham Schleich- und Lügenwege.
»Das wäre mir das Höchste – also redet euer verlogner Geist zu sich – auf das Leben ohne Begierde zu schaun und nicht gleich dem Hunde mit hängender Zunge:
»Glücklich zu sein im Schauen, mit erstorbenem Willen, ohne Griff und Gier der Selbstsucht – kalt und aschgrau am ganzen Leibe, aber mit trunkenen Mondesaugen!«
»Das wäre mir das Liebste, – also verführt sich selber der Verführte – die Erde zu lieben, wie der Mond sie liebt, und nur mit dem Auge allein ihre Schönheit zu betasten.
»Und das heisse mir aller Dinge unbefleckte Erkenntniss, dass ich von den Dingen Nichts will: ausser dass ich vor ihnen da liegen darf wie ein Spiegel mit hundert Augen.« –
Oh, ihr empfindsamen Heuchler, ihr Lüsternen! Euch fehlt die Unschuld in der Begierde: und nun verleumdet ihr drum das Begehren!
Wahrlich, nicht als Schaffende, Zeugende, Werdelustige liebt ihr die Erde!
Wo ist Unschuld? Wo der Wille zur Zeugung ist. Und wer über sich hinaus schaffen will, der hat mir den reinsten Willen.
Wo ist Schönheit? Wo ich mit allem Willen wollen muss; wo ich lieben und untergehn will, dass ein Bild nicht nur Bild bleibe.
Lieben und Untergehn: das reimt sich seit Ewigkeiten. Wille zur Liebe: das ist, willig auch sein zum Tode. Also rede ich zu euch Feiglingen!
Aber nun will euer entmanntes Schielen »Beschaulichkeit« heissen! Und was mit feigen Augen sich tasten lässt, soll »schön« getauft werden! oh, ihr Beschmutzer edler Namen!
Aber das soll euer Fluch sein, ihr Unbefleckten, ihr Rein-Erkennenden, dass ihr nie gebären werdet: und wenn ihr auch breit und trächtig am Horizonte liegt!
Wahrlich, ihr nehmt den Mund voll mit edlen Worten: und wir sollen glauben, dass euch das Herz übergehe, ihr Lügenbolde?
Aber meine Worte sind geringe, verachtete: gerne nehme ich auf, was bei eurer Mahlzeit unter den Tisch fällt.
Immer noch kann ich mit ihnen – Heuchlern die Wahrheit sagen! ja, meine Gräten, Muscheln und Stachelblätter sollen – Heuchlern die Nasen kitzeln!
Schlechte Luft ist immer um euch und eure Mahlzeiten: eure lüsternen Gedanken, eure Lügen und Heimlichkeiten sind ja in der Luft!
Wagt es doch erst, euch selber zu glauben – euch und euren Eingeweiden! Wer sich selber nicht glaubt, lügt immer.
Eines Gottes Larve hängtet ihr um vor euch selber, ihr »Reinen«: in eines Gottes Larve verkroch sich euer greulicher Ringelwurm.
Wahrlich, ihr täuscht, ihr »Beschaulichen«! Auch Zarathustra war einst der Narr eurer göttlichen Häute; nicht errieth er das Schlangengeringel, mit denen sie gestopft waren.
Eines Gottes Seele wähnte ich einst spielen zu sehn in euren Spielen, ihr Rein-Erkennenden! Keine bessere Kunst wähnte ich einst als eure Künste!
Schlangen-Unflath und schlimmen Geruch verhehlte mir die Ferne: und dass einer Eidechse List lüstern hier herumschlich.
Aber ich kam euch nah: da kam mir der Tag – und nun kommt er euch, – zu Ende gieng des Mondes Liebschaft!
Seht doch hin! Ertappt und bleich steht er da – vor der Morgenröthe!
Denn schon kommt sie, die Glühende, – ihre Liebe zur Erde kommt! Unschuld und Schöpfer-Begier ist alle Sonnen-Liebe!
Seht doch hin, wie sie ungeduldig über das Meer kommt! Fühlt ihr den Durst und den heissen Athem ihrer Liebe nicht?
Am Meere will sie saugen und seine Tiefe zu sich in die Höhe trinken: da hebt sich die Begierde des Meeres mit tausend Brüsten.
Geküsst und gesaugt will es sein vom Durste der Sonne; Luft will es werden und Höhe und Fusspfad des Lichts und selber Licht!
Wahrlich, der Sonne gleich liebe ich das Leben und alle tiefen Meere.
Und diess heisst mir Erkenntniss: alles Tiefe soll hinauf – zu meiner Höhe!
Also sprach Zarathustra.
Von den Gelehrten
Als ich im Schlafe lag, da frass ein Schaf am Epheukranze meines Hauptes, – frass und sprach dazu: »Zarathustra ist kein Gelehrter mehr.«
Sprach’s und gieng stotzig davon und stolz. Ein Kind erzählte mir’s.
Gerne liege ich hier, wo die Kinder spielen, an der zerbrochnen Mauer, unter Disteln und rothen Mohnblumen.
Ein Gelehrter bin ich den Kindern noch und auch den Disteln und rothen Mohnblumen. Unschuldig sind sie, selbst noch in ihrer Bosheit.
Aber den Schafen bin ich’s nicht mehr: so will es mein Loos – gesegnet sei es!
Denn diess ist die Wahrheit: ausgezogen bin ich aus dem Hause der Gelehrten: und die Thür habe ich noch hinter mir zugeworfen.
Zu lange sass meine Seele hungrig an ihrem Tische; nicht, gleich ihnen, bin ich auf das Erkennen abgerichtet wie auf das Nüsseknacken.
Freiheit liebe ich und die Luft über frischer Erde; lieber noch will ich auf Ochsenhäuten schlafen, als auf ihren Würden und Achtbarkeiten.
Ich bin zu heiss und verbrannt von eigenen Gedanken: oft will es mir den Athem nehmen. Da muss ich in’s Freie und weg aus allen verstaubten Stuben.
Aber sie sitzen kühl in kühlem Schatten: sie wollen in Allem nur Zuschauer sein und hüten sich dort zu sitzen, wo die Sonne auf die Stufen brennt.
Gleich Solchen, die auf der Strasse stehn und die Leute angaffen, welche vorübergehn: also warten sie auch und gaffen Gedanken an, die Andre gedacht haben.
Greift man sie mit Händen, so stäuben sie um sich gleich Mehlsäcken, und unfreiwillig. aber wer erriethe wohl, dass ihr Staub vom Korne stammt und von der gelben Wonne der Sommerfelder?
Geben sie sich weise, so fröstelt mich ihrer kleinen Sprüche und Wahrheiten: ein Geruch ist oft an ihrer Weisheit, als ob sie aus dem Sumpfe stamme: und wahrlich, ich hörte auch schon den Frosch aus ihr quaken!
Geschickt sind sie, sie haben kluge Finger: was will meine Einfalt bei ihrer Vielfalt! Alles Fädeln und Knüpfen und Weben verstehn ihre Finger: also wirken sie die Strümpfe des Geistes!
Gute Uhrwerke sind sie: nur sorge man, sie richtig aufzuziehn! Dann zeigen sie ohne Falsch die Stunde an und machen einen bescheidnen Lärm dabei.
Gleich Mühlwerken arbeiten sie und Stampfen: man werfe ihnen nur seine Fruchtkörner zu! – sie wissen schon, Korn klein zu mahlen und weissen Staub daraus zu machen.
Sie sehen einander gut auf die Finger und trauen sich nicht zum Besten. Erfinderisch in kleinen Schlauheiten warten sie auf Solche, deren Wissen auf lahmen Füssen geht, – gleich Spinnen warten sie.
Ich sah sie immer mit Vorsicht Gift bereiten; und immer zogen sie gläserne Handschuhe dabei an ihre Finger.
Auch mit falschen Würfeln wissen sie zu spielen; und so eifrig fand ich sie spielen, dass sie dabei schwitzten.
Wir sind einander fremd, und ihre Tugenden gehn mir noch mehr wider den Geschmack, als ihre Falschheiten und falschen Würfel.
Und als ich bei ihnen wohnte, da wohnte ich über ihnen. Darüber wurden sie mir gram.
Sie wollen Nichts davon hören, dass Einer über ihren Köpfen wandelt; und so legten sie Holz und Erde und Unrath zwischen mich und ihre Köpfe.
Also dämpften sie den Schall meiner Schritte: und am schlechtesten wurde ich bisher von den Gelehrtesten gehört.
Aller Menschen Fehl und Schwäche legten sie zwischen sich und mich: – »Fehlboden« heissen sie das in ihren Häusern.
Aber trotzdem wandele ich mit meinen Gedanken über ihren Köpfen; und selbst, wenn ich auf meinen eignen Fehlern wandeln wollte, würde ich noch über ihnen sein und ihren Köpfen.
Denn die Menschen sind nicht gleich: so spricht die Gerechtigkeit. Und was ich will, dürften sie nicht wollen!
Also sprach Zarathustra.
Von den Dichtern
»Seit ich den Leib besser kenne, – sagte Zarathustra zu einem seiner Jünger – ist mir der Geist nur noch gleichsam Geist; und alles das »Unvergängliche« – das ist auch nur ein Gleichniss.«
»So hörte ich dich schon einmal sagen, antwortete der Jünger; und damals fügtest du hinzu: »aber die Dichter lügen zuviel.« Warum sagtest du doch, dass die Dichter zuviel lügen?«
»Warum? sagte Zarathustra. Du fragst warum? Ich gehöre nicht zu Denen, welche man nach ihrem Warum fragen darf.
Ist denn mein Erleben von Gestern? Das ist lange her, dass ich die Gründe meiner Meinungen erlebte.
Müsste ich nicht ein Fass sein von Gedächtniss, wenn ich auch meine Gründe bei mir haben wollte?
Schon zuviel ist mir’s, meine Meinungen selber zu behalten; und mancher Vogel fliegt davon.
Und mitunter finde ich auch ein zugezogenes Thier in meinem Taubenschlage, das mir fremd ist, und das zittert, wenn ich meine Hand darauf lege.
Doch was sagte dir einst Zarathustra? Dass die Dichter zuviel lügen? – Aber auch Zarathustra ist ein Dichter.
Glaubst du nun, dass er hier die Wahrheit redete? Warum glaubst du das?«
Der Jünger antwortete: »ich glaube an Zarathustra.« Aber Zarathustra schüttelte den Kopf und lächelte.
Der Glaube macht mich nicht selig, sagte er, zumal nicht der Glaube an mich.
Aber gesetzt, dass jemand allen Ernstes sagte, die Dichter lügen zuviel: so hat er Recht, – wir lügen zuviel.
Wir wissen auch zu wenig und sind schlechte Lerner: so müssen wir schon lügen.
Und wer von uns Dichtern hätte nicht seinen Wein verfälscht? Manch giftiger Mischmasch geschah in unsern Kellern, manches Unbeschreibliche ward da gethan.
Und weil wir wenig wissen, so gefallen uns von Herzen die geistig Armen, sonderlich wenn es junge Weibchen sind!
Und selbst nach den Dingen sind wir noch begehrlich, die sich die alten Weibchen Abends erzählen. Das heissen wir selber an uns das Ewig-Weibliche.
Und als ob es einen besondren geheimen Zugang zum Wissen gäbe, der sich Denen verschütte, welche Etwas lernen: so glauben wir an das Volk und seine »Weisheit.«
Das aber glauben alle Dichter: dass wer im Grase oder an einsamen Gehängen liegend die Ohren spitze, Etwas von den Dingen erfahre, die zwischen Himmel und Erde sind.
Und kommen ihnen zärtliche Regungen, so meinen die Dichter immer, die Natur selber sei in sie verliebt:
Und sie schleiche zu ihrem Ohre, Heimliches hinein zu sagen und verliebte Schmeichelreden: dessen brüsten und blähen sie sich vor allen Sterblichen!
Ach, es giebt so viel Dinge zwischen Himmel und Erden, von denen sich nur die Dichter Etwas haben träumen lassen!
Und zumal über dem Himmel: denn alle Götter sind Dichter-Gleichniss, Dichter-Erschleichniss!
Wahrlich, immer zieht es uns hinan – nämlich zum Reich der Wolken: auf diese setzen wir unsre bunten Bälge und heissen sie dann Götter und Übermenschen: –
Sind sie doch gerade leicht genug für diese Stühle! – alle diese Götter und Übermenschen.
Ach, wie bin ich all des Unzulänglichen müde, das durchaus Ereigniss sein soll! Ach, wie bin ich der Dichter müde!
Als Zarathustra so sprach, zürnte ihm sein Jünger, aber er schwieg. Und auch Zarathustra schwieg; und sein Auge hatte sich nach innen gekehrt, gleich als ob es in weite Fernen sähe. Endlich seufzte er und holte Athem.
Ich bin von Heute und Ehedem, sagte er dann; aber Etwas ist in mir, das ist von Morgen und übermorgen und Einstmals.
Ich wurde der Dichter müde, der alten und der neuen: Oberflächliche sind sie mir Alle und seichte Meere.
Sie dachten nicht genug in die Tiefe: darum sank ihr Gefühl nicht bis zu den Gründen.
Etwas Wollust und etwas Langeweile: das ist noch ihr bestes Nachdenken gewesen.
Gespenster-Hauch und –Huschen gilt mir all ihr Harfen-Klingklang; was wussten sie bisher von der Inbrunst der Töne! –
Sie sind mir auch nicht reinlich genug: sie trüben Alle ihr Gewässer, dass es tief scheine.
Und gerne geben sie sich damit als Versöhner: aber Mittler und Mischer bleiben sie mir und Halb-und-Halbe und Unreinliche! –
Ach, ich warf wohl mein Netz in ihre Meere und wollte gute Fische fangen; aber immer zog ich eines alten Gottes Kopf herauf.
So gab dem Hungrigen das Meer einen Stein. Und sie selber mögen wohl aus dem Meere stammen.
Gewiss, man findet Perlen in ihnen: um so ähnlicher sind sie selber harten Schalthieren. Und statt der Seele fand ich oft bei ihnen gesalzenen Schleim.
Sie lernten vom Meere auch noch seine Eitelkeit: ist nicht das Meer der Pfau der Pfauen?
Noch vor dem hässlichsten aller Büffel rollt es seinen Schweif hin, nimmer wird es seines Spitzenfächers von Silber und Seide müde.
Trutzig blickt der Büffel dazu, dem Sande nahe in seiner Seele, näher noch dem Dickicht, am nächsten aber dem Sumpfe.
Was ist ihm Schönheit und Meer und Pfauen-Zierath! Dieses Gleichniss sage ich den Dichtern.
Wahrlich, ihr Geist selber ist der Pfau der Pfauen und ein Meer von Eitelkeit!
Zuschauer will der Geist des Dichters: sollten’s auch Büffel sein! –
Aber dieses Geistes wurde ich müde: und ich sehe kommen, dass er seiner selber müde wird.
Verwandelt sah ich schon die Dichter und gegen sich selber den Blick gerichtet.
Büsser des Geistes sah ich kommen: die wuchsen aus ihnen.
Also sprach Zarathustra.