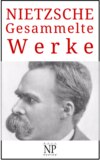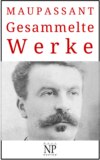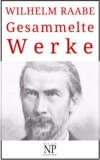Loe raamatut: «Friedrich Wilhelm Nietzsche – Gesammelte Werke», lehekülg 43
11.
Und das war ein Grieche, dessen Blüthe ungefähr dem Ausbruche der ionischen Revolution gleichzeitig ist. Einem Griechen war es damals möglich, aus der überreichen Wirklichkeit wie aus einem bloßen gauklerischen Schematismus der Einbildungskräfte zu flüchten – nicht etwa, wie Plato, in das Land der ewigen Ideen, in die Werkstätte des Weltenbildners, um unter den makellosen unzerbrechlichen Urformen der Dinge das Auge zu weiden – sondern in die starre Todesruhe des kältesten, nichtssagenden Begriffs, des Seins. Wir wollen uns ja davor hüten, eine solche merkwürdige Thatsache nach falschen Analogien zu deuten. Jene Flucht war nicht eine Weltflucht im Sinne indischer Philosophen, zu ihr forderte nicht die tiefe religiöse Überzeugung von der Verderbtheit, Vergänglichkeit und Unseligkeit des Daseins auf, jenes letzte Ziel, die Ruhe im Sein, wurde nicht erstrebt als das mystische Versenktsein in eine allgenügende entzückende Vorstellung, die dem gemeinen Menschen ein Räthsel und ein Ärgernis; ist. Das Denken des Parmenides trägt gar Nichts von dem berauschenden dunklen Duft des Indischen an sich, der vielleicht an Pythagoras und Empedokles nicht gänzlich unwahrnehmbar ist: das Wunderliche an jener Thatsache, um diese Zeit, ist vielmehr gerade das Duftlose, Farblose, Seelenlose, Angeformte, der gänzliche Mangel an Blut, Religiosität und ethischer Wärme, das Abstrakt-Schematische – bei einem Griechen! – vor Allem aber die furchtbare Energie des Strebens nach Gewißheit, in einem mythisch denkenden und höchst beweglich-phantastischen Zeitalter. »Nur eine Gewißheit gewährt mir, ihr Götter!« ist das Gebet des Parmenides »und sei sie auf dem Meere des Ungewissen nur ein Brett, breit genug, um darauf zu liegen! Alles Werdende, Üppige, Bunte, Blühende, Täuschende, Reizende, Lebendige, alles Dies nehmt nur für euch: und gebt mir nur die einzige arme leere Gewißheit!«
In der Philosophie des Parmenides präludirt das Thema der Ontologie. Die Erfahrung bot ihm nirgends ein Sein, wie er es sich dachte, aber daraus, daß er es denken konnte, erschloß er, daß es existiren müsse: ein Schluß, der auf der Voraussetzung beruht, daß wir ein Organ der Erkenntnis; haben, das in’s Wesen der Dinge reicht und unabhängig von der Erfahrung ist. Der Stoff unseres Denkens ist nach Parmenides gar nicht in der Anschauung vorhanden, sondern wird anderswoher hinzugebracht, aus einer außersinnlichen Welt, zu der wir durch das Denken einen direkten Zugang haben. Nun hat Aristoteles gegen alle ähnlichen Schlußverfahren bereits geltend gemacht, daß die Existenz nie zur Essenz, das Dasein nie zum Wesen des Dinges gehöre. Gerade deshalb ist aus dem Begriffe »Sein« – dessen essentia eben nur das Sein ist – gar nicht auf eine existentia des Seins zu schließen. Die logische Wahrheit jenes Gegensatzes »Sein« und »Nichtsein« ist vollkommen leer, wenn nicht der zu Grunde liegende Gegenstand, wenn nicht die Anschauung gegeben werden kann, aus der dieser Gegensatz, durch Abstraktion, abgeleitet ist, sie ist, ohne dies Zurückgehn auf die Anschauung, nur ein Spiel mit Vorstellungen, durch das in der That gar Nichts erkannt wird. Denn das bloß logische Kriterium der Wahrheit, wie Kant lehrt, nämlich die Übereinstimmung einer Erkenntnis; mit den allgemeinen und formalen Gesetzen des Verstandes und der Vernunft, ist zwar die conditio sine qua non, mithin die negative Bedingung aller Wahrheit: weiter aber kann die Logik nicht gehen, und den Irrthum, der nicht die Form, sondern den Inhalt betrifft, kann die Logik durch keinen Probirstein entdecken. Sobald man aber den Inhalt für die logische Wahrheit des Gegensatzes »Das was ist, ist; Das was nicht ist, ist nicht« sucht, so findet man in der That keine einzige Wirklichkeit, die nach jenem Gegensatze streng geartet wäre; ich kann von einem Baume sowohl sagen: »er ist«, im Vergleiche mit allen übrigen Dingen, als »er wird«, im Vergleich zu ihm selbst in einem anderen Zeitmomente, als endlich auch »er ist nicht«, zum Beispiel »er ist noch nicht Baum«, so lange ich etwa den Strauch betrachte. Die Worte sind nur Symbole für die Relationen der Dinge unter einander und zu uns und berühren nirgends die absolute Wahrheit: und gar das Wort »Sein« bezeichnet nur die allgemeinste Relation, die alle Dinge verknüpft, ebenso wie das Wort »Nichtsein«. Ist aber die Existenz der Dinge selbst nicht nachzuweisen, so wird die Relation der Dinge unter einander, das sogenannte »Sein« und »Nichtsein«, uns auch keinen Schritt dem Lande der Wahrheit näher bringen können. Durch Worte und Begriffe werden wir nie hinter die Wand der Relationen, etwa in irgend einen fabelhaften Urgrund der Dinge, gelangen und selbst in den reinen Formen der Sinnlichkeit und des Verstandes, in Raum, Zeit und Causalität gewinnen wir Nichts, was einer veritas aeterna ähnlich sähe. Es ist unbedingt für das Subjekt unmöglich, über sich selbst hinaus Etwas sehen und erkennen zu wollen, so unmöglich, daß Erkennen und Sein die sich widersprechendsten aller Sphären sind. Und wenn Parmenides, in der unbelehrten Naivetät der damaligen Kritik des Intellekts, wähnen durfte, aus dem ewig subjektiven Begriff zu einem An-sich-sein zu kommen, so ist es heute, nach Kant, eine kecke Ignoranz, wenn es hier und da, besonders auch unter schlecht unterrichteten Theologen, die den Philosophen spielen wollen, als Aufgabe der Philosophie hingestellt wird, das »Absolute mit dem Bewußtsein zu erfassen«, etwa gar in der Form: »das Absolute ist schon vorhanden, wie könnte es sonst gesucht werden?«, wie Hegel sich ausgedrückt hat, oder mit der Wendung des Beneke, »daß das Sein irgendwie gegeben, irgendwie für uns erreichbar sein müsse, da wir sonst nicht einmal den Begriff des Seins haben könnten«. Den Begriff des Seins! Als ob der nicht den ärmlichsten empirischen Ursprung bereits in der Etymologie des Wortes aufzeigte! Denn esse heißt ja im Grunde nur »athmen«: wenn es der Mensch von allen anderen Dingen gebraucht, so überträgt er die Überzeugung, daß er selbst athmet und lebt, durch eine Metapher, das heißt durch etwas Unlogisches, auf die anderen Dinge und begreift ihre Existenz als ein Athmen nach menschlicher Analogie. Nun verwischt sich bald die originale Bedeutung des Wortes: es bleibt aber immer so viel übrig, daß der Mensch sich das Dasein andrer Dinge nach Analogie des eignen Daseins, also anthropomorphisch, und jedenfalls durch eine unlogische Übertragung, vorstellt. Selbst für den Menschen, also abgesehn von jener Übertragung, ist aber der Satz »ich athme, also giebt es ein Sein« gänzlich unzureichend: als gegen welchen derselbe Einwand, wie gegen das ambulo, ergo sum oder ergo est, gemacht werden muß.
12.
Der andre Begriff, von größerem Gehalte, als der des Seienden, und gleichfalls bereits von Parmenides erfunden, wenngleich noch nicht so geschickt verwendet, wie von seinem Schüler Zeno, ist der des Unendlichen. Es kann nichts Unendliches existiren: denn bei einer solchen Annahme würde sich der widerspruchsvolle Begriff einer vollendeten Unendlichkeit ergeben. Da nun unsre Wirklichkeit, unsere vorhandene Welt überall den Charakter jener vollendeten Unendlichkeit trägt, so bedeutet sie ihrem Wesen nach einen Widerspruch gegen das Logische und somit auch gegen das Reale und ist Täuschung, Lüge, Phantasma. Zeno bediente sich besonders der indirekten Beweismethode: er sagte zum Beispiel »es kann keine Bewegung von einem Orte zum andern geben: denn wenn es eine solche gäbe, so wäre eine Unendlichkeit vollendet gegeben: dies ist aber eine Unmöglichkeit«. Achill kann die Schildkröte, die einen kleinen Vorsprung hat, im Wettlaufe nicht einholen; denn um nur den Punkt, von dem die Schildkröte aus läuft, zu erreichen, müßte er bereits zahllose, unendlich viele Räume durchlaufen haben, nämlich zuerst die Hälfte jenes Raumes, dann das Viertel, dann das Achtel, dann das Sechzehntel und so weiter in infinitum. Wenn er thatsächlich die Schildkröte einholt, so ist dies ein unlogisches Phänomen, also jedenfalls keine Wahrheit, keine Realität, kein wahres Sein, sondern nur eine Täuschung. Denn nie ist es möglich das Unendliche zu beendigen. Ein andres populäres Ausdrucksmittel dieser Lehre ist der fliegende und doch ruhende Pfeil. In jedem Augenblicke seines Flugs hat er eine Lage: in dieser Lage ruht er. Wäre jetzt die Summe der unendlichen Lagen der Ruhe identisch mit Bewegung? Wäre jetzt das Ruhen, unendlich wiederholt, Bewegung, also sein eigner Gegensatz? Das Unendliche wird hier als Scheidewasser der Wirklichkeit benutzt, an ihm löst sie sich auf. Wenn aber die Begriffe fest, ewig und seiend sind – und Sein und Denken fällt für Parmenides zusammen –, wenn also das Unendliche nie vollendet sein kann, wenn Ruhe nie Bewegung werden kann, so ist der Pfeil in Wahrheit gar nicht geflogen: er kam gar nicht von der Stelle und aus der Ruhe, kein Zeitmoment ist vergangen. Oder anders ausgedrückt: es giebt in dieser sogenannten, doch nur angeblichen Wirklichkeit weder Zeit, noch Raum, noch Bewegung. Zuletzt ist der Pfeil selbst nur eine Täuschung: denn er stammt aus der Vielheit, aus der durch die Sinne erzeugten Phantasmagorie des Nicht-Einen. Angenommen der Pfeil hätte ein Sein, dann wäre er unbeweglich, zeitlos, ungeworden, starr und ewig – eine unmögliche Vorstellung! Angenommen, die Bewegung wäre wahrhaft real, so gäbe es keine Ruhe, also keine Lage für den Pfeil, also keinen Raum – eine unmögliche Vorstellung! Angenommen, daß die Zeit real sei, so könnte sie nicht unendlich theilbar sein; die Zeit, die der Pfeil brauchte, müßte aus einer begrenzten Anzahl von Zeitmomenten bestehen, jeder dieser Momente müßte ein Atomon sein – eine unmögliche Vorstellung! Alle unsre Vorstellungen, sobald ihr empirisch gegebner, aus dieser anschaulichen Welt geschöpfter Inhalt als veritas aeterna genommen wird, führen auf Widersprüche. Giebt es absolute Bewegung, so giebt es keinen Raum: giebt es absoluten Raum, so giebt es keine Bewegung; giebt es ein absolutes Sein, so giebt es keine Vielheit. Giebt es eine absolute Vielheit, so giebt es keine Einheit. Da sollte Einem doch klar werden, wie wenig wir mit solchen Begriffen das Herz der Dinge berühren oder den Knoten der Realität aufknüpfen: während Parmenides und Zeno umgekehrt an der Wahrheit und Allgültigkeit der Begriffe festhalten und die anschauliche Welt als das Gegenstück der wahren und allgültigen Begriffe, als eine Objektivation des Unlogischen und Widerspruchsvollen verwerfen. Sie gehen bei allen ihren Beweisen von der gänzlich unbeweisbaren, ja unwahrscheinlichen Voraussetzung aus, daß wir in jenem Begriffsvermögen das entscheidende höchste Kriterium über Sein und Nichtsein, das heißt über die objektive Realität und ihr Gegentheil, besitzen: jene Begriffe sollen sich nicht an der Wirklichkeit bewähren und corrigiren, wie sie doch aus ihr thatsächlich abgeleitet sind, sondern sollen im Gegentheil die Wirklichkeit messen und richten, und, im Falle eines Widerspruchs mit dem Logischen, sogar verdammen. Um ihnen diese richterlichen Befugnisse einräumen zu können, mußte Parmenides ihnen dasselbe Sein zuschreiben, das er überhaupt allein als Sein gelten ließ: Denken und jener eine ungewordene vollkommne Ball des Seienden waren jetzt nicht mehr als zwei verschiedne Arten des Seins zu fassen, da es keine Zweiheit des Seins geben durfte. So war der überverwegene Einfall nothwendig geworden, Denken und Sein für identisch zu erklären; keine Form der Anschaulichkeit, kein Symbol, kein Gleichniß konnte hier zu Hülfe kommen; der Einfall war völlig unvorstellbar, aber er war nothwendig, ja er feierte in dem Mangel an jeder Versinnlichungs-Möglichkeit den höchsten Triumph über die Welt und die Forderungen der Sinne. Das Denken und jenes knollig-kugelrunde, durch und durch todt-massive und starr-unbewegliche Sein müssen, nach dem parmenideischen Imperativ, zum Schrecken aller Phantasie, in Eins zusammenfallen und ganz und gar dasselbe sein. Mag diese Identität den Sinnen widersprechen! Gerade dies ist die Bürgschaft, daß sie nicht von den Sinnen entlehnt ist.
13.
Übrigens ließ sich gegen Parmenides auch ein kräftiges Paar von argumenta ad hominem oder ex concessis vorführen, durch welche zwar nicht die Wahrheit selbst an’s Licht gebracht werden konnte, aber doch die Unwahrheit jener absoluten Trennung von Sinnenwelt und Begriffswelt und der Identität von Sein und Denken. Einmal: wenn das Denken der Vernunft in Begriffen real ist, so muß auch die Vielheit und die Bewegung Realität haben, denn das vernünftige Denken ist bewegt, und zwar ist dies eine Bewegung von Begriff zu Begriff, also innerhalb einer Mehrheit von Realitäten. Dagegen giebt es keine Ausflucht, es ist ganz unmöglich, das Denken als ein starres Verharren, als ein ewig unbewegtes Sich-selbst-Denken der Einheit zu bezeichnen. Zweitens: wenn von den Sinnen nur Trug und Schein kommt, und es in Wahrheit nur die reale Identität von Sein und Denken giebt, was sind dann die Sinne selbst? Jedenfalls doch auch nur Schein: da sie mit dem Denken und ihr Produkt, die Sinnenwelt, mit dem Sein nicht zusammenfällt. Wenn aber die Sinne selbst Schein sind, wem sind sie dann Schein? Wie können sie, als unreal, doch noch täuschen? Das Nichtseiende kann nicht einmal betrügen. Es bleibt also das Woher? der Täuschung und des Scheins ein Räthsel, ja ein Widerspruch. Wir nennen diese argumenta ad hominem den Einwand von der bewegten Vernunft und den von dem Ursprung des Scheins. Aus dem ersten würde die Realität der Bewegung und der Vielheit, aus dem zweiten die Unmöglichkeit des parmenideischen Scheines folgen; vorausgesetzt, daß die Hauptlehre des Parmenides, über das Sein, als begründet angenommen ist. Diese Hauptlehre aber heißt nur: das Seiende allein hat ein Sein, das Nichtseiende ist nicht. Ist die Bewegung aber ein solches Sein, so gilt von ihr, was von dem Seienden überhaupt und in jedem Falle gilt: sie ist ungeworden, ewig, unzerstörbar, ohne Zunahme und Abnahme. Wird aber der Schein aus dieser Welt weggeleugnet, mit Hülfe jener Frage nach dem Woher? des Scheins, wird die Bühne des sogenannten Werdens, der Veränderung, unser vielgestaltetes, rastloses, buntes und reiches Dasein, vor der parmenideischen Verwerfung geschützt, so ist es nöthig, diese Welt des Wechsels und der Veränderung als eine Summe von solchen wahrhaft seienden, in alle Ewigkeit zugleich existirenden Wesenheiten zu charakterisiren. Von einer Veränderung in strengem Sinne, von einem Werden, ist natürlich auch bei dieser Annahme durchaus nicht zu reden. Aber jetzt hat die Vielheit ein wahres Sein, alle Qualitäten haben ein wahres Sein, die Bewegung nicht minder: und von jedem Moment dieser Welt, ob auch diese beliebig gewählten Momente um Jahrtausende auseinander liegen, müßte gesagt werden können: alle in ihr vorhandenen wahren Wesenheiten sind sammt und sonders zugleich da, unverändert, unvermindert, ohne Zuwachs, ohne Abnahme. Ein Jahrtausend später ist sie eben dieselbe, Nichts hat sich verwandelt. Sieht trotzdem die Welt das eine Mal ganz anders aus, als das andre Mal, so ist dies keine Täuschung, Nichts nur Scheinbares, sondern Folge der ewigen Bewegung. Das wahrhaft Seiende ist bald so, bald so bewegt, aneinander auseinander, nach oben nach unten, in einander durch einander.
14.
Mit dieser Vorstellung haben wir bereits einen Schritt in den Bezirk der Lehre des Anaxagoras gethan. Von ihm werden beide Einwände, der vom bewegten Denken und der von dem Woher? des Scheins, in voller Kraft gegen Parmenides erhoben: aber in dem Hauptsatze hat Parmenides ihn sowie alle jüngeren Philosophen und Naturforscher unterjocht. Sie Alle leugnen die Möglichkeit des Werdens und Vergehens, wie es sich der Sinn des Volks denkt und wie es Anaximander und Heraklit mit tieferer Besonnenheit, und doch noch unbesonnen, angenommen hatten. Ein solches mythologisches Entstehen aus dem Nichts, Verschwinden in das Nichts, eine solche willkürliche Veränderung des Nichts in das Etwas, ein solches beliebiges Vertauschen, Ausziehen und Anziehen der Qualitäten galt von nun an als sinnlos: aber ebenfalls und aus den gleichen Gründen ein Entstehen des Vielen aus dem Einen, der mannigfachen Qualitäten aus der einen Urqualität, kurz die Ableitung der Welt aus einem Urstoffe, in der Manier des Thales, oder des Heraklit. Jetzt war vielmehr das eigentliche Problem aufgestellt, die Lehre vom ungewordnen und unvergänglichen Sein auf diese vorhandene Welt zu übertragen, ohne zur Theorie des Scheins und der Täuschung durch die Sinne eine Zuflucht zu nehmen. Wenn die empirische Welt aber nicht Schein sein soll, wenn die Dinge nicht aus dem Nichts und ebensowenig aus dem einen Etwas abzuleiten sind, so müssen diese Dinge selbst ein wahrhaftes Sein enthalten, ihr Stoff und Inhalt muß unbedingt real sein, und alle Veränderung kann sich nur auf die Form, das heißt auf die Stellung, Ordnung, Gruppirung, Mischung, Entmischung dieser ewigen zugleich existirenden Wesenheiten beziehn. Es ist dann wie beim Würfelspiel: immer sind es dieselben Würfel, aber bald so bald so fallend bedeuten sie für uns etwas Anderes. Alle älteren Theorien waren auf ein Urelement, als Schoß und Ursache des Werdens, zurückgegangen, sei dies nun Wasser, Luft, Feuer oder das Unbestimmte des Anaximander. Dagegen behauptet nun Anaxagoras, daß aus dem Gleichen nie das Ungleiche hervorgehen könne und daß aus dem einen Seienden die Veränderung nie zu erklären sei. Ob man sich jenen einen angenommenen Stoff nun verdünnt oder verdichtet denke, niemals erreiche man, durch eine solche Verdichtung oder Verdünnung, Das, was man zu erklären wünsche: die Vielheit der Qualitäten. Wenn aber die Welt thatsächlich voll der verschiedensten Qualitäten ist, so müssen diese, falls sie nicht Schein sind, ein Sein haben, das heißt ewig ungeworden unvergänglich und immer zugleich existirend sein. Schein aber können sie nicht sein, da die Frage nach dem Woher? des Scheins unbeantwortet bleibt, ja sich selbst mit Nein! beantwortet. Die älteren Forscher hatten das Problem des Werdens dadurch vereinfachen wollen, daß sie nur eine Substanz aufstellten, die die Möglichkeiten alles Werdens im Schoße trage; jetzt wird im Gegentheil gesagt: es giebt zahllose Substanzen, aber nie mehr, nie weniger, nie neue. Nur die Bewegung würfelt sie immer neu durcheinander: daß aber die Bewegung eine Wahrheit und nicht ein Schein sei, bewies Anaxagoras aus der unbestreitbaren Succession unserer Vorstellungen im Denken, gegen Parmenides. Wir haben also auf die unmittelbarste Weise die Einsicht in die Wahrheit der Bewegung und der Succession, darin, daß wir denken und Vorstellungen haben. Also ist jedenfalls das starre, ruhende, todte eine Sein des Parmenides aus dem Wege geschafft, es giebt viele Seiende, ebenso sicher als alle diese vielen Seienden (Existenzen, Substanzen) in Bewegung sind. Veränderung ist Bewegung – aber woher stammt die Bewegung? Läßt vielleicht diese Bewegung das eigentliche Wesen jener vielen unabhängigen isolirten Substanzen gänzlich unberührt und muß sie nicht, nach dem strengsten Begriff des Seienden, ihnen an sich fremd sein? Oder gehört sie trotzdem den Dingen selbst an? Wir stehen an einer wichtigen Entscheidung: je nachdem wir uns wenden, werden wir auf das Gebiet des Anaxagoras oder des Empedokles oder des Demokrit treten. Die bedenkliche Frage muß aufgestellt werden: wenn es viele Substanzen giebt und diese vielen sich bewegen, was bewegt sie? Bewegen sie sich gegenseitig? Bewegt sie etwa nur die Schwerkraft? Oder giebt es magische Kräfte der Anziehung oder der Abstoßung in den Dingen selbst? Oder liegt der Anlaß der Bewegung außerhalb dieser vielen realen Substanzen? Oder strenger gefragt: wenn zwei Dinge eine Succession, eine gegenseitige Veränderung der Lage zeigen, kommt dies von ihnen selbst her? Und ist dies mechanisch oder magisch zu erklären? Oder, wenn dies nicht der Fall wäre, ist es etwas Drittes, was sie bewegt? Es ist ein schlimmes Problem: denn Parmenides hätte auch, selbst zugegeben, daß es viele Substanzen gäbe, doch immer noch die Unmöglichkeit der Bewegung, gegen Anaxagoras, beweisen können. Er konnte nämlich sagen: nehmt zwei an sich seiende Wesen, jedes mit durchaus verschiedenartigem, selbständig unbedingtem Sein – und solcher Art sind die anaxagorischen Substanzen –: nie können sie demnach auf einander stoßen, nie sich bewegen, nie sich anziehn, es giebt zwischen ihnen keine Kausalität, keine Brücke, sie berühren sich nicht, sie stören sich nicht, sie gehen sich nichts an. Der Stoß ist dann ganz ebenso unerklärlich wie die magische Anziehung; was sich unbedingt fremd ist, kann keine Art von Wirkung auf einander ausüben, also sich auch nicht bewegen, noch bewegen lassen. Parmenides würde sogar hinzugefügt haben: der einzige Ausweg, der euch bleibt, ist, den Dingen selbst Bewegung zuzuschreiben; dann ist aber doch alles Das, was ihr als Bewegung kennt und seht, nur eine Täuschung und nicht die wahre Bewegung, denn die einzige Art Bewegung, die jenen unbedingt eigenartigen Substanzen zukommen könnte, wäre nur eine selbsteigne Bewegung ohne jede Wirkung. Nun nehmt ihr aber gerade Bewegung an, um jene Wirkungen des Wechsels, der Verschiebung im Raume, der Veränderung, kurz die Causalitäten und Relationen der Dinge unter einander zu erklären. Gerade diese Wirkungen waren aber nicht erklärt und blieben so problematisch wie vorher; weshalb gar nicht abzusehn ist, wozu es nöthig wäre eine Bewegung anzunehmen, da sie gar nicht Das leistet, was ihr von ihr begehrt. Die Bewegung kommt dem Wesen der Dinge nicht zu und ist ihnen ewig fremd.
Sich über eine solche Argumentation hinwegzusetzen, wurden jene Gegner der eleatischen unbewegten Einheit durch ein aus der Sinnlichkeit stammendes Vorurtheil verführt. Es scheint so unwiderleglich, daß jedes wahrhaft Seiende ein raumfüllender Körper sei, ein Klumpen Materie, groß oder klein, aber jedenfalls räumlich ausgedehnt: so daß zwei und mehrere solcher Klumpen nicht in einem Raume sein können. Unter dieser Voraussetzung nahm Anaxagoras wie später Demokrit an daß sie sich stoßen müßten, wenn sie in ihren Bewegungen auf einander geriethen, daß sie sich den gleichen Raum streitig machen würden, und daß dieser Kampf eben alle Veränderung verursache. Mit andern Worten: jene ganz isolirten, durch und durch verschiedenartigen und ewig unveränderlichen Substanzen waren doch nicht absolut verschiedenartig gedacht, sondern hatten sämmtlich, außer einer specifischen, ganz besonderen Qualität, doch ein ganz und gar gleichartiges Substrat, ein Stück raumfüllender Materie. In der Theilnahme an der Materie standen sie Alle gleich und konnten deshalb auf einander wirken, d. h. sich stoßen. Überhaupt hieng alle Veränderung ganz und gar nicht ab von der Verschiedenartigkeit jener Substanzen, sondern von ihrer Gleichartigkeit, als Materie. Es liegt hier in den Annahmen des Anaxagoras ein logisches Versehen zu Grunde: denn das wahrhaft an sich Seiende muß gänzlich unbedingt und einheitlich sein, darf somit Nichts als seine Ursache voraussetzen – während alle jene anaxagorischen Substanzen doch noch ein Bedingendes, die Materie haben und deren Existenz bereits voraussetzen: die Substanz »Roth« zum Beispiel war für Anaxagoras eben nicht nur roth an sich, sondern außerdem, verschwiegenerweise, ein Stück qualitätenloser Materie. Nur mit dieser wirkte das »Roth an sich« auf andere Substanzen, nicht mit dem Rothen, sondern mit Dem, was nicht roth, nicht gefärbt, überhaupt nicht qualitativ bestimmt ist. Wäre das Roth als Roth streng genommen worden, als die eigentliche Substanz selbst, also ohne jenes Substrat, so würde Anaxagoras gewiß nicht gewagt haben, von einer Wirkung des Roth auf andre Substanzen zu reden, etwa gar mit der Wendung, daß das »Roth an sich« die vom »Fleischigen an sich« empfangene Bewegung durch Stoß weiterpflanze. Dann würde es klar sein, daß ein solches wahrhaft Seiendes nie bewegt werden könnte.