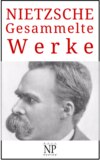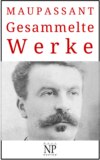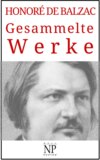Loe raamatut: «Friedrich Wilhelm Nietzsche – Gesammelte Werke», lehekülg 9
Von den Tugendhaften
Mit Donnern und himmlischen Feuerwerken muss man zu schlaffen und schlafenden Sinnen reden.
Aber der Schönheit Stimme redet leise: sie schleicht sich nur in die aufgewecktesten Seelen.
Leise erbebte und lachte mir heut mein Schild; das ist der Schönheit heiliges Lachen und Beben.
Über euch, ihr Tugendhaften, lachte heut meine Schönheit. Und also kam ihre Stimme zu mir: »sie wollen noch – bezahlt sein!«
Ihr wollt noch bezahlt sein, ihr Tugendhaften! Wollt Lohn für Tugend und Himmel für Erden und Ewiges für euer Heute haben?
Und nun zürnt ihr mir, dass ich lehre, es giebt keinen Lohn- und Zahlmeister? Und wahrlich, ich lehre nicht einmal, dass Tugend ihr eigener Lohn ist.
Ach, das ist meine Trauer: in den Grund der Dinge hat man Lohn und Strafe hineingelogen – und nun auch noch in den Grund eurer Seelen, ihr Tugendhaften!
Aber dem Rüssel des Ebers gleich soll mein Wort den Grund eurer Seelen aufreissen; Pflugschar will ich euch heissen.
Alle Heimlichkeiten eures Grundes sollen an’s Licht; und wenn ihr aufgewühlt und zerbrochen in der Sonne liegt, wird auch eure Lüge von eurer Wahrheit ausgeschieden sein.
Denn diess ist eure Wahrheit: ihr seid zu reinlich für den Schmutz der Worte: Rache, Strafe, Lohn, Vergeltung.
Ihr liebt eure Tugend, wie die Mutter ihr Kind; aber wann hörte man, dass eine Mutter bezahlt sein wollte für ihre Liebe?
Es ist euer liebstes Selbst, eure Tugend. Des Ringes Durst ist in euch: sich selber wieder zu erreichen, dazu ringt und dreht sich jeder Ring.
Und dem Sterne gleich, der erlischt, ist jedes Werk eurer Tugend: immer ist sein Licht noch unterwegs und wandert – und wann wird es nicht mehr unterwegs sein?
Also ist das Licht eurer Tugend noch unterwegs, auch wenn das Werk gethan ist. Mag es nun vergessen und todt sein: sein Strahl von Licht lebt noch und wandert.
Dass eure Tugend euer Selbst sei und nicht ein Fremdes, eine Haut, eine Bemäntelung: das ist die Wahrheit aus dem Grunde eurer Seele, ihr Tugendhaften! –
Aber wohl giebt es Solche, denen Tugend der Krampf unter einer Peitsche heisst: und ihr habt mir zuviel auf deren Geschrei gehört!
Und Andre giebt es, die heissen Tugend das Faulwerden ihrer Laster; und wenn ihr Hass und ihre Eifersucht einmal die Glieder strecken, wird ihre »Gerechtigkeit« munter und reibt sich die verschlafenen Augen.
Und Andre giebt es, die werden abwärts gezogen: ihre Teufel ziehn sie. Aber je mehr sie sinken, um so glühender leuchtet ihr Auge und die Begierde nach ihrem Gotte.
Ach, auch deren Geschrei drang zu euren Ohren, ihr Tugendhaften: was ich nicht bin, das, das ist mir Gott und Tugend!’
Und Andre giebt es, die kommen schwer und knarrend daher, gleich Wägen, die Steine abwärts fahren: die reden viel von Würde und Tugend, – ihren Hemmschuh heissen sie Tugend!
Und Andre giebt es, die sind gleich Alltags-Uhren, die aufgezogen wurden; sie machen ihr Tiktak und wollen, dass man Tiktak – Tugend heisse.
Wahrlich, an Diesen habe ich meine Lust: wo ich solche Uhren finde, werde ich sie mit meinem Spotte aufziehn; und sie sollen mir dabei noch schnurren!
Und Andre sind stolz über ihre Handvoll Gerechtigkeit und begehen um ihrerwillen Frevel an allen Dingen: also dass die Welt in ihrer Ungerechtigkeit ertränkt wird.
Ach, wie übel ihnen das Wort »Tugend« aus dem Munde läuft! Und wenn sie sagen: »ich bin gerecht,« so klingt es immer gleich wie: »ich bin gerächt!«
Mit ihrer Tugend wollen sie ihren Feinden die Augen auskratzen; und sie erheben sich nur, um Andre zu erniedrigen.
Und wiederum giebt es Solche, die sitzen in ihrem Sumpfe und reden also heraus aus dem Schilfrohr: »Tugend – das ist still im Sumpfe sitzen.
Wir beissen Niemanden und gehen Dem aus dem Wege, der beissen will; und in Allem haben wir die Meinung, die man uns giebt.«
Und wiederum giebt es Solche, die lieben Gebärden und denken: Tugend ist eine Art Gebärde.
Ihre Kniee beten immer an, und ihre Hände sind Lobpreisungen der Tugend, aber ihr Herz weiss Nichts davon.
Und wiederum giebt es Solche, die halten es für Tugend, zu sagen: »Tugend ist nothwendig«; aber sie glauben im Grunde nur daran, dass Polizei nothwendig ist.
Und Mancher, der das Hohe an den Menschen nicht sehen kann, nennt es Tugend, dass er ihr Niedriges allzunahe sieht: also heisst er seinen bösen Blick Tugend.
Und Einige wollen erbaut und aufgerichtet sein und heissen es Tugend; und Andre wollen umgeworfen sein – und heissen es auch Tugend.
Und derart glauben fast Alle daran, Antheil zu haben an der Tugend; und zum Mindesten will ein jeder Kenner sein über »gut« und »böse«.
Aber nicht dazu kam Zarathustra, allen diesen Lügnern und Narren zu sagen: »was wisst ihr von Tugend! Was könntet ihr von Tugend wissen!« –
Sondern, dass ihr, meine Freunde, der alten Worte müde würdet, welche ihr von den Narren und Lügnern gelernt habt:
Müde würdet der Worte »Lohn,« »Vergeltung,« »Strafe,« »Rache in der Gerechtigkeit« –
Müde würdet zu sagen: »dass eine Handlung gut ist, das macht, sie ist selbstlos.«
Ach, meine Freunde! Dass euer Selbst in der Handlung sei, wie die Mutter im Kinde ist: das sei mir euer Wort von Tugend!
Wahrlich, ich nahm euch wohl hundert Worte und eurer Tugend liebste Spielwerke; und nun zürnt ihr mir, wie Kinder zürnen.
Sie spielten am Meere, – da kam die Welle und riss ihnen ihr Spielwerk in die Tiefe: nun weinen sie.
Aber die selbe Welle soll ihnen neue Spielwerke bringen und neue bunte Muscheln vor sie hin ausschütten!
So werden sie getröstet sein; und gleich ihnen sollt auch ihr, meine Freunde, eure Tröstungen haben – und neue bunte Muscheln! –
Also sprach Zarathustra.
Vom Gesindel
Das Leben ist ein Born der Lust; aber wo das Gesindel mit trinkt, da sind alle Brunnen vergiftet.
Allem Reinlichen bin ich hold; aber ich mag die grinsenden Mäuler nicht sehn und den Durst der Unreinen.
Sie warfen ihr Auge hinab in den Brunnen: nun glänzt mir ihr widriges Lächeln herauf aus dem Brunnen.
Das heilige Wasser haben sie vergiftet mit ihrer Lüsternheit; und als sie ihre schmutzigen Träume Lust nannten, vergifteten sie auch noch die Worte.
Unwillig wird die Flamme, wenn sie ihre feuchten Herzen an’s Feuer legen; der Geist selber brodelt und raucht, wo das Gesindel an’s Feuer tritt.
Süsslich und übermürbe wird in ihrer Hand die Frucht: windfällig und wipfeldürr macht ihr Blick den Fruchtbaum.
Und Mancher, der sich vom Leben abkehrte, kehrte sich nur vom Gesindel ab: er wollte nicht Brunnen und Flamme und Frucht mit dem Gesindel theilen.
Und Mancher, der in die Wüste gieng und mit Raubthieren Durst litt, wollte nur nicht mit schmutzigen Kameeltreibern um die Cisterne sitzen.
Und Mancher, der wie ein Vernichter daher kam und wie ein Hagelschlag allen Fruchtfeldern, wollte nur seinen Fuss dem Gesindel in den Rachen setzen und also seinen Schlund stopfen.
Und nicht das ist der Bissen, an dem ich am meisten würgte, zu wissen, dass das Leben selber Feindschaft nöthig hat und Sterben und Marterkreuze: –
Sondern ich fragte einst und erstickte fast an meiner Frage: wie? hat das Leben auch das Gesindel nöthig?
Sind vergiftete Brunnen nöthig und stinkende Feuer und beschmutzte Träume und Maden im Lebensbrode?
Nicht mein Hass, sondern mein Ekel frass mir hungrig am Leben! Ach, des Geistes wurde ich oft müde, als ich auch das Gesindel geistreich fand!
Und den Herrschenden wandt’ich den Rücken, als ich sah, was sie jetzt Herrschen nennen: schachern und markten um Macht – mit dem Gesindel!
Unter Völkern wohnte ich fremder Zunge, mit verschlossenen Ohren: dass mir ihres Schacherns Zunge fremd bliebe und ihr Markten um Macht.
Und die Nase mir haltend, gieng ich unmuthig durch alles Gestern und Heute: wahrlich, übel riecht alles Gestern und Heute nach dem schreibenden Gesindel!
Einem Krüppel gleich, der taub und blind und stumm wurde: also lebte ich lange, dass ich nicht mit Macht- und Schreib- und Lust-Gesindel lebte.
Mühsam stieg mein Geist Treppen, und vorsichtig; Almosen der Lust waren sein Labsal; am Stabe schlich dem Blinden das Leben.
Was geschah mir doch? Wie erlöste ich mich vom Ekel? Wer verjüngte mein Auge? Wie erflog ich die Höhe, wo kein Gesindel mehr am Brunnen sitzt?
Schuf mein Ekel selber mir Flügel und quellenahnende Kräfte? Wahrlich, in’s Höchste musste ich fliegen, dass ich den Born der Lust wiederfände!
Oh, ich fand ihn, meine Brüder! Hier im Höchsten quillt mir der Born der Lust! Und es giebt ein Leben, an dem kein Gesindel mit trinkt!
Fast zu heftig strömst du mir, Quell der Lust! Und oft leerst du den Becher wieder, dadurch dass du ihn füllen willst!
Und noch muss ich lernen, bescheidener dir zu nahen: allzuheftig strömt dir noch mein Herz entgegen: –
Mein Herz, auf dem mein Sommer brennt, der kurze, heisse, schwermüthige, überselige: wie verlangt mein Sommer-Herz nach deiner Kühle!
Vorbei die zögernde Trübsal meines Frühlings! Vorüber die Bosheit meiner Schneeflocken im Juni! Sommer wurde ich ganz und Sommer-Mittag!
Ein Sommer im Höchsten mit kalten Quellen und seliger Stille: oh kommt, meine Freunde, dass die Stille noch seliger werde! Denn diess ist unsre Höhe und unsre Heimat: zu hoch und steil wohnen wir hier allen Unreinen und ihrem Durste. Werft nur eure reinen Augen in den Born meiner Lust, ihr Freunde! Wie sollte er darob trübe werden! Entgegenlachen soll er euch mit seiner Reinheit.
Auf dem Baume Zukunft bauen wir unser Nest; Adler sollen uns Einsamen Speise bringen in ihren Schnäbeln!
Wahrlich, keine Speise, an der Unsaubere mitessen dürften! Feuer würden sie zu fressen wähnen und sich die Mäuler verbrennen!
Wahrlich, keine Heimstätten halten wir hier bereit für Unsaubere! Eishöhle würde ihren Leibern unser Glück heissen und ihren Geistern!
Und wie starke Winde wollen wir über ihnen leben, Nachbarn den Adlern, Nachbarn dem Schnee, Nachbarn der Sonne: also leben starke Winde.
Und einem Winde gleich will ich einst noch zwischen sie blasen und mit meinem Geiste ihrem Geiste den Athem nehmen: so will es meine Zukunft.
Wahrlich, ein starker Wind ist Zarathustra allen Niederungen; und solchen Rath räth er seinen Feinden und Allem, was spuckt und speit: hütet euch gegen den Wind zu speien!"
Also sprach Zarathustra.
Von den Taranteln
Siehe, das ist der Tarantel Höhle! Willst du sie selber sehn? Hier hängt ihr Netz: rühre daran, dass es erzittert.
Da kommt sie willig: willkommen, Tarantel! Schwarz sitzt auf deinem Rücken dein Dreieck und Wahrzeichen; und ich weiss auch, was in deiner Seele sitzt.
Rache sitzt in deiner Seele: wohin du beissest, da wächst schwarzer Schorf; mit Rache macht dein Gift die Seele drehend!
Also rede ich zu euch im Gleichniss, die ihr die Seelen drehend macht, ihr Prediger der Gleichheit! Taranteln seid ihr mir und versteckte Rachsüchtige!
Aber ich will eure Verstecke schon an’s Licht bringen: darum lache ich euch in’s Antlitz mein Gelächter der Höhe.
Darum reisse ich an eurem Netze, dass eure Wuth euch aus eurer Lügen-Höhle locke, und eure Rache hervorspringe hinter eurem Wort »Gerechtigkeit.«
Denn dass der Mensch erlöst werde von der Rache: das ist mir die Brücke zur höchsten Hoffnung und ein Regenbogen nach langen Unwettern.
Aber anders wollen es freilich die Taranteln. »Das gerade heisse uns Gerechtigkeit, dass die Welt voll werde von den Unwettern unsrer Rache« – also reden sie mit einander.
»Rache wollen wir üben und Beschimpfung an Allen, die uns nicht gleich sind« – so geloben sich die Tarantel-Herzen.
Und »Wille zur Gleichheit« – das selber soll fürderhin der Name für Tugend werden; und gegen Alles, was Macht hat, wollen wir unser Geschrei erheben!«
Ihr Prediger der Gleichheit, der Tyrannen-Wahnsinn der Ohnmacht schreit also aus euch nach »Gleichheit«: eure heimlichsten Tyrannen-Gelüste vermummen sich also in Tugend-Worte!
Vergrämter Dünkel, verhaltener Neid, vielleicht eurer Väter Dünkel und Neid: aus euch bricht’s als Flamme heraus und Wahnsinn der Rache.
Was der Vater schwieg, das kommt im Sohne zum Reden; und oft fand ich den Sohn als des Vaters entblösstes Geheimniss.
Den Begeisterten gleichen sie: aber nicht das Herz ist es, was sie begeistert, – sondern die Rache. Und wenn sie fein und kalt werden, ist’s nicht der Geist, sondern der Neid, der sie fein und kalt macht.
Ihre Eifersucht führt sie auch auf der Denker Pfade; und diess ist das Merkmal ihrer Eifersucht – immer gehn sie zu weit: dass ihre Müdigkeit sich zuletzt noch auf Schnee schlafen legen muss.
Aus jeder ihrer Klagen tönt Rache, in jedem ihrer Lobsprüche ist ein Wehethun; und Richter-sein scheint ihnen Seligkeit.
Also aber rathe ich euch, meine Freunde: misstraut Allen, in welchen der Trieb, zu strafen, mächtig ist!
Das ist Volk schlechter Art und Abkunft; aus ihren Gesichtern blickt der Henker und der Spürhund.
Misstraut allen Denen, die viel von ihrer Gerechtigkeit reden! Wahrlich, ihren Seelen fehlt es nicht nur an Honig.
Und wenn sie sich selber »die Guten und Gerechten« nennen, so vergesst nicht, dass ihnen zum Pharisäer Nichts fehlt als – Macht!
Meine Freunde, ich will nicht vermischt und verwechselt werden.
Es giebt Solche, die predigen meine Lehre vom Leben: und zugleich sind sie Prediger der Gleichheit und Taranteln.
Dass sie dem Leben zu Willen reden, ob sie gleich in ihrer Höhle sitzen, diese Gift-Spinnen, und abgekehrt vom Leben: das macht, sie wollen damit wehethun.
Solchen wollen sie damit wehethun, die jetzt die Macht haben: denn bei diesen ist noch die Predigt vom Tode am besten zu Hause.
Wäre es anders, so würden die Taranteln anders lehren: und gerade sie waren ehemals die besten Welt-Verleumder und Ketzer-Brenner.
Mit diesen Predigern der Gleichheit will ich nicht vermischt und verwechselt sein. Denn so redet mir die Gerechtigkeit: »die Menschen sind nicht gleich.«
Und sie sollen es auch nicht werden! Was wäre denn meine Liebe zum Übermenschen, wenn ich anders spräche?
Auf tausend Brücken und Stegen sollen sie sich drängen zur Zukunft, und immer mehr Krieg und Ungleichheit soll zwischen sie gesetzt sein: so lässt mich meine grosse Liebe reden!
Erfinder von Bildern und Gespenstern sollen sie werden in ihren Feindschaften, und mit ihren Bildern und Gespenstern sollen sie noch gegeneinander den höchsten Kampf kämpfen!
Gut und Böse, und Reich und Arm, und Hoch und Gering, und alle Namen der Werthe: Waffen sollen es sein und klirrende Merkmale davon, dass das Leben sich immer wieder selber überwinden muss!
In die Höhe will es sich bauen mit Pfeilern und Stufen, das Leben selber: in weite Fernen will es blicken und hinaus nach seligen Schönheiten, – darum braucht es Höhe!
Und weil es Höhe braucht, braucht es Stufen und Widerspruch der Stufen und Steigenden! Steigen will das Leben und steigend sich überwinden.
Und seht mir doch, meine Freunde! Hier, wo der Tarantel Höhle ist, heben sich eines alten Tempels Trümmer aufwärts, – seht mir doch mit erleuchteten Augen hin!
Wahrlich, wer hier einst seine Gedanken in Stein nach Oben thürmte, um das Geheimniss alles Lebens wusste er gleich dem Weisesten!
Dass Kampf und Ungleiches auch noch in der Schönheit sei und Krieg um Macht und Übermacht: das lehrt er uns hier im deutlichsten Gleichniss.
Wie sich göttlich hier Gewölbe und Bogen brechen, im Ringkampfe: wie mit Licht und Schatten sie wider einander streben, die göttlich-Strebenden –
Also sicher und schön lasst uns auch Feinde sein, meine Freunde! Göttlich wollen wir wider einander streben! –
Wehe! Da biss mich selber die Tarantel, meine alte Feindin! Göttlich sicher und schön biss sie mich in den Finger!
»Strafe muss sein und Gerechtigkeit – so denkt sie: nicht umsonst soll er hier der Feindschaft zu Ehren Lieder singen!«
Ja, sie hat sich gerächt! Und wehe! nun wird sie mit Rache auch noch meine Seele drehend machen!
Dass ich mich aber nicht drehe, meine Freunde, bindet mich fest hier an diese Säule! Lieber noch Säulen-Heiliger will ich sein, als Wirbel der Rachsucht!
Wahrlich, kein Dreh- und Wirbelwind ist Zarathustra; und wenn er ein Tänzer ist, nimmermehr doch ein Tarantel-Tänzer! –
Also sprach Zarathustra.
Von den berühmten Weisen
Dem Volke habt ihr gedient und des Volkes Aberglauben, ihr berühmten Weisen alle! – und nicht der Wahrheit! Und gerade darum zollte man euch Ehrfurcht.
Und darum auch ertrug man euren Unglauben, weil er ein Witz und Umweg war zum Volke. So lässt der Herr seine Sclaven gewähren und ergötzt sich noch an ihrem Übermuthe.
Aber wer dem Volke verhasst ist wie ein Wolf den Hunden: das ist der freie Geist, der Fessel-Feind, der Nicht-Anbeter, der in Wäldern Hausende.
Ihn zu jagen aus seinem Schlupfe – das hiess immer dem Volke »Sinn für das Rechte«: gegen ihn hetzt es noch immer seine scharfzahnigsten Hunde.
»Denn die Wahrheit ist da: ist das Volk doch da! Wehe, wehe den Suchenden!« – also scholl es von jeher.
Eurem Volke wolltet ihr Recht schaffen in seiner Verehrung: das hiesset ihr »Wille zur Wahrheit,« ihr berühmten Weisen!
Und euer Herz sprach immer zu sich: »vom Volke kam ich: von dort her kam mir auch Gottes Stimme.«
Hart-nackig und klug, dem Esel gleich, wart ihr immer als des Volkes Fürsprecher.
Und mancher Mächtige, der gut fahren wollte mit dem Volke, spannte vor seine Rosse noch – ein Eselein, einen berühmten Weisen.
Und nun wollte ich, ihr berühmten Weisen, ihr würfet endlich das Fell des Löwen ganz von euch!
Das Fell des Raubthiers, das buntgefleckte, und die Zotten des Forschenden, Suchenden, Erobernden!
Ach, dass ich an eure »Wahrhaftigkeit« glauben lerne, dazu müsstet ihr mir erst euren verehrenden Willen zerbrechen.
Wahrhaftig – so heisse ich Den, der in götterlose Wüsten geht und sein verehrendes Herz zerbrochen hat.
Im gelben Sande und verbrannt von der Sonne schielt er wohl durstig nach den quellenreichen Eilanden, wo Lebendiges unter dunkeln Bäumen ruht.
Aber sein Durst überredet ihn nicht, diesen Behaglichen gleich zu werden: denn wo Oasen sind, da sind auch Götzenbilder.
Hungernd, gewaltthätig, einsam, gottlos: so will sich selber der Löwen-Wille.
Frei von dem Glück der Knechte, erlöst von Göttern und Anbetungen, furchtlos und fürchterlich, gross und einsam: so ist der Wille des Wahrhaftigen.
In der Wüste wohnten von je die Wahrhaftigen, die freien Geister, als der Wüste Herren; aber in den Städten wohnen die gutgefütterten, berühmten Weisen, – die Zugthiere.
Immer nämlich ziehen sie, als Esel – des Volkes Karren!
Nicht dass ich ihnen darob zürne: aber Dienende bleiben sie mir und Angeschirrte, auch wenn sie von goldnem Geschirre glänzen.
Und oft waren sie gute Diener und preiswürdige. Denn so spricht die Tugend: musst du Diener sein, so suche Den, welchem dein Dienst am besten nützt!
»Der Geist und die Tugend deines Herrn sollen wachsen, dadurch dass du sein Diener bist: so wächsest du selber mit seinem Geiste und seiner Tugend!«
Und wahrlich, ihr berühmten Weisen, ihr Diener des Volkes! Ihr selber wuchset mit des Volkes Geist und Tugend – und das Volk durch euch! Zu euren Ehren sage ich das!
Aber Volk bleibt ihr mir auch noch in euren Tugenden, Volk mit blöden Augen, – Volk, das nicht weiss, was Geist ist!
Geist ist das Leben, das selber in’s Leben schneidet: an der eignen Qual mehrt es sich das eigne Wissen, – wusstet ihr das schon?
Und des Geistes Glück ist diess: gesalbt zu sein und durch Thränen geweiht zum Opferthier, – wusstet ihr das schon?
Und die Blindheit des Blinden und sein Suchen und Tappen soll noch von der Macht der Sonne zeugen, in die er schaute, – wusstet ihr das schon?
Und mit Bergen soll der Erkennende bauen lernen! Wenig ist es, dass der Geist Berge versetzt, – wusstet ihr das schon?
Ihr kennt nur des Geistes Funken: aber ihr seht den Ambos nicht, der er ist, und nicht die Grausamkeit seines Hammers!
Wahrlich, ihr kennt des Geistes Stolz nicht! Aber noch weniger würdet ihr des Geistes Bescheidenheit ertragen, wenn sie einmal reden wollte!
Und niemals noch durftet ihr euren Geist in eine Grube von Schnee werfen: ihr seid nicht heiss genug dazu! So kennt ihr auch die Entzückungen seiner Kälte nicht.
In Allem aber thut ihr mir zu vertraulich mit dem Geiste; und aus der Weisheit machtet ihr oft ein Armen- und Krankenhaus für schlechte Dichter.
Ihr seid keine Adler: so erfuhrt ihr auch das Glück im Schrekken des Geistes nicht. Und wer kein Vogel ist, soll sich nicht über Abgründen lagern.
Ihr seid mir Laue: aber kalt strömt jede tiefe Erkenntniss. Eiskalt sind die innersten Brunnen des Geistes: ein Labsal heissen Händen und Handelnden.
Ehrbar steht ihr mir da und steif und mit geradem Rücken, ihr berühmten Weisen! – euch treibt kein starker Wind und Wille.
Saht ihr nie ein Segel über das Meer gehn, geründet und gebläht und zitternd vor dem Ungestüm des Windes?
Dem Segel gleich, zitternd vor dem Ungestüm des Geistes, geht meine Weisheit über das Meer – meine wilde Weisheit!
Aber ihr Diener des Volkes, ihr berühmten Weisen, – wie könntet ihr mit mir gehn! –
Also sprach Zarathustra.