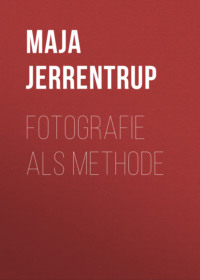Loe raamatut: «Fotografie als Methode»
ibidem-Verlag, Stuttgart
Inhalt
Einleitung
Zwei diffuse Begriffe treffen aufeinander
Möglichkeiten der Systematisierung
Beweis und Studienmaterial
Beweismittel
Bildanalyse
Neue Blickwinkel
Zugang und Kontakt
Partizipatives Fotografieren
Fotobasierte Kommunikation
Lehre und Lernen
Aufmerksamkeit, Freude und Verständnis
Media Literacy
Erinnerung
Persuasion
Glaubwürdigkeit
Traumwelt
Awareness
Fotografieren für das Wohlbefinden
Achtsamkeit und Erlebnis
Ersatzhandlung
Kreativität
Identitätsarbeit
Experimentieren und Ausleben
Kontrollieren und Kommunizieren
Fotografiert werden für das Wohlbefinden
Selbstwert
Überwindung des Körpers
Schlussbetrachtung
Literaturverzeichnis
Einleitung
Nur selten wird von der Fotografie als einer Methode gesprochen, wenngleich sie vielleicht immer gewissermaßen als solche verstanden werden kann: Auf ganz vielfältige Weise sind ihr Entstehungsprozess und ihr Ergebnis Mittel, um neue Situationen zu bewirken oder Erkenntnisse zu erzielen.
Besonders nahe liegt hier wohl die (oft infrage gestellte) Funktion der Fotografie als Beweismittel, zum Beispiel bei Tatort-Fotos oder im Bereich der Anthropometrie und Ethnographie. Darüber hinaus stellen Fotografien auch Ausgangsmaterial zu Analysen dar, beispielsweise, um Bildinhalte zu identifizieren, sortieren, kategorisieren und interpretieren, um dann auf dieser Basis Erkenntnisse zu formulieren, so etwa in der Kunstgeschichte oder der Soziologie.
Die Fotografie eröffnet außerdem neue Blickwinkel, indem sie Zugang zu Situationen bieten kann, die man ohne Kamera wohl nicht betreten dürfte – typisch für den Fotojournalismus und interessant zum Beispiel für die Ethnologie. Methoden wie “Photovoice” legen die Kamera in die Hände derer, zu deren Lebenswelten man Informationen gewinnen möchte. Diese Strategie kommt auch im Kontext gesellschaftlicher Partizipationsvorhaben zum Einsatz – wenngleich dabei häufig nicht klar ist, wie gefiltert ebendiese neue, durch die Fotografie gelieferte Perspektive ist. Zudem bieten Fotografien als Basis für Interviews die Chance, durch Assoziationen und Emotionen besser an Informationen zu gelangen. Auch das Empowerment ist diesem Zusammenhang von Bedeutung: Die Menschen, zu denen geforscht wird, sind nicht passive Forschungsobjekte, sondern werden zu kreativen Subjekten, die mit Hilfe der Fotografie ihre Themen darstellen und ihre Sicht erläutern.
Beim Lehren und Lernen spielen Visualisierungen, darunter Fotografien, ebenfalls eine wichtige Rolle. Studien aus dem Bereich der Didaktik haben ferner gezeigt, dass bei praktischen Fotoübungen besonders gute Lerneffekte erzielt werden können. Hinzu tritt der Bereich der Media Literacy, also der Fähigkeit, Medienzusammenhänge zu verstehen und für sich und andere sinnvoll und verantwortungsvoll nutzen zu können.
Des Weiteren stellt die Inszenierung und Auswahl von Fotografien eine Möglichkeit der Persuasion dar, sowohl, wenn es darum geht, etwas als „echt“ zu präsentieren, als auch, wenn eindeutig Fantasiewelten gezeigt werden. Die Indexikalität ermöglicht es in beiden Fällen, einen besonderen Bezug zur eigenen Lebenswelt herzustellen. So dient Fotografie auch immer wieder der Verführung, sei es in der Politik, der Pornographie oder Werbung.
Im Sinne des psychologischen „Well-Beings“ ist die Fotografie ebenfalls in unterschiedlichen Facetten von Bedeutung: Das Fotografieren selbst kann dabei helfen, sich zu fokussieren, Flow zu erleben, Kreativität auszuleben und Achtsamkeit zu empfinden. Sowohl beim Fotografieren, wie auch beim Fotografiertwerden und Erstellen von Selbstporträts beziehungsweise Selfies wird Identitätsarbeit ermöglicht. Der Selbstwert kann gefördert und gerade in der inszenierten Fotografie aufgrund der Verkörperung von Konzepten auch eine Art Überwindung der eigenen Körperlichkeit erzielt werden.
So zeigt sich, dass die Fotografie in ganz unterschiedlichen Bereichen „methodisch“ zum Einsatz kommt, wobei sich jeweils ganz unterschiedlich Probleme ergeben können: In manchen Bereichen ist die Fotografie historisch belastet, in anderen ihr Einsatz noch zu wenig erforscht, mal ist unklar, wie viel im engeren Sinne fotografisches, d.h. technisches und ästhetisches Grundwissen erforderlich ist, oder wem die Bilder und die mit ihnen verbundenen Daten letztlich gehören sollen. Auch solche praktischen und ethischen Aspekte sollen in diesem Buch verdeutlicht und weitere Anstöße für fachspezifische (Neu-) Evaluationen der Fotografie geliefert werden.
Zwei diffuse Begriffe treffen aufeinander
Ein erweitertes Verständnis der Fotografie zu fördern – darin besteht das Hauptziel dieses Buches. Hierfür treffen die zwei Begriffe „Fotografie“ und „Methode“ aufeinander, die jeweils auf ihre Weise schwierig zu fassen sind:
Fotografie bezeichnet sowohl die Gesamtheit der Produkte des fotografischen Handelns, deutlich in Wendungen wie „die Fotografie hat bedeutende Zeitzeugnisse hervorgebracht“, bestimmte Bild- (zwischen)ergebnisse, wenn man etwa sagt „diese Fotografie spricht mich an“, wie auch eine Art der Kommunikation, wenn beispielsweise davon die Rede ist, dass die Fotografie generell oder bestimmte Fotografien im Speziellen etwas vermitteln sollen. Außerdem kann Fotografie einen Vorgang bezeichnen, wie bestimmte Substanzen bei Lichteinfall reagieren, aber auch die Aktionen beschreiben, die das fotografische Produkt hervorbringen, wie typischerweise die Deklaration von Fotografie als Hobby zu verstehen ist. Zudem kann auch ein gesellschaftliches Phänomen gemeint sein, was in Sätzen wie „die Fotografie ist heutzutage allgegenwärtig und prägt uns“ zum Ausdruck kommt.
Grob gliedern lässt sich hier in „Fotografie als Ergebnis“ oder „Fotografie als Prozess“. Fotografie im Sinne fotografischer Produkte kann für eine Kunstform stehen, aber auch für das Festhalten visueller Aspekte völlig ohne künstlerische Motivation, kann als Beweis genutzt werden und zugleich als solcher stark infrage gestellt werden. Auch den Prozess kann man unterschiedlich definieren, im engeren Sinne wäre die Fotografie dann das Auslösen des Fotoapparats oder die Einschreibung des visuellen Eindrucks auf den Film oder den Chip. Eine sehr weite Definition hingegen betrachtet die praktische Fotografie als eine Art, mit der Welt in Verbindung zu treten, aufgrund derjenige, der Fotografie betreibt, seiner Umgebung selbst ohne Kamera anders begegnet als jemand, der mit der Fotografie gar nichts zu tun hat. Der Prozess kann ferner sowohl Beruf, wie auch Leidenschaft oder Notwendigkeit sein und kann aus der Sicht des Fotografierenden, Fotografierten oder Rezipienten erlebt werden. Trennscharf ist die Gliederung in Ergebnis und Prozess jedoch keineswegs: Jedem Bildergebnis liegt ein Prozess zugrunde, der immer wieder aufgenommen werden kann und in seiner Bedeutung für das Produkt stark variiert.
Trotz dieser Unschärfen kann man einige fotografietypische Aspekte festhalten:
Fotografie zeichnet sich dadurch aus, dass sie sich auf etwas räumlich und zeitlich klar Gerahmtes bezieht. Sie kann immer nur einen abgegrenzten Raum abbilden und greift stets einzelne Momente aus dem Fluss der Zeit. Man benötigt zwar Zeit, um eine Fotografie zu betrachten und zu decodieren, aber ihr fehlt die Erzählzeit (vgl. Pandel 2011: 16): Einzelne Fotografien können nicht direkt eine zeitliche Abfolge vermitteln – auch wenn es natürlich Strategien gibt, das (kulturell geprägte) Vorwissen und die zu erwartenden Emotionen des Betrachters einzubinden und sich damit eben doch Narration entwickeln kann (vgl. Baetens & Bleyen 2010: 165). Was nach einer Begrenzung oder einem Mangel klingt, kann auch ein Vorteil sein: “Perhaps the central reason put forward for the proliferation and dramatic uptake of photography is its ability to transcribe the world in a form that is readily portable from one location to another” (Wright 1999: 6).
Immer wieder wird auch der Bezug der Fotografie zur Realität beschworen und diskutiert. Fotografie erscheint hier wie ein Fenster zur Welt: „Dieser scheinbar unsymbolische, objektive Charakter der technischen Bilder führt den Betrachter dazu, sie nicht als Bilder, sondern als Fenster anzusehen. Er traut ihnen wie seinen eigenen Augen. Und folglich kritisiert er sie auch nicht als Bilder, sondern als Weltanschauungen (sofern er sie überhaupt kritisiert). Seine Kritik ist nicht Analyse ihrer Erzeugung, sondern Weltanalyse“ (Flusser 1983: 13f). Wie Vilém Flusser hier beschreibt, wird der Fotografie aufgrund ihrer Ähnlichkeit zum Abgebildeten, vor allem aber auch aufgrund ihrer technischen Entstehungsweise oft unhinterfragt Objektivität unterstellt nach dem Motto „ich habe es mit eigenen Augen (wenn auch nur auf einem Foto) gesehen“ (vgl. Kuhn 1985: 26). Und in gewisser Weise ist die Fotografie auch objektiver als andere Formen der Bildgebung wie etwas das Malen: Für jeden Bildbereich wird bei der Fotografie gleich viel Zeit verwendet, kein Korn oder Pixel erhält in seiner technischen Entstehung mehr oder weniger Aufmerksamkeit (vgl. Berger 2000: 52). Letztlich sind es in der digitalen Fotografie nur technisch – in diesem Sinne leidenschaftslos – neu angeordnete Bildpunkte.
In diesem Kontext fällt oft der Begriff der Indexikalität: Das Fotografierte hinterlässt eine Spur (vgl. Dörfler 2002: 13) zu sich auf dem Film oder Chip in dem „Moment der natürlichen Einschreibung der Welt auf die lichtempfindliche Fläche“ (Dubois 1998: 54). Und dennoch ist diese Einschreibung und ihr Resultat auch ein höchst subjektives Unterfangen – bezeichnenderweise kann man dies schon anhand des „Objektivs“, das beim Fotografieren eingesetzt wird, verdeutlichen: Das Licht, das durch das Objektiv fällt, wird geformt. Ein Fisheye erschafft einen völlig anderen Eindruck als ein Superzoom-Objektiv, eine offene Blende kreiert einen ganz anderen Look als eine geschlossene. Zahlreiche weitere, bewusst oder unbewusst subjektiv entschiedene Faktoren vom Bildausschnitt über den Weißabgleich, die Belichtungszeit und den Augenblick des Auslösens kommen ins Spiel und das Ergebnis kann man folglich als einen recht subjektiven Eindruck begreifen.
Die Fülle an Informationen, die Fotografien bieten (vgl. Brake 2009: 370) stellt eine weitere Besonderheit dar. Sie führt dazu, dass „ein Bild mehr als 1000 Worte sagt“, aber erschwert es, dieses Bild die intendierten Worte sprechen zu lassen oder sie zu verstehen – die Information ist stark komprimiert, durch die statische Detailtreue sogar komprimierter als in unserer Alltagswahrnehmung. Dem Fotoerfahrenen helfen verschiedene Strategien der Aufmerksamkeitslenkung von der Platzierung, der Fokussierung bis zur Vignettierung den Rezipienten auf die „richtige Fährte zu setzen“ – dennoch muss dies nicht immer gelingen. So gesehen ist eine Fotografie mit einem Gedicht vergleichbar, dessen Rhythmus, Klang und Bedeutung sich nicht jedem in gleicher Weise erschließt.
Das Verhältnis von Sprache beziehungsweise Text zu Bildern trat in der Visuellen Wende auf die allgemeine Agenda, der die Linguistische Wende vorausgegangen war: „Etwa Anfang des 20. Jahrhunderts erlitt die Welt der Wissenschaften eine erkenntnistheoretische Erschütterung, wie sie zuvor nur durch Immanuel Kants rigide Kritik der reinen Vernunft ausgelöst worden war. Plötzlich war nämlich ins allgemeine Bewusstsein gedrungen, dass man, wenn man mit Hilfe der Sprache und innerhalb des Systems der Sprache Phänomene untersucht, niemals Gewissheit darüber haben kann, ob die beobachteten Eigenschaften nun dem beobachteten Gegenstand zukommen, oder aber Effekte dieser Sprache selbst sind“ (Ströhl 2014: 172). Sprache wurde fortan nicht mehr als neutrales Vehikel betrachtet, und nicht einmal mehr als eine nur dem Menschen eigene Verhaltensform (vgl. Jenks 2005: 1) – die Basis für den “linguistic turn”. Mit diesem Begriff meinte Richard Rorty die Hinwendung der Philosophie zur Analyse der Sprache, „die Sprachabhängigkeit jeglicher Erkenntnis“ (Bachmann-Medick 2019). W.J.T. Mitchell nimmt mit dem Begriff “pictorial turn” auf ebendies Bezug und leitet damit die Neuorientierung hin zum Bild (Mitchell 2009). Zeitgleich mit der Wiederkehr der Bilder im allgemeinen Mediengebrauch rückten Bilder und ihre Art, Sinn zu kommunizieren nun auch ins Zentrum grundsätzlicher wissenschaftlicher Fragestellungen – und doch gelang es bisher nicht oder kaum, Möglichkeiten zu finden, um sich weitgehend ohne Sprache und Text über Bilder zu verständigen. Die oben genannte Informationsfülle mag ein Grund hierfür sein.
Ein viel diskutiertes Merkmal, das die Fotografie auszeichnet, ist ihre technische Reproduzierbarkeit. Zwar kann man auch beispielsweise Gemälde exakt abfotografieren und somit vervielfältigen – aber es bleibt immer nur ein echtes Original, während die Fotografie kein Original kennt. Dieser Aspekt wird oft mit dem Fehlen der Aura bei fotografischen Werken in Verbindung gebracht (vgl. Benjamin 1963: 11). Der Fotografie fehlt also die Aura, das Einzigartige „Hier und Jetzt“, was dazu führt, dass sie weniger sakral erscheint als das Gemälde und daher aufklärerisch und politisch wirken kann (vgl. Jäger 2009: 24) und dass ihr Besitz demokratischer geregelt werden kann. Außerdem impliziert dies die Möglichkeit ganz unterschiedlicher Erscheinungsformen je nach Größe und Trägermaterial und weist auch in die Richtung einer prinzipiellen Unabgeschlossenheit: Auch alte Fotos können in neue Bedeutungszusammenhänge gestellt werden, indem man sie etwa neu anordnet, auf andere Trägermaterialien druckt oder neu bearbeitet.
Ein weiterer Aspekt zum Wesen der Fotografie, der für unseren Kontext wichtig ist, liegt in den Wechselwirkungen, die Fotografie, Gesellschaft und Kultur eingehen: Fotografie prägt in besonderem Maße unsere Art, uns ein Bild von der Welt zu machen. Sie legt fest, was normal, schön oder hässlich ist (vgl. Jäger 2009: 14 f.) und suggeriert uns Macht oder Besitz. Allerdings bestimmt auch der kulturelle Kontext, wie die Fotografie wahrgenommen wird: Entsprechend fühlen sich zum Beispiel Menschen vor der Kamera je nach Kultur tendenziell geehrt oder eher gedemütigt.
Für das Folgende bleibt festzuhalten, dass der Begriff „Fotografie“ ein weites Feld bezeichnet und stets trotz der impliziten Statik („Standbild“) Dynamik beinhaltet – Fotografie wird immer wieder unterschiedlich bewertet, ist nie wirklich abgeschlossen, zirkuliert, verändert sich in ihrer Technik und Bedeutung.
Wenn man eine Methode im Sinne von „Medium“ definiert – ein (Ver-)Mittler (vgl. Linthout 2004: 54), der zu einer Erkenntnis oder noch allgemeiner zu einer neuen Situation führen kann – ist es offensichtlich: Fotografie kann auch eine Methode sein, und möglicherweise eine besonders fähige, weil sie für fast jeden zugänglich ist und vielleicht oft nachvollziehbarer als andere Methoden.
In seiner Etymologie auf das altgriechische „μέθοδος = Nachgehen, Verfolgen“ rückführbar meint „Methode“ in seiner Grundbedeutung den Weg, auf dem man sein Ziel verfolgt: „Wenn man sich mit Methoden beschäftigt, steht das ‚wie‘ im Mittelpunkt“ (Galuske 2013: 28).
Allerdings wird der Begriff „,Methode‘ […] ebenso selbstverständlich wie unreflektiert gebraucht. Daraus ergibt sich ein diffuses Bedeutungsfeld“ (Konegen und Sondergeld 1989: 11). Oft erscheint er synonym für eine Technik beziehungsweise ein Instrument, für eine Theorie, Disziplin oder Wissenschaft, oder wird mit Methodologie, der Wissenschaft zu wissenschaftlichen Methoden vermengt. Dennoch können all diese Verwendungen auch ihre Berechtigung haben: Manche Theorien oder Disziplinen etwa definieren sich u.a. auch über ihre Methoden, die Ethnologie beispielsweise über die „Teilnehmende Beobachtung“ als einer Methode, die sie von anderen Disziplinen, die sich mit „Kultur“ beschäftigen, (tendenziell) abhebt. Und wann immer man in einem wissenschaftlichen Kontext seine Methoden erläutert und reflektiert, kommt Methodologie ins Spiel.
Wie es schon anklingt, soll hier einer sehr allgemeinen Definition gefolgt werden: Methode meint in diesem Kontext ein „nach Mittel und Zweck planmäßiges ( = methodisches) Verfahren, das zu […] Fertigkeit bei der Lösung theoretischer und praktischer Aufgaben führt (technische Methoden, Arbeitsmethoden, Werbemethoden, Erziehungsmethoden, Methoden der Wissenschaft)“ (Mittelstraß 1984: 876), oder, noch grundsätzlicher, ist eine Methode „eine bewusst gewählte Verhaltensweise zur Erreichung eines bestimmten Zieles“ (Schilling 1993: 65). Dabei gilt dem heutigen Methodenverständnis zufolge selbstverständlich, dass „wissenschaftliche Methoden […] genauso wenig neutral [sind] wie alle anderen Mittel bzw. Medien“ (Tuschling 2020: 173). Bestimmten Methoden liegen Meinungen, Ideologien oder Theorien zugrunde. Wer zum Beispiel davon ausgeht, dass die gerade erwähnte Teilnehmende Beobachtung eine je nach Situation sinnvolle Herangehensweise darstellt, geht auch davon aus, dass es prinzipiell möglich ist, die Perspektive anderer Menschen zu einem gewissen Maße zu übernehmen, dass Menschen also nicht aufgrund ihrer Kultur so grundverschieden sind, dass eine Perspektivübernahme völlig undenkbar wäre. Außerdem wird auch angenommen, dass es ebenso möglich ist, eine professionelle Distanz wahren zu können. Ganz abgesehen von der Umsetzbarkeit geht man ferner davon aus, dass diese Methode im Sinne des (Erkenntnis-)Ziels zu besseren Ergebnissen führen kann als eine andere – besser im Sinne von vertiefter, zeiteffektiver, repräsentativer, handlungsrelevanter oder vieles mehr.
Auch in den Bereichen, die Fotografie als Methode nutzen, liegt ebendem eine Entscheidung zugrunde: Es gäbe oftmals auch alternative Methoden, die vielleicht auf anderen Überzeugungen, Menschenbildern, Theorien oder allgemeiner, Grundannahmen beruhen.
Außerdem spielen sich die im Folgenden beschriebenen Methoden auf recht unterschiedlichen Ebenen ab: Manche von ihnen sind eher grundsätzliche Überlegungen zur Herangehensweise, andere lassen sich hingegen klar formulieren und in Handlungsanweisungen gießen. Manche von ihnen sind längst etabliert, vielleicht aber neuerlich infrage gestellt, andere reflektieren neue Sichtweisen.
Die Fotografie als ein (Ver-)Mittler und damit im weitesten Sinne als eine Methode – nicht (nur) im wissenschaftlichen, sondern im weiteren Sinne – zu verstehen, impliziert, den Fokus auf einen Prozess zu legen. Dieser Prozess kann, muss aber nicht im Fotografieren selbst liegen, sondern auch im Vorbereiten, Rezipieren, Interpretieren, Verinnerlichen etc. Mit Blick auf „Fotografie als Methode“ ergeben sich also ganz unterschiedliche Blickwinkel.
Vermischt sich hier bisweilen „Gegenstand“ und „Methode“? Tatsächlich, so muss man sagen, sind „Gegenstand“ und „Methode“ in diesem Buch oft nicht ganz trennscharf. Eigentlich müsste man auch verschiedene Arten von Gegenständen berücksichtigen: Fotografie ist zwar selbst ein Gegenstand, der auf verschiedene Weise eingesetzt oder analysiert wird, aber letztlich bezieht sich die Fragestellung oder Zielsetzung oft nicht auf den Gegenstand „Fotografie“, sondern auf andere, sehr vielfältige Aspekte, beispielsweise das Verstehen gesellschaftlicher Zusammenhänge, das Lernen oder das Stärken des Selbstwertgefühls.