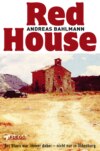Loe raamatut: «Red House»
Andreas Bahlmann
Red House
der Blues war immer dabei
– nicht nur in Oldenburg
FUEGO
– Über dieses Buch –
Red House erzählt in einer Zeit-Reise ohne Chronologie Geschichten der sechziger bis in die achtziger Jahre, die oft in ganz tiefer Verbindung zur Musik und Liebe zum Leben stehen und ganz bestimmt hätten manche dieser subjektiv wahren Geschichten ohne den Blues einen anderen, als den erlebten und erzählten Verlauf genommen ... nicht nur in Oldenburg ...
Meinem Vater

»Es wird gegessen, was auf den Tisch kommt, … das gibt's nicht, zumindest probiert wird es!«
Dabei hatte ich überhaupt keinen Hunger.
In der Schule, – damals hieß es noch Volksschule, in der die Schüler von der ersten bis zur neunten Klasse untergebracht waren –, also, in der Schule hatte mich einer der alten Lehrer, Herr Jünter, ein strammer Altnazi, an den Ohren hochgezogen, bis ich mit den Füßen in der Luft hing. »Bremer Gänse« nannten wir das und es tat wirklich verdammt weh.
Es gab zwei Arten der »Bremer Gänse« – die gute und die böse. Die gute war die schmerzhafte freundschaftliche Spaß-Version, dabei presste jemand deinen Kopf an den Ohren mit den flachen Handinnenflächen, wie in einem Schraubstock, zusammen und hob dich dann mit heiß-bremsenden Ohren und zusammengequetscht entstelltem Gesicht hoch, bis du mit den Füßen in der Luft warst. Eine äußerst anstrengende Herausforderung für alle Beteiligten, die erst mal bewältigt und auch ertragen werden musste.
Die böse war die übelst schmerzhafte, feindliche »Marter«- oder »Rache«-Version, bei der die Finger in die Ohren gekrallt, die Handballen den Kopf fest bis brutal, vorzugsweise am Kiefergelenk, quetschten, um so den richtigen Zug nach oben zu bekommen, wegen der gewünschten Fuß- und Beinfreiheit.
Die gute Version der »Bremer Gänse« beherrschte Herr Jünter natürlich nicht und ich kann mich nicht daran erinnern, dabei geweint zu haben, vermutlich nicht, sonst hätte ich eine andere Erinnerung daran.
Tränen zu zeigen, das war in den Sechzigern einfach nicht angesagt und als Junge heulte man schon gar nicht.
»Ein Indianer kennt keinen Schmerz!«, »Nur Mädchen heulen!«, »Heulsuse!«.
Sprüche wie diese habe ich als Kind so oft zu hören und regelrecht eingebläut bekommen. Wer hat sich so einen Unsinn eigentlich ausgedacht?
Wenn du als Junge geheult hast, dann warst du 'ne »Memme«, ein »Waschlappen« und bei den anderen unten durch. Gepetzt wurde auch nicht. Petzen? Das war ja noch schlimmer als Heulen!
Das taten nur die Mädchen und die Streber und die waren sowieso alle doof! … naja, bis auf Beate und Elke und Regina vielleicht … und Marie-Luise, die war unglaublich stark und unglaublich groß und konnte schnell hinter einem herlaufen … Also, die war auch nicht doof.
Also hielt ich den Mund, ertrug tapfer die Schmerzen meiner heißen Ohren und hing mit den Füßen in der Luft.
Ich war gestoßen worden. Auf dem Schulhof, von einem der Großen. Das waren die Jungs aus der achten und neunten Klasse, die immer auf der Toilette rauchten und uns den Gang versperrten oder, wenn wir uns reintrauten, auf ziemlich üble Art und Weise schikanierten, sodass wir uns oft genug nicht anders zu helfen wussten, als an die Schulhofsmauer zu pinkeln, während die Freunde um uns herum einen Sichtschutzkreis bildeten. Einer meiner Klassenkameraden konnte sogar über die Mauer rüberpinkeln – das war 'n echter Held!
Die männlichen Lehrer wussten, was die »Großen« mit uns machten, wenn wir in der Toilette waren, aber sie sagten in der Regel nichts weiter dazu, ließen sie sich doch gerne von den Großen eine Zigarette ausgeben.
Einer der Großen hatte mich gestoßen und ich fiel in ein Fahrrad, welches umkippte und daraufhin eine Kettenreaktion umstürzender Fahrräder auslöste. Eine Fahrradlawine! Ein großer, restlos ineinander verhakter Haufen von Fahrrädern … und ich war schuld!
So sah es jedenfalls Herr Jünter, der stramme, alte Lehrer.
»Gottfried! Aufheben! Du hebst sofort die Fahrräder wieder auf!« – »Aber, ich konnte doch gar nichts dafür! Ich bin geschubst worden!« – »So? Von wem denn? Wer soll es denn gewesen sein?«
Da war sie wieder: die für einen Jungen der Sechziger wirklich fiese Situation … Petzen war wirklich ein Tabu und abgesehen davon hatten die Großen nach der Schule immer mehr Zeit als wir und der Große hätte mich dann auf dem Nachhauseweg nach Schulschluss abgepasst.
Das passierte damals öfters, auch ohne besonderen Anlass, deswegen hatten wir ja auch unsere Jungsbande. Wir gingen gemeinsam zur Schule und gingen gemeinsam nach Hause. In der Gruppe waren wir sicherer. Nur diejenigen, die nachsitzen mussten, gingen dann alleine und oft auch ängstlich, auf Umwegen nach Hause.
Wegen der Großen, aber auch wegen der Strafe, die einen zusätzlich noch zu Hause wegen des Nachsitzens erwartete.
»… also? Wer hat dich geschubst, Gottfried? Ihr wisst doch ganz genau, dass Ihr hinter der Linie nichts verloren habt, also heb jetzt die Räder wieder auf, die du umgeschmissen hast!« – »Nein! Das mach ich nicht, ich war's nicht!« – »Oh doch, Gottfried, das wirst du tun …, und zwar sofort!«
Ich spürte diese gnadenlos greifenden, krallenden Finger seiner alten, harten Hände.
Ich hasste Herrn Jünter mit seiner streng gescheitelten Haarfett-Pottschnittfrisur.
Ich hatte keine Chance und die Großen schauten mir grinsend und hämische Kommentare ätzend zu, als ich schließlich mit roten, schmerzenden Ohren die Fahrräder entknotete und aufstellte.
Das war die eine Seite des Alltags, aber dann gab es da auch noch eine andere Welt, die sich mir nach und nach auftat, eine nahezu vollkommene, neue Seite des Lebens:
Ich erhielt wunderbare Antworten, die ich nicht formulieren konnte, auf Fragen, die ich nicht auszudrücken wußte und bis heute nicht kann.
Dieses neue Leben hieß ab Ende der Sechziger – The Rolling Stones, Led Zeppelin, Chuck Berry, Elvis Presley, Deep Purple, the Guess Who, Creedence Clearwater Revival, Mungo Jerry, The Move, Black Sabbath, Canned Heat und …
Jimi Hendrix!
Es gab da dieses eine, unglaubliche Gitarren-Intro, welches von einem Moment auf den anderen für mich wirklich alles auf den Kopf stellte. Dieses Intro veränderte zu Beginn meines neunten Lebensjahres meine gesamte musikalische Wahrnehmung – nachhaltig bis heute. Das Stück hieß »Red House«. Jimi Hendrix hatte es 1966 geschrieben, … als ich essen musste, was auf den Tisch kommt.
Es war meine erste, wirklich beinahe schon körperliche Erfahrung von Musik, noch nie zuvor in meinem damals so jungen Leben hatte ich so etwas Unglaubliches und Großartiges gehört oder erlebt. Dieses Gefühl dieses damaligen, geradezu magischen Erlebnisses verließ mich nie wieder, wurde zu meinem treuen Lebensbegleiter, trotz aller Irrungen und Wirrungen, die der Lauf des Lebens für mich noch so mit sich bringen sollte. Jimi machte mit »Red House« die Tür, meine Tür zur Musik, zum Leben, zum Blues auf.
Die Beatles waren ja auch nicht schlecht, aber das war damals für mich eher so »Mädchen-Mucke« und Mädchen waren ja ziemlich doof, – bis auf Beate, Elke, Regina und die immer noch sehr starke Marie-Luise …, naja, »Kuschi« kam jetzt auch noch dazu.
Wie genial die Beatles waren, sah, hörte und begriff ich erst viel später, aber es ist dennoch bis heute so, wirklich berührt oder ergriffen werde ich nur vom Blues oder Musik, deren Ursprung oder Ausdruck mit dem Blues verwurzelt ist.
Mein vier Jahre älterer Cousin spielte diese Musik auf seinem Mono-Plattenspieler ab und er erlaubte mir, zuzuhören und mich haute es buchstäblich jedes Mal wieder um!
Auf einmal nahm ich vieles anders, so richtig anders wahr, und ich nutzte nahezu jede sich mir bietende Gelegenheit, diese Musik zu hören.
Mein Cousin legte später sogar noch nach.
Und wieder sollte es ein schneidendes Gitarren-Intro sein, ein Eingangs-Riff zu einem Song, welches mir den Atem verschlug.
Es war »up arround the bend« von Creedence Clearwater Revival, 1970 komponiert von John Fogerty. »Up arround the bend« stieß meine durch »Red House« geöffnete Bluestür ganz weit auf und es war, als ob mich ein ganzer Schwall dieser großartigen Musik durchflutete. Klar klopften immer mal wieder musikalische »Irrgänger« oder »Verfolger« an meine Herzens-Tür an, aber dann schloss ich energisch meine Blues-Tür oder warf diese Fehlgänger wieder raus.
Für mich sollte es kein »musikalisches Zurück« mehr geben, ich wollte und konnte es auch gar nicht mehr. Ich geriet in musikalische Sicherheit, in so eine Art Lebens-Sicherheit, was ich allerdings erst viel, viel später richtig begreifen und auch wertschätzen sollte.
Jimi Hendrix war für mich überwiegend ein Meister der Intros, er leitete seine Songs oft genial ein, nicht nur »Red House« oder »Hey Joe«. Seine Gitarren-Soli sind einzigartig und ich verehre sein charismatisches Spiel, andererseits aber waren mir viele seiner Stücke insgesamt zu psychedelisch, zu kompliziert.
Das meiner Meinung nach eines der komplettesten Stücke hat Jimi kurz vor seinem Tod auf einer akustischen, zwölf-saitigen Gitarre eingespielt:
»Hear my train coming« – für mich eines der schönsten Blues-Stücke überhaupt. Jimi spielt bei dieser Aufnahme auf einem Hocker sitzend so intensiv, als ob er seinen Frieden gefunden hat, so, als ob er nach langer musikalischer Suche wieder da angekommen war, wo er angefangen hatte – beim Blues.
Irgendwie führt einen das Leben musikalisch immer wieder zum Ursprung zurück, dorthin, wo das Herz zum ersten Mal die Leidenschaft fühlen durfte.
»Up arround the bend« ging nicht so tief in mich hinein wie der Blues, wie »Red House«, das war auch gar nicht möglich. Es war eigentlich vielmehr der Auslöser eines ganz tiefen Bedürfnisses nach Bewegung und erweckte eine neue Neugier in mir.
Diese Neugier war eine ganz andere Art der Neugier, die ich bisher kannte. Es war Sehnsucht und Fernweh, die Neugier auf Weite und Wege in den Horizont hinein und darüber hinweg …
»Up arround the bend« eröffnet bezeichnenderweise auch mit einem genialen Gitarren-Intro von John Fogerty, es klingt beinahe wie eine Sirene.
Erlag nicht auch Odysseus auf seinen Reisen beinahe dem Lockruf der Sirenen?
Nur das Angebundensein an den Schiffsmast und die verstopften Ohren seiner treuen Begleiter schützten ihn. Als ich John Fogerty's Gitarren-Sirene hörte, war ich weder angebunden, noch waren meine Ohren gegen die Verdammnis verstopft – alles konnte ungefiltert in mein Herz eindringen und ich erlag dem Lockruf des Country-Blues. Eine Reise ohne Wiederkehr, eine Einbahnstraße ohne jede Reue.
Auf John Fogerty's schneidendes Gitarren-Intro folgt der hämmernde, raue Einsatz der Band und trägt John Fogerty's leidenschaftlichen, hellstimmig – kratzigen Gesang. Dieses Stück sprüht vor Lebensgier und treibt nur nach vorne, voll unablässiger und hämmernder Leidenschaft. Es hüpft, man könnte einfach laufen, die Arme schlenkern ausgelassen und kraftvoll ausladend beim Gehen mit, man grinst, atmet frei und tief durch, freut sich des Lebens und ist gespannt, was hinter der Biegung und den nächsten Biegungen noch so kommen mag. »Up arround the bend« hat kein Ende, es geht weiter und weiter und wird ausgeblendet, mit einem »dub dub duda« auf den lachenden Lippen der Wanderschaft.
Selbst wenn man stehenbleibt, zurückbleibt, läuft die Melodie weiter und sie verschwindet in der Ferne, hinter dem Hügel, -up arround the bend.
Ist man selbst der Wandernde, der Reisende, begleitet einen die Melodie, sie trägt, man entdeckt weiter und ist gespannt auf die nächste Biegung. Gehe ich heute mit meinem Hund in der Natur oder am Deich entlang, so will ich immer wissen, was sich hinter der nächsten Biegung verbirgt und es geht immer weiter …
Besser kann Swamp-Rock oder Country-Blues eigentlich gar nicht gespielt werden. Die Straße trägt einen immer weiter und weiter und die Schritte sind leicht, fröhlich-neugierig, angstfrei und beschwingt.
Der Schlagzeuger von CCR spielt einfach und schnörkellos, aber unglaublich effektiv und ruppig gut. Der Bassist erledigt druckvoll pumpend den Rest und man erlebt die Fröhlichkeit der Straße, das Springen aus purer Freude, das befreite Durchatmen. Kaum ein anderes Stück transportiert die Fröhlichkeit der Straße, die unbestimmte, zielstrebige Neugier aufs Ungewisse so treffend wie »up arround the bend« von Creedence Clearwater Revival mit ihrem genialen Songwriter John Fogerty.
Jedes Mal, wenn ich »up arround the bend« hörte, wuchs die Sehnsucht nach der Ferne und der Weite und der Straße immer ein Stückchen mehr in mir an. Ganz besonders blieb in mir eine Textzeile haften:
»… always time for a good conversation …«, – immer Zeit für eine gute Unterhaltung – offener, freundlicher und auch interessierter kann man dem Leben doch eigentlich gar nicht begegnen.
Country und Blues sind zwei ganz starke Lebens- und Atemspender, die sich geradezu ideal und kraftvoll ergänzen.
John Fogerty verstand es, mit seiner Band »Creedence Clearwater Revival«, ebenso unbekümmert wie grandios intensiv, Folk, Country, Rockabilly und Blues zu vermischen. Seine Kompositionen für CCR basierten auf wenigen Akkorden und seine Songs klangen und klingen einfach, mit teilweise brillanten Melodien, ohne einfach zu sein und man hatte immer das Gefühl, die Musik bereits zu kennen, auch wenn sie brandneu waren. Sie haben so viel Blues, Liebe und Wärme in sich und sie sind absolut zeitlos. Auch durch ihre Lieder lernte ich für später für mich den mühelosen, musikalischen Spagat zwischen den verschiedenen Stilen, ohne mein Herz und meine Seele zu verleugnen. Es lag aber auch stark an der Art und Weise, wie Creedence Clearwater Revival auftraten: einfach, unspektakulär, freundlich und bescheiden, keine aufgestylte Rock'n'Roller-Attitüde oder exaltiertes Rockstar-Gehabe, keine aufwendige Garderobe. Sie liefen rum wie die meisten von uns: Jeans, T-Shirt, Flanellhemd.
Ich durfte zwar noch keine Jeans tragen, aber T-Shirts und karierte Flanellhemden schon. Creedence Clearwater Revival präsentierte sich wie eine Band, deren Zuhause die Straße war. Sie wollten einfach nur spielen, sie tourten unablässig, das war ihnen wohl wirklich wichtig und genau das hört man aus Fogerty's Gesang und Stücken heraus. So eine Musik entsteht nicht mal eben so, das wird von ganz viel Tiefe getragen. Sie lebten so, wie es die Bluesmen früher vor ihnen auch taten, sie waren immer auf musikalischer Wanderschaft und spielten sich die Seele aus dem Leib, mit Lippen voller Glück.
»Long as I can see the light« – auf dem Cosmo's Factory – Album von CCR besiegelte dann meinen endgültigen Liebes-Verfall …
»Long as I can see the light« ist mit eine der schönsten und intensivsten Blues-Balladen, die ich jemals gehört und erlebt habe.
War es bei »Red House« der einschneidende Klang des Gitarren-Intros, der meine Lebenstür aufriss, so war und ist es hier die einmalige Inbrunst dieser einzigartigen Country-Gospel-Blues-Perle. Fogerty gibt gesanglich einfach alles und da spricht etwas durch ihn, die Band spielt unglaublich und ist umgeben von einem ganz tiefen, zärtlichen und gleichzeitig rauen Spirit. Da sind wirklich alle Blues-Geister dabei gewesen, man hört und spürt diesen einzigartig großen, einmaligen Moment, der dieses Stück trägt.
Ich hörte nach meinem musikalischen »Red House«-Erwachen sehr viel Musik von Creedence Clearwater Revival, beinahe schon zwangsläufig, denn sie brachten in zwei Jahren fünf(!) Alben heraus und glücklicherweise waren viele Hits dabei, die dann auch im Radio gespielt wurden, wenn ich mal die Möglichkeit hatte, Radio zu hören. Das war wirklich klasse.
Ein Radio besaß ich noch nicht und das bei uns zu Hause in der Küche lief eigentlich nie, weil es meinen Vater nervös machte. Wenn dann doch gerade zufällig, in einem dieser seltenen Radiomomente, zu Hause ein gutes Lied gespielt wurde, hatte es kaum eine Chance, bis zum Ende durchlaufen zu können. Gestoppt durch den elterlichen Druck auf den »Ausknopf«.
So kam es also oft vor, dass ich zu Hause mit meinen Brüdern oder Kindern aus der Nachbarschaft zusammen »Lok 1414« hörte und später am Tag bei meinem Cousin »Iron Man« von Black Sabbath …
Der Musikgeschmack meiner Eltern war in meinen Ohren eigentlich keiner. Sie hatten ein paar Schallplatten wie: »Ännchen von Tharau bittet zum Tanz«, »Schlager-Hits für Millionen« oder Alben von James Last, mit Musik ohne Breaks und »La La La«- Gesang und lauter so seichtsinniges Zeug! Diese Platten wurden zum Glück nur bei Feiern und Parties aufgelegt, ansonsten hörten sie im Alltag kaum Musik.
Um eines klarzustellen: James Last war ein absoluter Vollblutmusiker und er trug ein ganz tiefes Grinsen mit und in sich durch sein erfülltes Leben, aber ich konnte und kann seine Musik einfach nicht lange aushalten..
Es ist ein bisschen wie im Western: Zwei Revolverhelden stehen sich gegenüber. Sie fixieren sich gegenseitig mit grimmigen Mienen und es kommt dabei zu diesen großartigen Sätzen wie: »Diese Stadt ist zu klein für uns beide …« -
Mit festem Blick, auf einem Zahnstocher kauend, fixiere ich James Last und presse gefährlich zischend zwischen meinen Zähnen hervor:
»Mein Zimmer ist zu klein für deine Musik und mich …«
Ich glaube, James und ich hätten uns gut verstanden.

Ich musste also für meine eigene Musik sorgen. Von meinem Taschengeld und dem Geld, dass ich mir durch's wöchentliche Kohleschleppen und Einkaufen für die alte Frau Fogler verdiente, kaufte ich mir eine Tonbandspule, die für etwa eineinhalb bis zwei Stunden Musik Platz bot.
Die alte Frau Fogler war Kriegswitwe und lebte alleine in der Innenstadt, im dritten Stockwerk. Sie freute sich, wenn ich jede Woche kam, um ihr Kohle für die Ofenheizung aus dem Keller nach oben zu schleppen. Sie gab mir dafür jedes Mal fünfzig Pfennig. Manchmal drückte sie mir einen kleinen Einkaufszettel in die Hand, und wenn ich dann mit den Einkäufen zurückkam, schenkte sie mir entweder eine Tafel Schokolade oder ich durfte das restliche Wechselgeld für mich behalten, was, wie es der Zufall so wollte, weitere fünfzig Pfennig waren, und zwar immer genau fünfzig Pfennig. Zu Weihnachten brachte ich ihr einen Blumenstrauß oder Kekse, worüber sie sich sehr freute. Sie war alleine und umarmte mich mit einem dicken, schmatzigen Kuss auf die Backe.
Ihr Damenbart kratzte, aber da sie mir nur zu Weihnachten oder Ostern einen Kuss gab, war das auszuhalten.
Einmal schenkte sie mir sogar eine Schallplatte.
Und es war: Heintje! Nicht nur die Single, sondern gleich eine ganze Heintje-LP!
Ich wußte bis dahin gar nicht, dass er noch mehr Lieder sang als »Mama« …
Über Geschenke freut man sich, so lautete unsere Erziehung.
Also freute ich mich auch, stellte dann zu Hause die Schallplatte zur elterlichen Partymusik ins Regal und begann mit dem Zusammenstellen und Aufnehmen meiner Musik, … ohne Heintje.
Mein Vater besaß ein Mono-Tonbandgerät und mit diesem Gerät nahm ich bei jeder sich bietenden Gelegenheit Sendungen bzw. Stücke mit dem Mikrofon aus dem Radio auf. Diese kleine Tonbandspule wurde ab der fünften oder sechsten Klasse zum wichtigen Bestandteil unserer Klassenfeten auf dem Gymnasium.
Um die Tonband-Aufnahmen zu bekommen, musste ich mit dem Mikrofon vor dem Plattenspieler oder Radio immer ganz still verharren, während das so sehnlichst gewünschte und endlich mal gebrachte Lied gespielt wurde. Jedes Geräusch hätte die Aufnahme gestört oder verdorben und unbrauchbar gemacht.
In der Folge gab es da oft genug diese Momente des selig in einem aufsteigenden Erfolgs-Glücksgefühls, dass das Lied endlich fast komplett auf Band war und dann sang ausgerechnet der Radio-Moderator den Schluss-Refrain mit!
Das reflexartige Reagieren des auf »Aufnahme – Drückens«, das starre Verharren während der Aufnahme, das nahezu vollständige Unterdrücken jeder Atemtätigkeit bis kurz vor'm Erstickungstod, die langsam aufkeimende Spannung des sich abzeichnenden Aufnahme-Erfolgs, wurde durchs ebenso dämliche wie überflüssige Mitsingen schlagartig zunichtegemacht!
… und dann sangen sie dazu meistens auch noch falsch …
Oder: die Aufnahme war nahezu perfekt, der Moderator hielt dieses Mal still, es fehlten nur noch wenige Sekunden, als energisch die Zimmertür mit einem mütterlichen:
»Was machst du hier eigentlich die ganze Zeit?« aufgerissen wurde.
Aber schließlich bekam ich mein Klassenfeten-Tonband nach etlichen, manchmal heimlichen, oft auch vergeblichen Aufnahmeversuchen und unzähligen Millionen Stunden dann doch noch fertig.
Ich war so stolz darauf!
Dieses Band habe ich heute noch, nur leider funktioniert dieses alte Grundig-Mono Tonbandgerät meines Vaters nicht mehr. Der Star auf dem Tonband war für mich »Whole Lotta Love«, wegen der Länge und dieser experimentellen musikalischen Rauheit, die eine geradezu eiserne Aufnahmedisziplin vor'm Radio und auch ausgeklügelte Versteckstrategie als Schutz vor elterlichen Störfeuern erforderte.
Später gab's dann »Refried Boogie« von Canned Heat und ich fand es einfach gnadenlos und unglaublich! Die spielten über sagenhafte fünfundvierzig (!) Minuten über dieses einzige Riff und es war ein fantastisches, hypnotisches Stück, aber unglaublich anstrengend beim Tanzen auf Klassenfeten, sodass wir da die Siebeneinhalb-Minuten-Version mit fade out als Aufnahme bevorzugten, um dem Sekundentod wegen Erschöpfung auf der Tanzfläche vorzubeugen.
Canned Heat's lange Version vom »Refried Boogie« erlebte ich dann später in den Achtzigern sogar live – es war atemberaubend, umwerfend, großartig und unvergesslich! Dieses ewige, auf einem einzigen monotonen Riff Herumreiten, ohne dass es langweilig wird, beherrschen nur relativ wenige Bands oder Musiker – wie Canned Heat, Bo Diddley, George Thorogood oder eben der großartige, unnachahmliche John Lee Hooker, der sie alle entscheidend beeinflusst hat.
Ein besonders auffälliges Merkmal an John Lee Hooker ist auch, dass viele Aufnahmen mit ihm in verschiedenen, teilweise berühmten Bands existieren und er unüberhörbar und überall seinen typischen Hooker-Sound reinbrachte. Sie klangen und klingen alle nach John Lee Hooker, alle schienen sich automatisch nach ihm gerichtet zu haben – einfach einzigartig und unnachahmlich!
Bo Diddley, seine riesige Hornbrille und seinen, mit großen und glitzernden Hermes-Flügeln verzierten, dunklen Cowboy-Hut tragend, reitet gnadenlos und solange auf einem Gitarren-Riff, gespielt auf seiner Zigarrenkisten-ähnlichen Gitarre, herum, bis wirklich alle, ausnahmslos alle mitwippen und mittanzen, um dann zu seinen unnachahmlich-schrägen, geschrammelt - dilettantisch anmutenden Gitarren-Soli anzusetzen. Einfach grandios!
George Thorogood & the Destroyers stellen auf ihren Alben eigentlich immer vom ersten Akkord an klar, wo es lang geht: schnörkellos, nur nach vorne treibend, einfach obergeiler Blues-Boogie-Rock'n'Roll. Grandios: die 8:26 Minuten Version von John Lee Hookers »one Bourbon, one Scotch, one Beer«. Der Party-Knaller für ekstatisch getanzte Blues-Hingabe, die keine Fragen mehr offenließ – musikalisch war alles gesagt …vergiss die Mädchen, es gab manchmal einfach Wichtigeres zu erledigen und zu tun! Zumindest acht Minuten und sechsundzwanzig Sekunden lang.
Ich möchte hier auch gar nicht weiter hinterfragen, wie viele Liebes-Anbahnungen durch diese acht Minuten und sechsundzwanzig Sekunden ihr jähes Ende gefunden haben.
Preschte man doch oft genug bei den ersten Klängen dieses magischen Gitarren-Riffs, das (Flirt-) Gespräch mitten im Satz oder sogar im Wort jäh unterbrochen, ansatzlos und reflexartig auf die Tanzfläche.
»La Grange« von ZZ TOP funktionierte übrigens ganz ähnlich, dauerte aber nicht so lang, sodass sich danach noch meist was bei der Liebsten retten oder das Gespräch fortführen ließ, wenn man verschwitzt, fast wunschlos glücklich vom Tanzflächen-Blitzeinsatz wieder zurückkehrte.
Mit dreizehn Jahren sah ich dann endlich meine erste Blues Band live und ich werde nie vergessen, wie ich mit offenem Mund und Ohren und Herzen diese Musik in mich aufsog.
Der Blues mit seinem einzigartigen Facettenreichtum, der gleichzeitig ebenso dilettantisch wie genial in seinem Vortrag sein kann und darf, manchmal sogar muss, stellt für mich alles in den Schatten und es sind immer wieder diese musikalischen Blues-Interpretationen, die mich bis heute buchstäblich umwerfen und mit »Haut und Haaren« ergreifen können.
Diese gierige Lebens-Ur-Kraft besitzt für mich keine andere Musik. Selbst die kitschigsten Melodien und Liedchen lassen sich mühelos im Blues einbetten und bekommen dadurch eine musikalische Qualität, die einem regelrecht das Grinsen ins Gesicht, ins Herz und in die Seele zwingen.
Sogar die oft schräg erscheinende oder klingende Zirkusmusik hat eine unüberhörbare Nähe zum Blues. Polka- und Shuffle-Rhythmen sind musikalisch seelenverwandt, sie werden unterschiedlich phrasiert, transportieren aber klaglos jede noch so schräge Musik oder Melodie und geben ihr Leichtigkeit und Grinsen.
Klar, es gibt und gab immer supergute, oft geniale Musik und Songs aller Stilrichtungen, die mich beglückt haben und auch noch beglücken und die ich nicht missen möchte, aber dennoch kommt irgendwie nichts an den Blues ran. …Warum das so ist? … fragt den Teufel, wenn Ihr ihm bei Neumond an einer einsamen Kreuzung begegnet!