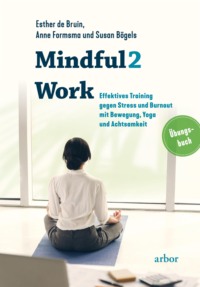Loe raamatut: «Mindful2Work - Das Übungsbuch»
Zu diesem Buch gehören Meditationen, die Sie auf www.arbor-online-center.de/deBruin_Mindful2Work herunterladen können. Sie können das Material gerne für Ihre eigene Praxis nutzen, es an Freundinnen und Freunde verschenken oder auch für die Arbeit mit Ihren Klientinnen und Klienten, Kolleginnen und Kollegen einsetzen. Eine weitergehende gewerbliche Nutzung und auch die Bereitstellung im Internet indes gestatten wir nicht. Wir bitten Sie, allzeit auf die Quelle des Materials zurückzuverweisen – also anzugeben, dass das Material von www.arbor-verlag.de stammt.

Die Originalausgabe erschien 2018 unter dem Titel:
Mindful2Work. Doeltreffende anti-stress-training met mindfulness, yoga en actief bewegen.
Werkboek bei Lannoo Campus, Houten, Niederlande.
© 2019 der deutschen Ausgabe: Arbor Verlag GmbH, Freiburg
© 2018 der Originalausgabe: Uitgeverij Lannoo NV, Tielt
Lektorat: Usha Swamy
Titelfoto: © DragonImages/istockphoto.com
Fotos Anhang: Anne Formsma und Sanne van Berge
Hergestellt von mediengenossen.de
E-Book-Herstellung und Auslieferung: Brockhaus Commission, Kornwestheim, www.brocom.de
Alle Rechte vorbehalten
E-Book 2020
ISBN E-Book: 978-3-86781-288-7
Inhalt
VORWORT
BEWUSSTE AKTIVE BEWEGUNG, YOGA UND ACHTSAMKEIT
WOCHE 1 Vom Autopiloten zur Achtsamkeit
WOCHE 2 Den Körper wahrnehmen
WOCHE 3 Der Atem
WOCHE 4 Stress
WOCHE 5 Mit schwierigen Situationen umgehen
WOCHE 6 Für sich selbst sorgen
ABSCHLUSSTREFFEN Auf eigenen Beinen stehen
LITERATUR
RESSOURCEN
ÜBER DIE AUTORINNEN
ANHANG Die Mindful2Work-Bewegungsübungen
Die Mindful2Work-Yogaübungen
Wichtiger Hinweis
Die Ratschläge und Übungen in diesem Buch sind von den Autorinnen sowie dem Verlag sorgfältig geprüft worden. Dennoch kann eine Garantie nicht übernommen werden. Bei Beschwerden sollten Sie auf jeden Fall eine Ärztin, Psychotherapeutin, Psychologin oder Heilpraktikerin Ihres Vertrauens zu Rate ziehen. Eine Haftung der Autorinnen oder des Verlages für Personen-, Sach- und Vermögensschäden ist ausgeschlossen.
Vorwort
Alle sprechen im Augenblick über Achtsamkeit. Es gibt also ganz offensichtlich ein Bedürfnis danach. Das hat natürlich etwas mit unserer hektischen Lebensweise zu tun, die wohl für die meisten von uns kaum achtsame Momente bereithält. Mit der Achtsamkeit ist es wahrscheinlich ein wenig so wie mit »Bewegung auf Rezept« – auch so ein moderner Hype. Selbst wenn man sie nicht wirklich mag, sollte man sie praktizieren, weil ein stressiges und oberflächliches Leben nicht förderlich für das psychische Wohlbefinden ist, ebenso wie zu wenig Bewegung. Auch Yoga ist so ein Hype. Yoga-Studios schießen wie Pilze aus dem Boden und scheinen die Fitnessstudios als Antwort auf das stressige westliche Leben an Beliebtheit sogar noch zu übertreffen. Wenn Sie also tatsächlich wissen wollen, was es mit Achtsamkeit auf sich hat, mit aktiver Bewegung, Yoga und besonders mit einer durchdachten Kombination dieser drei Elemente, dann lesen Sie dieses Buch. Es wird Ihnen zu mehr Klarheit auf diesem Gebiet verhelfen.
BRAM BAKKER, Psychiater und Publizist
März 2018
Bewusste aktive Bewegung, Yoga und Achtsamkeit
WAS SIE DARÜBER WISSEN SOLLTEN

»Die beste Möglichkeit Momente einzufangen, ist aufmerksam zu bleiben. So kultivieren wir unsere Achtsamkeit. Achtsamkeit bedeutet wach zu bleiben. Es bedeutet zu wissen, was du gerade machst.«
JON KABAT-ZINN

Bewusste aktive Bewegung
Sport oder bewusste aktive Bewegung ist eine körperliche Aktivität, bei der über die physische Bewegung Kraft, Schnelligkeit und Geschicklichkeit sowohl des Körpers als auch des Denkvermögens trainiert werden. Jeder weiß, dass uns körperliche Bewegung guttut, vor allem um körperliche Gesundheit zu erlangen und aufrechtzuerhalten. Sport liefert uns Energie, hält uns fit und verringert das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes, stärkt Muskeln und Knochen und reguliert unser Gewicht (Center for Disease Control, 2015).
Die Vorteile von körperlicher Bewegung
Sport ist eine gute Möglichkeit, zu entspannen, und sorgt für bessere Laune.
Körperliche Bewegung hat neben diesem gesundheitlichen Aspekt noch weitere Vorteile. Sport kann das psychische Wohlbefinden steigern und Stress vermindern. Eine halbe Stunde Fitnesstraining, ein flotter Spaziergang oder ähnliche aktive Bewegung können für bessere Laune sorgen oder für angenehme Entspannung nach einem stressigen Tag. Verschiedene Untersuchungen haben gezeigt, dass Endorphin – auch bekannt als das Glückshormon – ausgeschüttet wird, wenn man sich bewegt (Chu, Koh, Moy, Müller Riemenschneider, 2014; Stathopoulous, Powers, Berry, Smits, Otto, 2006). Dank des Endorphins sind Menschen, die Sport treiben, glücklicher und entspannter. Sport liefert Energie und reduziert Stress, scheint aber auch wirksam zu sein, wenn es darum geht, Angst und Depressionen zu verringern (Conn, 2010a; Conn, 2010b; Cooney, Dwan, Greig, Lawlor, Rimer, Waugh u. a., 2013; Josefsson, Lindwall, Archer, 2014; Stonerock, Hoffman, Smith, Blumenthal, 2015; Webster, 2015). Die positiven Effekte von körperlicher Betätigung lassen sich vor allem im Zusammenhang mit Symptomen von Depressivität gut belegen. Das lässt sich auch daran ablesen, dass aktive Bewegung inzwischen als ein Bestandteil bei der Behandlung von Depressionen in die Richtlinien des National Institute for Health and Care Excellence (NICE, 2009) aufgenommen wurde. Seit 2010 ist körperliche Betätigung/Aktivität bzw. eine Lauf-Therapie für Patienten mit einer leichten Depression, die nicht länger als drei Monate besteht, auch Bestandteil der multidisziplinären Richtlinien »Depression« des Trimbos-Instituts (Spijker, Bockting, Meeuwissen, Van Vliet, Emmelkamp, Hermens u. a., 2013).
Der Erschöpfung vorbeugen
Nur Sie selbst können Ihren Körper wirklich spüren.
Intensive physische Aktivität kann jedoch auch zu Erschöpfung führen. Wenn wir Sport treiben, werden auch Hormone wie Adrenalin und Dopamin ausgeschüttet, die Stress verursachen können. Wenn wir also schon extrem gestresst und müde sind, gibt uns Erholung oder Bewegung mit niedriger Intensität oft mehr Energie zurück als intensiver Sport. Wir sollten bei körperlichen Aktivitäten wie Laufen, Fahrrad fahren oder Fitnesstraining also darauf achten, dass das Tempo auf uns zugeschnitten ist. Wenn wir unter großem Stress stehen und/oder sehr müde sind, ist es wichtig, dass Geschwindigkeit und Intensität zu Anfang etwas unter unserem Niveau liegen. So verhindern wir, dass wir über unsere Grenzen gehen und uns noch größerem Stress aussetzen, sodass sich die Erschöpfung noch verstärkt oder wir unseren Körper sogar überbelasten. Denn das kostet wiederum Energie und die Erschöpfung nimmt eher weiter zu. Wenn Sie herausfinden möchten, welches Tempo für Sie angemessen ist, ist es unerlässlich, den eigenen Körper gut wahrzunehmen. Daher üben wir während des Mindful2Work-Trainings, uns bewusst aktiv zu bewegen. Die Übungen sind sportbetont, werden jedoch in einem ruhigen Tempo ausgeführt, sodass Sie Körper und Atmung dabei bewusst wahrnehmen können. Nur Sie selbst können Ihren Körper wirklich spüren, und genau darum geht es, wenn Sie sich sportlich betätigen oder sich aktiv bewegen. Wir raten Ihnen daher auch, Sport oder aktive Bewegung zufrieden und vitalisiert zu beenden und nicht völlig erschöpft.
Yoga
Yoga hilft uns, Körper und Geist ins Gleichgewicht zu bringen.
Das Wort Yoga stammt aus dem Sanskrit und bedeutet »Einheit« oder »Vereinigung«. Yoga hat eine jahrtausendealte Tradition, deren Wurzeln in Indien liegen. Damals diente Yoga der Vertiefung der Meditation, und auch heute noch kann man dies als das eigentliche Wesen von Yoga betrachten. Yoga ist eine Form der körperlichen Betätigung, bei der die Übungen und Atemtechniken in Achtsamkeit ausgeführt werden. Yoga führt so unter anderem zu einer Verlangsamung des Herzschlags und Senkung des Blutdrucks, dient der Mobilisierung des Körpers, verringert das Stressniveau und die Muskelspannung und aktiviert das Immunsystem (Cramer, Lauche, Haller, Steckhan, Michalsen, Dobos, 2014; Wolever, Bobinet, McCabe, Mackenzie, Fekete, Kusnick u. a., 2012). Yoga hilft bei (arbeitsbezogenen) Stresssymptomen wie Schulter- und Nackenschmerzen, dem CANS-Syndrom (Complaints of Arm, Neck and/or Shoulder), dem RSI-Syndrom (Repetitive-Strain-Injury-Syndrom) sowie bei Kopf- und Rückenschmerzen (Cramer, Lauche, Haller, Dobos, 2013; Li, Goldsmith, 2012). Yoga lehrt uns, Körper und Geist ins Gleichgewicht zu bringen. Es wird auch oft als Medizin für Körper und Geist bezeichnet und häufig als nicht-medikamentöse Therapie für einen besseren Umgang mit Stress empfohlen, da die Übungen die körperlichen Auswirkungen von Stress auf den Körper reduzieren.
Stressreduzierung
Unter Stress wird Cortisol – das Stresshormon – ausgeschüttet. Verschiedene Untersuchungen haben gezeigt, dass Yoga unterstützend bei der Regulierung des Cortisolspiegels wirkt (Granath, Ingvarsson, Von Thiele, Lundberg, 2006). Neben der Stressreduzierung kann regelmäßiges Yoga auch die eigene Achtsamkeit fördern (Gard, Brach, Hölzel, Noggle, Coboy, Lazar, 2012). Durch die meditative Ausrichtung wird die Aufmerksamkeit geschult, sodass man lernt, im gegenwärtigen Moment anwesend zu sein. Der Geist kommt zur Ruhe und das Körperbewusstsein verstärkt sich.
Achtsamkeit
Achtsamkeit hat ihren Ursprung im Buddhismus, ist vor ungefähr 2500 Jahren in Indien entstanden und bezeichnet eine Qualität der Vipassana-Meditation. Vipassana bedeutet so viel wie »klar sehen«. Achtsamkeit zielt darauf ab, die Wirklichkeit um uns herum wahrzunehmen, so wie sie ist, ohne durch eine emotional, gesellschaftlich und/oder religiös getrübte Brille zu blicken. Achtsamkeit definiert sich als das Bewusstsein, das entsteht, wenn wir auf eine bestimmte Weise aufmerksam sind: gezielt, im gegenwärtigen Moment und ohne Urteil (Kabat-Zinn, 2013).
Aufmerksamkeit für Körper und Geist
Ein Leben im Hier und Jetzt erzeugt Ruhe und größeren Lebensgenuss.
Achtsamkeit lehrt uns, im Hier und Jetzt Aufmerksamkeit für Körper und Geist zu entwickeln. Oft sind wir mit unseren Gedanken in der Zukunft oder in der Vergangenheit. Wir denken ununterbrochen an das, was kommen wird, oder sind noch mit dem beschäftigt, was gewesen ist. Nur selten sind wir im gegenwärtigen Moment anwesend – und das, obwohl es nur diesen Moment gibt. Nur im Heute kann das Leben wirklich gelebt werden. Achtsamkeit hilft uns, unseren Kopf zu verlassen und die Erfahrung im jeweiligen Moment intensiver wahrzunehmen. Im Hier und Jetzt anwesend zu sein, heißt, ruhiger zu werden, besser zu spüren, wie es uns geht, besser für uns sorgen zu können und intensiver zu genießen. So werden Stress, Angst und Depression vermindert, wie auch viele wissenschaftliche Studien zu diesem Thema belegen (Gotink, Chu, Busschbach, Benson, Fricchione, Hunink, 2015; Vøllestad, Nielsen, Nielsen, 2011). Ebenso wie aktive Bewegung hat auch Achtsamkeit positive Effekte auf die Verminderung von depressiven Symptomen (Hofmann, Sawyer, Witt, Oh, 2010; Khoury, Lecomte, Fortin, Masse, Therien, Bouchard u. a., 2013; Piet, Hougaard, 2011), sodass eines der bekanntesten Mindfulness-Programme, die Mindfulness-Based Cognitive Therapie (MBCT), inzwischen in die Behandlungsrichtlinien für Depressionen des Trimbos-Instituts (Spijker u. a., 2013) sowie in die internationalen NICE-Richtlinien (NICE, 2009) aufgenommen wurde.
Unsere innere Welt
Achtsam zu sein heißt auch, dass wir den inneren Vorgängen (Gedanken, Emotionen, körperlicher Wahrnehmung und der Absicht unserer Handlungen) größere Aufmerksamkeit schenken, sodass wir mehr darüber erfahren, wie unsere innere Welt funktioniert. Mithilfe der Achtsamkeit lernen wir, diese internen Prozesse aus einem Abstand heraus zu betrachten. Das gibt uns die Möglichkeit, zu entscheiden, wie wir uns dazu verhalten und darauf reagieren wollen. (Oder ob wir überhaupt darauf reagieren wollen.) Oft suchen wir außerhalb von uns selbst nach Antworten und Lösungen, obwohl die Lösung doch in uns selbst liegt. Denn wir haben keinen Einfluss darauf, was uns das Leben bringt, nur wie wir uns dazu verhalten.
Synergie
Im Mindful2Work-Training werden drei wirksame Komponenten kombiniert: bewusste aktive Bewegung, Yoga und Achtsamkeit. Der Schwerpunkt liegt auf der Achtsamkeit. Da wir davon ausgehen, dass sich Symptome, die mit arbeitsbedingtem Stress einhergehen, sowohl körperlich als auch seelisch äußern können, wird im Mindful2Work-Training mit dem Körper und mit dem Geist (dem Kopf) und mit Spannung und Entspannung gearbeitet, um die Stresssymptome zu reduzieren. Die Synergie ist somit die zentrale Idee des Mindful2Work-Programms. Denn ein Training, das auf beiden Ebenen ansetzt und dabei drei wirksame Bestandteile kombiniert, verspricht deutlichere und länger anhaltende Effekte als jedes einzelne Element für sich. Auf der körperlichen Ebene wird die Muskelspannung verringert und Entspannung und Erholung gefördert. Die Übungen werden dabei ganz bewusst im Freien durchgeführt, da die positiven Effekte von aktiver Bewegung und Sport zunehmen, wenn das Training draußen stattfindet. (Währborg, Petersson, Grahn, 2014).
Stresssignale wahrnehmen
Auch wenn sich während der Bewegungsübungen der Herzschlag erhöht, ist es wichtig, die Übungen achtsam auszuführen und körperlichen Signalen die volle Aufmerksamkeit zu schenken. Wir bitten Sie daher, lediglich 70 Prozent Ihrer Kraft auf die Übungen zu verwenden statt 100 oder sogar mehr als hundert Prozent. Gerade Menschen mit einem Risiko für Burn-out gehen oft über ihre eigenen Grenzen und stellen hohe Ansprüche an sich selbst, sodass sie körperlich und seelisch ausbrennen. Daher ist es uns wichtig, weniger über das Denken und die Willensstärke (»Was will ich?«) zu arbeiten und mehr über das Fühlen (»Wie geht es mir wirklich?«; »Was brauche ich gerade?«). Denn wenn wir mehr fühlen, stellen wir den Kontakt zu unserem Körper wieder her. Die Weisheit des Körpers kann sich so entfalten. Die physischen Signale sagen uns, wie es uns geht, wo unsere Grenzen sind und was wir gerade brauchen. Gut auf den Körper zu hören und für ihn zu sorgen, verringert die Tendenz, über die eigenen Grenzen zu gehen.
Die Yoga-Übungen
Diese Einstellung gilt im Mindful2Work-Training auch für die Yoga-Übungen. Wir haben uns bewusst für eine Kombination aus Yin-Yoga und Hatha Restorative Yoga entschieden. Dabei handelt es sich um ruhige Formen des Yoga, bei denen man sitzend oder stehend längere Zeit in bestimmten Haltungen bleibt, die vor allem auf die Beweglichkeit des Körpers abzielen sowie auf Stressreduzierung und Entspannung, sodass die psychische und körperliche Erholung unterstützt wird (Clark, 2012; Hanson, 2011). Bei diesen Übungen geht es im Wesentlichen darum, (körperlich) zur Ruhe zu kommen, bewusst zu entspannen, das Loslassen zu üben und sich den Positionen hinzugeben. Auch wenn wir versuchen, uns in der jeweiligen Position so gut wie möglich zu entspannen, können die Übungen dennoch anstrengend sein, durch das intensive Stretching (körperliche Erfahrung) oder weil wir es nicht gewohnt sind, längere Zeit in einer Haltung zu verweilen (mentale Erfahrung). Die angegebenen Varianten sollen dafür sorgen, dass die Übungen für jeden gut durchführbar und körperlich nicht zu fordernd sind. Die Yin-Positionen werden so eher zu stärkenden Yoga-Haltungen. Hatha Restorative Yoga ist eine sanftere Form des Yoga, die für jeden geeignet ist, ungeachtet körperlicher Einschränkungen. Dieser sanfte Umgang mit dem Körper zieht sich durch das gesamte Yoga-Programm von Mindful2Work. Während der Yoga-Positionen üben wir, unsere körperlichen Grenzen zu spüren, darauf zu hören und sie zu respektieren. Denn es geht darum, (wieder) zu lernen, wo sich die Grenze befindet und wie wir zur Ruhe kommen, anstatt aufs Gaspedal zu treten und weiterzurasen.
Mit Stress umgehen
Indem wir bewusster fühlen, stellen wir den Kontakt zu unserem Körper wieder her.
In den ersten drei Einheiten wird die Basis gelegt: Sie lernen mit den Achtsamkeitsübungen, die Aufmerksamkeit auszurichten und aufrechtzuerhalten sowie Körper und Atem bewusst wahrzunehmen. In der zweiten Hälfte des Kurses wird darauf aufbauend der achtsame Umgang mit inneren und äußeren Vorgängen verfeinert. Dabei wird es um den Umgang mit Stress und schwierigen Situationen sowie um Selbstmitgefühl und Selbstfürsorge gehen. Sobald die Aufmerksamkeit im Hier und Jetzt verweilt und weniger in die Vergangenheit und die Zukunft abschweift, wird sich auch der Geist beruhigen. Die Meditation und der Prozess des Inquiry (einer vertiefenden Erforschung nach der Meditation, mit der die Kursleitung es den Teilnehmenden ermöglicht, selbst wahrzunehmen, wie der Geist auf bestimmte Erfahrungen reagiert) können zu Erkenntnissen darüber führen, inwieweit wir unseren Stress selbst verstärken. So üben wir zum Beispiel, Abstand zu inneren (Gedanken, Gefühlen, körperlichen Empfindungen, Handlungsimpulsen) und äußeren Ereignissen zu gewinnen und lernen so, dass wir selbst entscheiden können, wie wir auf unsere Erfahrungen reagieren. Und das wiederum gibt uns ein Gefühl der Freiheit. Wir erleben, dass Gedanken vorübergehen, dass sie keine unverrückbaren Fakten sind, sodass wir vielleicht weniger in den Strudel unserer (negativen) Gedanken hineingezogen werden. Und da unser Körper und unser Geist in Wechselwirkung stehen, ist es wahrscheinlich, dass die Arbeit auf beiden Ebenen einen synergetischen Effekt hat: Die Summe ist größer als jedes Element für sich genommen.
»Zuerst der sportliche Teil, zum Auflockern, körperlich wie geistig, sodass man das bisherige Muster verlässt. Ein gutes Gefühl. Und beim Yoga ist man auch wieder körperlich aktiv, aber auf eine andere Art. Und dann zum Schluss die Achtsamkeitsmeditationen. Ein wunderbarer Flow.«
Das Mindful2Work-Training gibt einen natürlichen Ablauf vor, man bewegt sich zunächst bewusst und aktiv in der Natur, um dann über die Yoga-Übungen und die Meditation im Sitzen allmählich zur Ruhe zu kommen – eine Bewegung, die im buchstäblichen Sinn von außen nach innen führt. Während der aktiven Bewegung in der Natur wirbeln die Blätter wortwörtlich noch um einen herum, in der Meditation, die drinnen stattfindet, legt sich der Staub allmählich, sodass Raum für Selbstbetrachtung, Reflexion und neue Erkenntnisse entsteht.

Mehr als 83 Prozent der Teilnehmenden äußern die Absicht, nach dem Mindful2Work-Training weiterhin mit mindestens zwei, aber oft auch mit allen drei Elementen weiterzuarbeiten.
AUS DEN FORSCHUNGSBERICHTEN
Woche 1
Vom Autopiloten zur Achtsamkeit

»Ich bin mir der Dinge, Gedanken und Routinen jetzt bewusster, und ich nehme wahr, wie ich mich im Moment gerade fühle.«

Hintergrundwissen zur ersten Sitzung: Vom Autopiloten zur Achtsamkeit
»Seit ich am Mindful2Work-Training teilgenommen habe, bin ich in der Lage, so etwas wie Abstand herzustellen, wenn ich Stress habe, sodass ich ein wenig ruhiger werde. Zumindest aber nimmt der Stress dann nicht so heftig von mir Besitz. Es bildet sich eine Art Kokon um mich herum, ohne dass ich apathisch oder distanziert bin. Es ist nicht ganz einfach zu beschreiben, aber es hat einen großen Effekt.«
Die Auswirkungen von Stress
Multitasking, hohe Geschwindigkeit, der dauernde Wettbewerb, eine unsichere Arbeitsplatzsituation, ständige Erreichbarkeit über die sozialen Medien, Reizüberflutung und andauernder Zeitdruck bestimmen heute das Leben in der westlichen Gesellschaft (Stansfeld, Candy, 2006). Wenn uns jemand fragt, wie es uns geht, bekommen wir häufig ein »viel zu tun« zur Antwort. Auch wenn eine hohe Geschwindigkeit, Wettbewerb, ständige Erreichbarkeit und eine Menge Aufgaben und Reize für manche Menschen vielleicht inspirierend sein mögen, bringt all das doch auch Stress mit sich. Stress aber beeinflusst unser Wohlbefinden und unsere Gesundheit negativ. Kurzfristig kann Stress zu Symptomen wie Kopfund Muskelschmerzen, erhöhtem Herzschlag und Blutdruck, Schlafproblemen und einem Gefühl der mentalen Instabilität führen. Langfristig führt Stress sogar zu chronischer Müdigkeit, Erschöpfung, Burn-out, Angst, Depressionen, verminderter kognitiver Leistungsfähigkeit (Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren, zu planen und zu organisieren, Prioritäten zu setzen und Gedächtnisschwierigkeiten), somatischen Symptomen sowie kardiovaskulären Erkrankungen (Hammen, 2004; Hassmén, Koivula, Uutela, 2000; Leone, Wessely, Huibers, Knottnerus, Kant, 2011; Lupien, Maheu, Tu, Fiocco, Schramek, 2007; Sadeh, Keinan, Daon, 2004; Schneiderman, Ironson, Siegel, 2005; Wolever u. a., 2012). Sind wir bei der Arbeit lang anhaltendem Stress ausgesetzt, kann dies die unterschiedlichsten Folgen haben: geringere Produktivität, häufigere Erkrankungen, Zunahme von Betriebsunfällen, Zunahme von Fehlern und Konflikten (European Agency for Safety and Health at Work, 2014; Kalia, 2002). In den Niederlanden leiden Erhebungen zufolge mehr als eine Million Menschen an Burn-out-Symptomen und 36 Prozent des krankheitsbedingten Arbeitsausfalls sind auf Stress am Arbeitsplatz zurückzuführen (Goudswaard, 2017; Van der Ploeg, Van der Pal, De Vroome, Van den Bossche, 2014). Während des Mindful2Work-Trainings werden wir mithilfe einer Kombination aus bewusster aktiver Bewegung, Yoga und Achtsamkeit an diesen Symptomen arbeiten.
Unsere Aufmerksamkeit ist häufig nicht an dem Ort, an dem sich unser Körper befindet.
Achtsamkeit
Achtsamkeit wird von Jon Kabat-Zinn als das Bewusstsein definiert, das durch eine bestimmte Art der Aufmerksamkeit entsteht, die gezielt auf den gegenwärtigen Moment bezogen und nicht wertend ist. Was dies bedeutet, lässt sich am Gegenteil veranschaulichen: Jemand stellt sich uns vor und wir vergessen seinen Namen sofort wieder; wir kommen am Arbeitsplatz an, können uns aber nicht mehr wirklich daran erinnern, wie wir dort hingekommen sind. Körperlich sind wir dort, aber mit unserem Kopf – unserer Aufmerksamkeit – sind wir ganz woanders. Unsere Aufmerksamkeit ist häufig nicht an dem Ort, an dem sich unser Körper befindet: Wir befassen uns mit Dingen, die noch geschehen werden oder schon geschehen sind und so verpassen wir den gegenwärtigen Moment. In unserem Kopf ist so viel los, weil wir ständig Ausflüge in die Vergangenheit oder in die Zukunft machen. Die Fähigkeit, mit dem Körper an dem einen und mit dem Kopf (unserer Aufmerksamkeit) an einem anderen Ort verweilen zu können, rührt daher, dass wir mit einem Autopiloten ausgestattet sind.
Der Autopilot
Im wörtlichen Sinn ist der Autopilot ein Mechanismus, mit dem ein Fahrzeug ohne menschliches Eingreifen gesteuert werden kann. Dinge, die uns zur Routine geworden sind, die wir automatisiert haben, wie zum Beispiel den Weg zur Arbeit, können wir erledigen, ohne groß darüber nachzudenken, ohne ihnen bewusste Aufmerksamkeit schenken zu müssen. Etwas im Autopiloten-Modus erledigen zu können, hat sicherlich Vorteile. Stellen Sie sich vor, wir müssten jedes Mal ganz bewusst darüber nachdenken, welchen Weg wir zur Arbeit nehmen sollen. Es ist natürlich praktisch, dass wir auf diese Weise mehrere Dinge gleichzeitig tun können. Aber genau das ist auch das Tückische! Es bedeutet nämlich, dass wir, während wir handeln, mit unserer Aufmerksamkeit ganz woanders sein können. Das wiederum hat zur Folge, dass wir dem gegenwärtigen Moment kaum Aufmerksamkeit schenken und so den einzigen Moment, den wir wirklich erleben, verpassen. Außerdem kostet es viel Energie, sorgt für Unruhe und belegt unseren Arbeitsspeicher, der – wenn wir mit sehr vielen Dingen gleichzeitig beschäftigt sind –, überlastet werden kann. Dewulf (2010) vergleicht dies mit einem Computer, auf dem viele Dokumente gleichzeitig geöffnet sind. Je mehr Programme laufen und Dokumente geöffnet sind, desto langsamer wird der Rechner, er hängt sich auf und stürzt schließlich ab. Dasselbe kann mit unserem Arbeitsspeicher geschehen, wenn er überlastet ist. Er gerät ins Stocken, wir verlieren den Überblick und können nicht mehr klar denken. Glücklicherweise kann man daran etwas ändern. Wir können diesen Prozess umkehren! Anstatt auf Autopilot zu schalten und mit schrecklich vielen Dingen gleichzeitig beschäftigt zu sein, können wir uns des gegenwärtigen Moments bewusst werden und uns auf eine Sache fokussieren. Wenn wir uns in Achtsamkeit üben, ist das zwar keine Garantie dafür, dass wir ständig im Moment leben, denn auch dann unternehmen wir manchmal noch Ausflüge in unserem Kopf, z. B. um zukünftige Dinge zu planen oder über etwas zu reflektieren, was geschehen ist. Das ist ganz normal. Der Unterschied ist allerdings, dass dieses Abschweifen dann immer öfter zu einer bewussten Entscheidung wird, bei der wir selbst Regie führen.
In der Meditation erkennen wir, wie wir mit den Dingen umgehen und auf sie reagieren.
Innere Prozesse
In der Meditation betrachten wir die Prozesse, die in unserem Inneren ablaufen, aus einem Abstand heraus. So können wir erkennen, wie wir mit den Dingen umgehen und auf sie reagieren. Dies verändert unsere Erfahrung und schafft Raum, anders mit ihnen umzugehen. Wir haben meist keinen Einfluss darauf, was uns auf unserem Weg begegnet, das gilt für unser Leben wie für die Gedanken und Gefühle, die ständig durch unseren Kopf rasen. Aber wir haben sehr wohl die Wahl, wie wir uns dazu verhalten. Achtsamkeit dreht sich darum, die zugrundeliegenden Erfahrungen bewusst wahrzunehmen, bevor wir sie interpretieren oder uns Geschichten dazu ausdenken. »Knowing what’s on your mind«, wie Kabat-Zinn es formuliert. Das setzt voraus, dass wir die Dinge mit einem unvoreingenommenen Blick betrachten, so wie sie wirklich sind. Achtsamkeit kann also dazu führen, dass wir – zum Beispiel, wenn wir durch einen Park laufen – alles um uns herum bewusster wahrnehmen und bemerken, welchen Effekt dies auf uns hat. Plötzlich sehen wir, wie die Sonne durch die Blätter scheint, spüren wir die frische Luft, riechen den Geruch des frisch gemähten Grases, hören die Vögel, wo wir sonst alles dem Autopiloten überlassen und in Gedanken noch bei dem Gespräch mit unserem Chef waren oder schon bei der Einladung zum Abendessen.
Wenn wir uns innere Prozesse bewusst machen, können wir bewusster leben, entscheiden und handeln.
Wenn wir der Erfahrung im Moment bewusste Aufmerksamkeit schenken, können wir sie intensiver erleben und den Augenblick besser genießen. Andererseits kann es natürlich auch sein, dass wir in dieser bewussten Aufmerksamkeit entdecken, dass wir etwas unangenehm finden. Zum Beispiel dann, wenn wir mit voller Aufmerksamkeit eine Rosine essen, wie wir es in der ersten Sitzung dieser Trainingseinheit tun. Vielleicht bemerken wir plötzlich, dass wir die Konsistenz der Rosine gar nicht mögen oder den Nachgeschmack zu sauer finden, obwohl wir schon unser ganzes Leben lang Rosinen essen und das noch nie bemerkt haben! Die Erfahrung mag in diesem Moment nicht angenehm sein, aber wir erkennen, wie die Dinge wirklich liegen und können dann etwas daran ändern (zum Beispiel andere oder keine Rosinen mehr essen).
Tun-Modus und Sein-Modus
Manchmal lässt sich an den unangenehmen Dingen, die wir erleben und die wir lieber anders machen würden, nichts ändern. Achtsamkeit kann uns dabei helfen, damit besser umzugehen. Jon Kabat-Zinn führte 1990 die Begriffe Tun-Modus und Sein-Modus ein. Wenn etwas störend ist und wir es loswerden wollen oder etwas wünschenswert ist und wir wollen mehr davon, dann handeln wir meist zielgerichtet, analysierend und problemlösend – wir befinden uns im Tun-Modus. Der Tun-Modus ermöglicht es uns, unsere Ziele zu erreichen und Veränderungen herbeizuführen, den Abstand zwischen dem, was wir sein wollen, und dem, was wir sind, zu verringern. Unsere Fähigkeit, Dinge zu analysieren und Lösungen herbeiführen zu können, ist fantastisch, aber wir können nicht alles in unserem Leben auf diese Weise verändern oder lösen. Das gilt für manche Probleme bei der Arbeit, für unsere Stimmungen, für bestimmte körperliche Beschwerden und anderes mehr. Der Sein-Modus steht dem Tun-Modus gegenüber: In diesem Modus erfahren wir die Welt unmittelbar, sind nicht auf das Ziel ausgerichtet, sondern mit dem Weg dorthin befasst – dies ist der eigentliche Achtsamkeits-Modus.
In der Meditation schalten wir in den Sein-Modus. Statt die Dinge verändern zu wollen, lassen wir das zu, was im Moment ist. Erfahrungen werden wahrgenommen, wie sie in diesem Moment auftauchen, ohne Urteil. Meditationslehrer Thich Nhat Hanh nennt das »Being with the suchness of things«. Der Sein-Modus hilft, das, was im Moment ist, besser auszuhalten. Das Schöne an der Achtsamkeit ist also, dass sich die Umstände nicht ändern müssen, um eine Veränderung herbeizuführen! Das bedeutet natürlich nicht, dass sich die Gegebenheiten nie verändern müssen, wenn wir nur achtsam mit ihnen umgehen. Aber wenn wir zunächst wirklich erfahren, wie es im Moment ist, statt vor dieser Erfahrung wegzulaufen oder dagegen anzukämpfen und eine schnelle Lösung suchen, verändert sich das Bewusstsein, und es entsteht ein Freiraum. Dieses Bewusstsein und der neu gewonnene Freiraum ermöglichen es uns dann, bewusster zu leben, zu entscheiden und zu handeln.
Tasuta katkend on lõppenud.