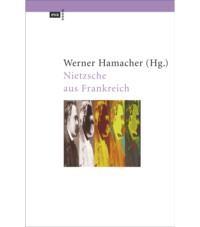Loe raamatut: «Nietzsche aus Frankreich»
Die hier vereinten Texte der führenden Köpfe des französischen Poststrukturalismus machen das deutsche Lesepublikum mit einer bis heute ungewohnten Herangehensweise an das schwer zu fassende Œuvre eines Denkers bekannt, der sich hierzulande nach wie vor den unterschiedlichsten Instrumentalisierungen ausgesetzt sieht. Die Autoren dieser Sammlung stellen insgesamt die Legitimität in Frage, Nietzsches Werk nach der Logik des Gegensatzes von Metaphysik und Nicht-Metaphysik, Aufklärung und Gegenaufklärung, Philosophie und Literatur zu bestimmen.
Der Herausgeber
Werner Hamacher, geboren 1948, Literaturkritiker und Theoretiker der Dekonstruktion und Professor für Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft an der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Von 1984 bis 1998 lehrte er an der Johns Hopkins University in Baltimore/Maryland. Seine Arbeiten liegen im Grenzgebiet zwischen den Literaturwissenschaften und der Sprach- und Geschichtsphilosophie, im Bereich Ästhetik und Hermeneutik.
Eine Auswahl seiner Veröffentlichungen: Entferntes Verstehen. Studien zu Philosophie und Literatur von Kant bis Celan (1998) – (Mithrsg.) Paul Celan (1988) – pleroma. Zu Genesis und Struktur einer dialektischen Hermeneutik bei Hegel (1978).
Nietzsche aus Frankreich
Essays von
Georges Bataille, Maurice Blanchot, Jacques Derrida, Michel Foucault, Pierre Klossowski, Philippe Lacoue-Labarthe, Jean-Luc Nancy und Bernard Pautrat
Herausgegeben
von
Werner Hamacher

E-Book (EPUB)
© CEP Europäische Verlagsanstalt GmbH, Hamburg 2022
Alle Rechte vorbehalten.
Covergestaltung: nach Entwürfen von MetaDesign, Berlin
Print-Ausgabe: EVA/Europäische Verlagsanstalt 2007
EPUB:
ISBN 978-3-86393-608-2
Informationen zu unserem Verlagsprogramm finden Sie im Internet unter www.europaeischeverlagsanstalt.de
Inhalt
Werner Hamacher
Echolos
Georges Bataille
Nietzsche im Lichte des Marxismus
Pierre Klossowski
Nietzsche, Polytheismus und Parodie
Michel Foucault
Nietzsche, Freud, Marx
Maurice Blanchot
Nietzsche und die fragmentarische Schrift
Michel Foucault
Nietzsche, die Genealogie, die Historie
Philippe Lacoue-Labarthe
Der Umweg
Bernard Pautrat
Nietzsche, medusiert
Jacques Derrida
Sporen Die Stile Nietzsches
Jean-Luc Nancy
»Unsre Redlichkeit!« (Über Wahrheit im moralischen Sinn bei Nietzsche)
Nachbemerkung
Nachweise
Werner Hamacher
Echolos
Unter dem Datum des 10. Dezember 1898 hat André Gide in seinen fiktiven Briefen an Angèle, die zuerst in der Zeitschrift L’Ermitage, später zusammen mit anderen Essays, Vorträgen und Reflexionen unter dem zweideutigen Titel Prétextes veröffentlicht wurden, sein ironisches Lob auf die Verspätung der französischen Übersetzung von Nietzsches Werken damit begründet, daß – ich übersetze – dank dieser grausamen Langsamkeit der Einfluß Nietzsches dem Erscheinen seiner Werke vorausgegangen sei. Fast, so fährt Gide fort, war die französische Publikation der Werke verzichtbar; »denn man kann geradezu die Behauptung aufstellen, daß Nietzsches Einfluß wichtiger ist als sein Werk, oder gar, daß sein Werk nur eines des Einflusses ist.«
Die Verspätung der Texte, so will es Gides Bemerkung, bringt fast die Wahrheit über die Texte an den Tag: daß die Wirkung das Werk übertrifft, daß das Werk wesentlich in seiner Wirkung beruht und unabhängig von ihr keinen Bestand, keine Substanz hat, und daß das Werk, von seiner Wirkung determiniert, das Werk eben dieser Wirkung ist. Man muß nicht so weit gehen, bei dem Begriff ›Einfluß‹ an einen influxus physicus und die astrologischen Konnotationen des Wortes zu denken, um zu bemerken, daß Gide in seiner Charakterisierung von Nietzsches Wirkung in Frankreich an die Stelle der Substantialität des Werks die Substantialität seiner Wirkung setzt. Es bedarf nur eines Blicks auf einige von Nietzsches »eigenen« Überlegungen, um in Gides Theorie ihrer Wirkung – und also in der Wirkung, die sie auf Gide getan haben – ein getreues Echo zumindest einer der Behauptungen Nietzsches, und also in seiner Wirkung das Werk zu erkennen. Im dreizehnten Aphorismus der ersten Abhandlung der Genealogie der Moral nämlich polemisiert Nietzsche gegen die Überzeugung, es gebe hinter dem Starken ein indifferentes Substrat […], dem es freistünde, Stärke zu äußern oder auch nicht. Aber – so hält Nietzsche diesem moralischen und erkenntnistheoretischen Glauben entgegen – es gibt kein solches Substrat; es gibt kein Sein hinter dem Tun, Wirken, Werden; »der Täter« ist zum Tun bloß hinzugedichtet – das Tun ist alles. Daß es hinter dem Tun noch einen Täter, hinter dem Wirken noch ein Sein gibt, ist für Nietzsche nichts als eine Illusion der Grammatik, in der die gesamte Geschichte der Philosophie seit der Lehre des Demokrit von einer unteilbaren Grundfigur, dem Atom, bis hin zur kantischen Doktrin von einem Ding an sich und zur Lehre des spekulativen Idealismus von einem substantiellen Subjekt, heiße es nun Wissen oder Werk, Geist oder Darstellung, befangen ist. Wie immer das Substrat benannt sein mag, es verdankt sich der trügerischen Disjunktion zwischen grammatischem Subjekt und Prädikat im Aussagesatz und deshalb dem, was Nietzsche die Verführung der Sprache nennt. Nicht bestimmten Gegenständen werden bestimmte Eigenschaften prädiziert – so argumentiert Nietzsche –, sondern nie endgültig bestimmbare Kraftimpulse sprechen sich Eigenschaften zu und sind nichts anderes als eben dieses Zusprechen: Prädikationen, die sich in präkonventionellen, Konventionen erst setzenden Akten vollziehen. Die Grammatik des Aussagesatzes ist bloß die illusorische Figur, in der sprachliche Akte festgeschrieben und zum Gegenstand irreführender Zerlegungen in verschiedene Funktionen gemacht werden. Das Subjekt – ob nun des Autors oder des Lesers – ist bloß die Figur, zu der ein Akt; das Werk die Figur, zu der sein Wirken entstellt ist.
Die Rede vom Werk und die Rede von einem Autor – von jenem »Herrn Nietzsche«, den die Vorrede zur Fröhlichen Wissenschaft zu ignorieren empfiehlt – beruht also nicht nur auf einem harmlosen grammatikalischen Irrtum, sondern auf einer gefährlichen Verirrung, die das sprachliche Handeln und damit die Sprache überhaupt zu lähmen droht. Wenn Gide den Einfluß Nietzsches höher einschätzt als sein Werk und dies Werk auf seinen Einfluß reduziert, dann scheint es ganz so, als würde er sich zum Agenten des Sprach-Aktivismus machen, dem die zitierte Passage aus der Genealogie der Moral das Wort redet. Gides Bemerkung, die nur prononcierter formuliert, was deutschsprachige Autoren wie Musil und Benn, Hofmannsthal, Thomas und Heinrich Mann mit den selben abstrakten Begriffen beschreiben: Nietzsche habe sie beeinflußt und entscheidend auf sie eingewirkt –; diese Bemerkung scheint zu bezeugen, daß Nietzsches Parteinahme für die Wirkung der Sprache und daß seine Virtuosität in ihrem wirkungsvollen Gebrauch sich durch eine Unzahl von Wirkungen – der verschiedensten und der widersprüchlichsten Art – ausgezahlt hat und daß derart sein Werk in der Tat zum Werk seiner Wirkungen wurde. »Das Werk« ist zum Wirken bloß hinzugedichtet – so ließe sich Nietzsches Diktum (und genauer: »Nietzsches« Diktum) variieren –, die Wirkung ist alles …
Doch wäre die Wirkung alles, so wäre sie nicht die von Nietzsches Werk, nicht »seine« Wirkung, sie wäre die Wirkung einer Sprache, die nicht als Subjekt ihrer Wirksamkeit operiert, sondern als bloße Überredung perlokutiv immer schon ihren Adressaten und ihr Ziel erreicht hätte, reine rhetorische Gewalt. Wie aber nichts, was im Gebiet dieser rhetorischen Gewalt geschieht, unabhängig von ihr zuwege gebracht werden kann, so ist auch die Projektion eines Subjekts hinter die Tat und eines Werks hinter die Wirkung ein sprachlicher Akt: »der Täter« – so lautet Nietzsches Formulierung – ist bloß hinzugedichtet, er ist hinzugedichtet unter der Verführung der Sprache. Wenn die Verführung durch die Sprache alles ist, dann hat aber auch die Hinzudichtung eines Subjekts ihr Recht – nämlich das Recht der rhetorischen Gewalt – und dann ist nicht nur das Subjekt sprachlicher Äußerungen, sondern auch ihre Wirksamkeit selbst eine Erdichtung. Die Aktivität der Sprache ist Täuschung, ihre performative Substanz Effekt einer Verführung –: denn daß Sprache nicht nur gelegentlich und unter bestimmten Bedingungen, sondern daß sie regelmäßig und immer Verführung sei, ist selbst schon ein Glaube, der der Suggestion der Sprache folgt. Sprache, als Verführung verstanden, ist ein fundamentales und alle Fundamente zerbrechendes Paradox. Substanz ohne Substanz, führt die Verführung, die die Sprache ist, nie vom Weg der Wahrheit ab, weil es eine andere Wahrheit als die erdichtete nicht gibt.
Hinzudichtung also wäre alles – aber nichts hat diese Hinzudichtung nötiger als die Hinzudichtung »selbst«. Denn Nietzsches emphatische Parteinahme für das subjektlos-reine Tun der Sprache – und das heißt für ihre unwiderstehliche Setzungsmacht – wäre nicht nötig, wenn ihre performative Gewalt sich tatsächlich allenthalben durchzusetzen vermöchte. Und hätte die Verführung zur grammatischen Disjunktion nicht eine Grenze, so hätte auch Nietzsche dem Aberglauben an ein indifferentes Substrat der Sprache erliegen müssen. Aber die Verführung, die die Sprache ist, ist kein perlokutives, sondern allenfalls ein illokutives Ereignis, das nicht notwendig an sein Ziel: zu sich selbst kommt und dessen Wirkung seine möglichen Adressaten und in ihnen seine eigene Substanz nicht immer schon überredet hat. Sprache als Überredung wirkt in Differenz zu sich selbst. Noch vor jeder grammatischen Disjunktion in Subjekt und Prädikat findet die entscheidende – die performative – Disjunktion im Wirken der Sprache statt, in ihrem Tun und ihrem Werden. Wesentlich Wirkung, ist sie doch immer actio in distans zu sich selbst. Denn ihr Wesen – daß sie immer nur wird und nie ist, daß sie immer nur wirkt und nie Werk ist – vermag, da es Verführung ist, nie zu Etwas, sondern immer nur zur Verführung zu verführen. Das heißt aber, daß sie nie verführt haben darf, wenn anders sie Verführung bleiben soll; daß es kein Tun der Sprache geben kann, wenn anders Sprache als Tun möglich sein soll. Ihr Wesen – ihr Werden und Wirken – ist immer schon behindert, blockiert oder unterbrochen. Wenn Sprache Wirkung tut, dann aus jenem Fond der Unwirksamkeit, der sich als Distanz zu ihrem Wirken, als Distanz zu ihr selbst als Wirkung öffnet.
Diese Handlungsdistanz: die Spanne, die sich zwischen dem Wirken eines Textes und der grammatikalischen Fixierung zum Sein dieses Wirkens auftut, läßt sich weder kontrollieren, noch läßt sie sich reduzieren, denn erst dieser Distanz entspringt das Wirken und mit ihm der Text, der sich von jeder Bewegung, die er auslöst, zurückzieht. In jedem Sprechakt ist diese distantia actionis am Werk und verhält ihn konstitutiv, destitutiv zur Unwirksamkeit. Er ist möglicher Akt – aber das Potential jedes Aktes ist ein Potential aus Inaktivität: es läßt Wirkungen von unabsehbarer Vielfalt zu, aber weder bewirkt es sie, noch wird es von solchen Wirkungen erschöpft.
Die Theorien der Wirkungsgeschichte deuten Geschichte nach dem Modell des Aussagesatzes: Ein Werk provoziert – und sei’s à voix blanche – eine Wirkung. Die nietzscheanisierende Radikalisierung dieses Konzepts, zu der Gides ironische Charakteristik von Nietzsches Wirkung in Frankreich den Keim enthält, kehrt seine Aussage um: Die Wirkung macht das Werk – und bleibt dabei auf das gleiche Satzmodell fixiert. Erst mit dem Hinweis auf die »grausame Langsamkeit« der Übersetzung Nietzsches, dem sich die Prärogative der Wirkung vor dem Werk verdanken soll, berührt Gide jenen Grundsatz, den Nietzsche in der Genealogie der Moral für die Geschichtsschreibung aufgestellt hat: daß nämlich die Ursache der Entstehung eines Dings und […] dessen tatsächliche Verwendung und Einordnung in ein System von Zwecken toto coelo auseinander liegen […] (12. Aphorismus der Zweiten Abhandlung). Wenn Ursprung und Verwendung, Werk und Wirkung auseinander liegen, dann muß jede Verwendung den ursprünglichen Sinn einer Äußerung nicht nur verfehlen, sondern ihrerseits zum Ursprung eines anderen Sinns werden können: eines Sinns, der nicht im Ziel der ursprünglichen Intention liegt, sondern aus dem Kontinuum ihrer Herkunftslinie herausspringt. Jede Erkenntnis kommt für die Handlung, jede Verwendung kommt für das Werk, auf das sie sich bezieht, zu spät; und da Erkenntnis und Verwendung selber Handlungen sind, kommt jede zu früh, als daß sie bei sich selbst sein könnte. Insofern ist das Auseinander von Ursprung und Zweck und Werk und Wirkung strukturell irreduzibel. Die Kontingenz ihrer Relation läßt sich durch keine teleologische oder genealogische Konstruktion in Notwendigkeit verwandeln, denn diese Kontingenz – Foucault hat das Motiv in seinen Arbeiten aufgegriffen – ist im Ursprung selbst schon am Werk und sie erst läßt es zur retrospektiven Vorstellung von einem Ursprung kommen. Freilich nur mit jener »Langsamkeit«, die die Herrschaft des Ursprungs labil und eine kritische »Archäologie« noch der Archäologie möglich macht.
Wenn diese konstitutive – und dekonstitutive – Verzögerung in der Sprache irreduzibel ist, so gibt es – nicht ohne ihr Zutun – doch auch eine zusätzliche, die »grausame«, eine in Grenzen reduzible Verzögerung. Es ist diejenige, die die literarischen oder philosophischen Werke auf ihrem Weg von einer Sprache in eine andere, von einer kulturellen Tradition in eine zweite erfahren. Am Ende der neunziger Jahre des 19. Jahrhunderts war ein großer Teil von Nietzsches Texten ins Französische übersetzt und seither dauert in Frankreich, begleitet von weiteren und von Neuübersetzungen, von biographischen und geistesgeschichtlichen Monographien, eine selten unterbrochene intensive Beschäftigung mit Nietzsche an, die sein Werk nicht mehr bloß als das seiner Wirkung behandelt. Über diese mehr als hundertjährige Auseinandersetzung und über die Effekte, die sie in der französischen Diskussion philosophischer, anthropologischer, ethischer oder ästhetischer Probleme, in theoretischen wie in literarischen Werken hinterlassen hat, ist hier nicht zu berichten; über sie geben – mit jeweils anderem Akzent – die Studien von Geneviève Bianquis und W. D. Williams, von Pierre Boudot, Eric H. Deudon und anderen Auskunft. Die Sammlung der Essays, Vorträge und Reflexionen in diesem Band wird nicht in der Absicht vorgelegt, eine bestimmte Epoche oder eine Schule der Nietzsche-Lektüre in Frankreich zu dokumentieren und sie auf diese Weise den Archiven einer antiquarisch, und selbst noch an ihrer eigenen Gegenwart nur antiquarisch interessierten Öffentlichkeit einzuverleiben. Auf diesem Weg würden nicht nur die hier versammelten Texte ihrer Brisanz beraubt, Nietzsches Texte selbst würden das, was sie auf dem Weg nach Frankreich gewonnen haben, wieder verlieren.
Die historische Ironie in Gides Wort von einer Wirkung ohne Werk liegt darin, daß es mittlerweile eine triftigere Formel für Nietzsches Los in Deutschland geworden ist als sie es je für sein französisches war. Kaum etwas könnte bezeichnender für den »Stand der Nietzsche-Forschung in Deutschland« sein als der Umstand, daß sie die erste vollständige historisch-kritische Gesamtausgabe von Nietzsches Werken der zähen und gescheiten Arbeit der beiden Italiener Colli und Montinari zu verdanken hat. Nietzsche in Deutschland – das war die längste Zeit die Geschichte seiner Erhebung zum geistigen Aristokraten, seiner Stilisierung zum intellektuellen Snob und seiner Verharmlosung zum Artisten-Metaphysiker; das war die Geschichte seiner Ernennung zum Erzieher und Züchter einer höheren Rasse oder einer nach dem »Ideal« des Übermenschen gebildeten Bildungsbürgerklasse; es war die Geschichte seiner Beschlagnahme durch einen verheerenden Biologismus und seiner Verstümmelung zum Propheten der neuen Zeit; in ihrem Gefolge: seiner Diffamierung als Protofaschist und Wegbereiter eines Systems der kalkulierten Menschenverachtung; Nietzsches Geschichte in Deutschland war zu gleichen Teilen die Geschichte seiner Idealisierung und Ächtung. Er war für die meisten der Philosoph ihrer Pubertät – eine Figur der unsicheren Identifikation und des unbestimmten Grausens, des ziellosen Furors und des hellen Größenwahns. Er wurde als »freier Geist« verstanden – aber der »freie Geist« war nur eine seiner ironischen Gestalten –, denn diejenigen, die ihn brauchten, waren nicht frei genug, ihn zu lesen. Nietzsche in Deutschland, das war in vieler Hinsicht die Geschichte einer Fama: sie bestimmte das Los seiner Texte und betäubte das Gehör für ihre Stimmen. Am Ende dieser Geschichte der pathetischen Parteinahmen, die eine Geschichte ebenso vieler gescheiterter Identifizierungen ist, steht, trocken, der Versuch, ihn mit den Mitteln einer positivistisch verarmten Philologie zu domestizieren: zu verdeutschen – eine weitere Variante der Identifizierungsmanöver, die diesmal nicht durch Mythisierung seine Wirkung zu schüren, sondern durch Askese jede Wirkung und noch jeden Gedanken zu ersticken versucht.
In Sachen ›Nietzsche in Deutschland‹ war das zwanzigste Jahrhundert zum größeren Teil nur eine einfallslose Variante des neunzehnten, das Nietzsche noch selber kannte und unter dessen »Völkern und Vaterländern« er eine Wahl getroffen hatte, die seinem Scharfblick noch hundert Jahre nach seinem Ende Ehre macht. In Ecce homo schreibt er: In Wien, in St. Petersburg, in Stockholm, in Kopenhagen, in Paris und New-York – überall bin ich entdeckt: ich bin es nicht in Europas Flachland Deutschland … […] Man nennt nicht umsonst die Polen die Franzosen unter den Slaven – und es ist gerade seine polnische Herkunft, die er auf den vorangehenden Seiten gefeiert hat: nicht zwischen Polen und Frankreich, nicht in Deutschland, sah er den geographischen Ort seiner Philosophie, sondern jenseits der deutschen Grenzen nach Osten und Westen. In seiner philosophischen Topologie war es aber insbesondere Frankreich, das er als Ort der audaces et finesses und eines esprit zu erreichen versuchte, der sich noch immer der Verführung zu metaphysischen Zwangsvorstellungen zu erwehren wußte. Deutsch denken, deutsch fühlen – ich kann alles, aber das geht über meine Kräfte … Mein alter Lehrer Ritschl behauptete sogar, ich konzipierte selbst noch meine philologischen Abhandlungen wie ein Pariser romancier – absurd spannend. Nietzsche ist in einer durch den Faschismus verkommenen und seither von einem imaginären Internationalismus diskreditierten Tradition derjenige gewesen, der die Frage nach dem sprachlichen, kulturellen und historischen Idiom der Philosophie am radikalsten gestellt, und einer der wenigen, die auf sie eine entschieden xenophile Antwort gegeben haben.
Im 254. Aphorismus von Jenseits von Gut und Böse bezeichnet er als einen der Beweggründe für seinen frankophilen Widerstand gegen die geistige Germanisierung den Umstand, daß nur in Frankreich die Fähigkeit zu artistischen Leidenschaften ausgebildet worden sei, zu Hingebungen an die ›Form‹, für welche das Wort l’art pour l’art, neben tausend anderen, erfunden ist – eine Fähigkeit, aus der eine Art Kammermusik der Literatur hervorgegangen sei. Auch wenn Nietzsche in seiner Einschätzung ungerecht war und mit seiner Zuweisung des kammermusikalischen Privilegs an Frankreich nicht ohne weiteres recht hatte –: die Texte, die seinen Schriften zwischen den fünfziger und achtziger Jahren des letzten Jahrhunderts von französischen Autoren gewidmet worden sind und von denen dieser Band eine kleine Auswahl versammelt, zeichnen sich in der Tat vor denen aus anderen »Völkern und Vaterländern« dadurch aus, daß in ihren besten die Form einer Art Kammermusik der Analyse zur Meisterschaft ausgebildet ist. Das Gespür für Rhythmik und Synkopierung sowohl der literarischen wie der argumentativen Bewegungen in Nietzsches Texten, der Sinn für dissonante Verschränkungen in der Komposition und Entwicklung seiner Themen, für die Nuancen der Intonation und die Fermaten, die das Idiom dieser Texte bestimmen –, die Hellhörigkeit für das einzelne Wort und die marginale, fast vergessene Eintragung, die diese französischen Autoren charakterisiert, ist keine ›ästhetische‹ Tugend, es ist die philosophische Tugend der gelassenen Aufmerksamkeit auf das Erstaunliche am scheinbar Selbstverständlichen und am unscheinbar Beiläufigen. Dieser Aufmerksamkeit verdankt sich die Intimität – die alles andere als unkritische Intimität – ihrer Kenntnis der Texte, ihr verdankt sich die Disziplin, mit der sie ihre bestimmenden Themen analysieren, und ihr die Distanz zu diesen Texten und Themen – einer Distanz, die an jeder Stelle die Neigung zu Idealisierung, Identifikation oder Verwerfung ernüchtert.
Diese Aufmerksamkeit richtet sich nicht allein auf die Verarbeitung der Formelemente, die Nietzsches Schriften idiomatisiert, sondern gleichzeitig auf diejenigen, die zum sujet seiner Schriften geworden sind und deren Zugehörigkeit zu den »großen Themen« seines Denkens er selber mit Nachdruck betont hat. Klossowski und Blanchot – der erste einer der differenziertesten Nietzsche-Übersetzer, beide Essayisten von hohem Rang und Autoren der großen philosophischen Erzählliteratur der Moderne – diskutieren nicht nur die Form der Parodie, sondern diejenigen Veränderungen, die die Lehre vom Willen zur Macht und von der ewigen Wiederkehr des Gleichen unter der Optik der Parodie, der lächerlichen Entstellung und des gewollten Irrtums in Nietzsches Behandlung dieser Lehre erfährt: sie wird zum Vexierbild einer Lehre, zur Parodie ihrer selbst, zur Parodie einer Parodie, die kein Original mehr zum Vorbild ihrer Entstellungen hat: die literarische Form (der Verformung) ist in den innersten Kern des philosophischen Gedankens gedrungen und hat ihn gespalten; sie diskutieren nicht nur die Form des Fragments, sondern die Notwendigkeit, mit der jede Aspiration aufs System, wenn sie nur redlich ihre eigene Struktur reflektiert, in eine fragmentarische Schrift umschlagen muß, die das System – und den systematischen Anspruch noch jeder einzelnen Aussage – auf eine heterogene Pluralität und auf eine Kontingenz der Rede hin öffnet, die sich der Dialektisierung entzieht. Wie wenig eine Philosophie, die sich als Agentin von Begriffsbewegungen versteht, fähig ist, das gesamte Feld ihrer sprachlichen Formen zu kontrollieren, zeigt Lacoue-Labarthes Analyse von Nietzsches Arbeiten zur Rhetorik nicht weniger deutlich als die psychoanalytischen Anmerkungen es tun, die Pautrat zum Verständnis einer unterdrückten Metapher für den Gedanken der ewigen Wiederkehr beisteuert: eine rhetorische Figur ist nie bloß das Instrument des Willens zur Macht des Begriffs, wenn dieser Wille ihrer bedarf, um allererst Wille zu werden. Der Wille ist machtlos gegen die Drohung, selber zu einer solchen rhetorischen Figur zu werden. Nietzsches Frage nach dem Willen – der als Wille zur Macht immer Wille zur Macht des Willens und also Wille zum Willen sein muß – läßt ihn nie als unbedingtes Subjekt seiner selbst und seiner Wirkungen gelten, sondern stellt die Frage nach seiner Konstitution: nach einer Konstitution, zu deren Bedingungen immer auch das Nicht-Wollen und die Unfähigkeit, das Wollen zu wollen, gehören können. Das heißt aber, daß sich der Wille nie im Stand der Autohomoiosis, nie im Stand einer Wahrheit findet, die in der Korrespondenz mit sich selbst als eigentlicher und ernstgemeinter Rede liegt, sondern daß er nur der Forderung nach einer solchen Wahrheit ausgesetzt sein kann und sich in der Forderung nach Redlichkeit erschöpft. Von ihr zeigt Nancy, daß sie die imperative Wahrheit einer Ethik artikuliert, der keine wertende und also auch keine umwertende Moral entsprechen kann.
Wenn deutsche Leser von Rang, wie Heidegger und Adorno, Nietzsche auf den Höhenkamm der abendländischen Metaphysik oder in den Schatten der untergehenden Aufklärung stellen, so bezweifeln die hier zugänglich gemachten französischen Autoren, daß der philosophiegeschichtliche Ort von Nietzsches Denken überhaupt noch nach der Logik des Gegensatzes zwischen Metaphysik und Nicht-Metaphysik, Aufklärung und Gegenaufklärung bestimmt werden kann. Der Grund für jede derartige Kontrastierung ist nämlich erschüttert, wenn plausibel gemacht werden kann, daß der Wille als Wille zur Macht in seiner Selbstbeziehung nie einfach als Subjekt und Objekt, als Aktivum und Passivum, Gebender und Nehmender auftreten kann, ohne sich einer Bewegung auszusetzen, die sich seiner Kontrolle entzieht. Ein Denken, das die Oppositionslogik der klassischen Metaphysik unterläuft, kann angemessen nicht mehr in Begriffen dieser Logik erfaßt werden. So wenig wie das Denken in Thesen und Antithesen verfängt bei Nietzsche die Frage nach dem Sinn und noch nach dem Sinn von Sein: denn jede Sinnfrage, auch die radikalisierte der fundamental-ontologischen Hermeneutik, bleibt einer vorkritischen Theorie des Sinns verhaftet, solange sie dessen Möglichkeit als gegeben annimmt. Die Logik von Gabe und Annahme des Sinns wird aber von Nietzsche – Derrida zeigt es an seinem ›Bild‹ der Frau – durch eine supplementäre Logik des Anscheins, der Schauspielerei und der Mehrsinnigkeit unterhöhlt, die die Gegebenheit des Sinns problematisch und seine Annahme zu einer hermeneutischen Subreption macht.
Die hier vorgelegten Essays führen das Denken von Sprache und Sein an eine Grenze, die von ihm selbst nicht mehr definiert werden kann und die deshalb offen bleibt auf ein Anderes, das nicht einfach das Andere dieses Denkens, nicht das von ihm definierte und per definitionem angeeignete Andere ist. Die Gemeinsamkeit ihres Projekts liegt in dem Versuch, sowohl die klassische Ontologie wie ihre kritischen Umformungen – Fundamentalontologie, Ideologiekritik und Sprachanalyse – auf einen Bereich hin zu öffnen, der von ihnen nicht besetzt werden kann. Klammern sich diese, wenn auch mit letzter Not, an den Glauben, es sei über die Gegebenheit des Sinns und über die angemessene Weise seiner Darstellung eine Entscheidung möglich, so versuchen die hier versammelten Texte – ein jeder mit anderen Mitteln – eine Logik der Unentscheidbarkeit zu entwickeln. Sie dienen keiner Grenzziehung, keiner Definition, keiner Bestimmung; und, wie vor allem Bataille betont, sie dienen nicht. Im Geist der Undienstbarkeit sind sie nicht auf Effekt und Proselytenmacherei angelegt, sondern wie Nietzsches eigene Arbeiten auf die Analyse dessen, was unter den Möglichkeitsbedingungen des Wirkens jede Wirkung suspendiert – und das heißt nicht nur jeden Einfluß, sondern auch jede Deutung und jede Erkenntnis außer Kraft setzt, die einer Wahrheit bloß dient oder eine Wahrheit in Dienst stellt. Wenn das Wirken – und mit ihm das Werk – in einer indefiniten Beziehung zu seiner Herkunft und zu seiner Zukunft: zu seinem Sinn stehen muß, solange Zufälle, Täuschungen und Paradoxien an ihnen beteiligt sein können, dann gibt es keine Wirkung, in der nicht ihre Entwirkung – ihr desœuvrement, wie Blanchot schreibt – am Werk wäre; keine Herkunft und keine Zukunft eines Werks, in der nicht etwas von ihm – und vielleicht das Entscheidende – offen bliebe.