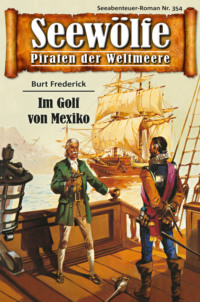Loe raamatut: «Seewölfe - Piraten der Weltmeere 354»
Burt Frederick
Im Golf von Mexiko
Impressum
© 1976/2017 Pabel-Moewig Verlag KG,
Pabel ebook, Rastatt.
eISBN: 978-3-95439-751-8
Internet: www.vpm.de und E-Mail: info@vpm.de
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
1.
Es war einer jener Abende, die eine laue Nacht versprachen. Lichter funkelten überall im Hafen von Vera Cruz. Aus den offenen Türen der Bodegas und Cantinas klangen Gesänge und Gitarrenmusik, Gelächter und heitere Stimmen.
Mancher Seemann und mancher Soldat würde erst am frühen Morgen die Planken seines Schiffes wieder betreten. Vera Cruz war zu einer Stadt herangewachsen, die nach einem entbehrungsreichen Dienst zur See viele Annehmlichkeiten bot. Eine schmucke Ansiedlung, die schon eine Menge davon zeigte, wie es in späteren Jahrzehnten und Jahrhunderten einmal sein würde, wenn man sich in Neuspanien erst richtig eingerichtet hatte.
Don Lurio Spadolin verließ seine Galeone sofort nach dem Festmachen. Begleitet von zwei Offizieren, marschierte er im Eilschritt die Pier entlang. Don Lurio hatte seit der Ankunft in Vera Cruz kaum noch ein Wort geredet, er kochte vor Wut. Die Offiziere kannten ihn und wußten, daß man ihn in diesem Zustand besser nicht ansprach. Deshalb hielten sie wohlweislich einen Schritt Abstand, aber in angespannter Bereitschaft, eiligst auf einen seiner barschen Befehle zu reagieren.
Pechfackeln in mehr als mannshohen Stangenkörben loderten überall an den Piers und auch am Kai, wo ein breites Steinpflaster nach europäischer Art bis hin zu den Häusern reichte. Dort befanden sich die Schenken, in denen sich das beginnende Nachtleben entfaltete. Die Geschäftsräume der Schiffsausrüster und Handwerker und die Dienststellen der königlichen spanischen Beamten waren dagegen samt und sonders verdunkelt.
Don Lurio schwenkte nach links auf den Kai, und die Offiziere hatten Mühe, sein Marschtempo mitzuhalten. Gönnten sie sich auch einen verstohlenen Seitenblick zu den Verlockungen der Nacht, so verzog ihr Kapitän nur verächtlich das Gesicht. Die glutäugigen Hafenmädchen, die im Lichtschein der offenen Türen herausfordernd ihre Reize zur Schau stellten, waren nach Don Lurios Meinung nichts weiter als ein Zeitvertreib für Mannschaftsdienstgrade, ein notwendiges Übel, das man dulden mußte, um die Kerle dann im Dienst besser unter Kontrolle halten zu können.
Für einen Offizier dagegen war es nach Don Lurios Ansicht völlig absurd, in solche Niederungen männlicher Vergnügungssucht hinabzusteigen. Offiziere hatten ihre Freizeit gewissermaßen auf höherer Ebene auszufüllen. Sie vergnügten sich nicht mit den billigen Hafendirnen, die noch dazu überwiegend indianischer Herkunft waren. Für die Señores von Rang und Namen gab es in Hafenstädten wie Vera Cruz bereits ausgesuchte Etablissements, in denen man – seinem Offiziersstatus entsprechend – von reinblütigen Spanierinnen auf hohem Niveau unterhalten wurde.
Schielten Offiziere gelegentlich doch einmal nach den Indianermädchen im Hafen, dann war der Reiz des Unerlaubten die Ursache. Und sie hüteten sich, daß ein Mann wie Don Lurio etwas von solchen Seitenblicken bemerkte.
Die eilige kleine Marschformation erreichte die Nachbarpier, an der die Kriegsgaleone „Santa Rosa“ vertäut lag. Als Don Lurio und seine beiden. Begleiter vor der Stelling stehenblieben, erschien ein Posten mit Helm und schimmerndem Brustpanzer in der Pforte des Schanzkleids. Die Deckslaternen der Galeone spendeten ausreichende Helligkeit.
„Soldat!“ rief Don Lurio scharf. „Melden Sie mich Ihrem Kapitän, Don Francisco de Albrandes. Mein Name ist Don Lurio Spadolin. Ich verlange eine sofortige Unterredung.“
Der Posten salutierte, vollführte eine Kehrtwendung, und seine Schritte dröhnten auf den Decksplanken.
Don Lurio trat ungeduldig von einem Bein auf das andere. Einen Augenblick später begann er, vor der Stelling auf und ab zu gehen wie ein gereizter Tiger. Am liebsten wäre er schnaubend an Bord gestürmt und hätte Don Francisco am Kragen gepackt. Doch die Offiziersehre, die ihm gebot, sich an die Formen zu halten, war stärker.
Endlich, nach langen Minuten, kehrte der Posten zurück.
„Don Francisco bittet Sie, sich an Bord zu begeben, Capitán.“
„Wurde auch Zeit“, sagte Don Lurio knurrend und stapfte die Stelling hinauf. Seinen beiden Begleitern gebot er, auf der Kuhl zu warten. Unter der Führung des Postens begab er sich zum offenen Schott der Achterdeckskammern, wo der warme Lichtschein von Öllampen zu sehen war.
Die Kapitänskammer der „Santa Rosa“ war einfach und zweckmäßig ausgestattet, wie es der Funktion einer Kriegsgaleone entsprach. Don Lurio registrierte es mit einem Hauch von besänftigender Anerkennung. Er gehörte zu jenen, die übertriebenen Luxus an Bord eines Kriegsschiffes für unnötig hielten. Offenbar befand er sich in diesem Punkt mit Don Francisco auf einer Linie.
Der Kapitän der „Santa Rosa“ hatte sich in der Offiziersmesse aufgehalten und war einen Moment später zur Stelle, nachdem Don Lurio die Kapitänskammer eben betreten hatte. Don Francisco trug volle Montur, trotz der späten Stunde. Er sah übermüdet aus, Ränder lagen unter seinen Augen. Jedermann wußte, welche mörderischen Strapazen der Hurrikan verursacht hatte, der vor einer Woche über den Golf von Mexiko gerast war. Die „Santa Rosa“, das hatte Don Lurio beim Betreten des Schiffes mit einem einzigen Blick festgestellt, war fraglos von dem Sturm arg beschädigt worden. Man hatte die Galeone einigermaßen instand gesetzt, doch längst nicht alle Schäden waren behoben.
Nun, das änderte nichts an den Ungeheuerlichkeiten, die es vorrangig zu klären galt.
„Ich freue mich, Sie an Bord meines Schiffes begrüßen zu dürfen“, sagte Don Francisco förmlich, doch es klang ehrlich.
„Die Freude ist nicht meinerseits“, entgegnete Don Lurio schroff, „und ich muß Sie dringend bitten, mich nicht mit Redensarten abzuspeisen.“
Don Francisco erstarrte. Von einem Atemzug zum anderen verlor sich die Freundlichkeit aus seinen Gesichtszügen.
„Don Lurio“, sagte er fassungslos, „was, in aller Welt, berechtigt Sie, mir gegenüber einen solchen Ton anzuschlagen?“
Spadolins Gesicht verzerrte sich, als hätte er in eine Zitrone gebissen. Seine Stimme war kalt wie Eis.
„Fangen Sie nicht an, den Scheinheiligen zu spielen, Don Francisco. Können Sie sich wirklich nicht erklären, warum ich mit einem Verband von zwei Kriegsgaleonen und einer Frachtgaleone nach Vera Cruz zurückkehre – nachdem wir erst vor ein paar Tagen ausgelaufen sind?“
Don Francisco de Albrandes lief rot an.
„Ich weiß nicht, wovon Sie reden und auf was Sie anspielen“, entgegnete er mit mühsam erzwungener Beherrschung. „Ich habe wahrhaftig genug mit meinen eigenen Problemen zu tun. Ehrlich gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob ich Ihr beleidigendes Auftreten an Bord meines Schiffes hinnehmen werde.“
„Ha!“ rief Don Lurio, und es klang wie ein Bellen. „Seien Sie froh, daß ich nicht gleich mit einem Trupp Soldaten erschienen bin, um Sie festnehmen zu lassen. Aber leider hat es eine Verzögerung gegeben, da wir unterwegs mit einem Ruderschaden unserer Fracht-Galeone fertigwerden mußten.“
Don Francisco erbleichte. Er verkrampfte die Hände auf dem Rücken, daß die Fingerknöchel weiß hervortraten. Deutlich war zu sehen, daß er vor Zorn zitterte, als er auf das bleiverglaste Fenster der Kapitänskammer zutrat und einen Moment scheinbar angespannt auf das nachtdunkle Hafenbecken hinausstarrte. Dann wandte er sich mit einem Ruck um.
„Hören Sie, Don Lurio“, sagte er schneidend, „es ist mir ein Rätsel, was Sie mir vorzuwerfen haben. Entweder äußern Sie sich sofort klar und unmißverständlich, oder ich sehe mich gezwungen, wegen Verletzung meiner Offiziersehre Genugtuung zu fordern.“
Don Lurio Spadolin stutzte, ließ sich aber nichts davon anmerken. Wenn er ehrlich war, reagierte Don Francisco nicht wie jemand, der ein schlechtes Gewissen hatte. Andererseits mochte sein Verhalten aber ein Schutzschild sein, den er gegen zu erwartende Vorwürfe dieser Art aufgebaut hatte.
„Also gut“, sagte Don Lurio mit unverminderter Bissigkeit, „da Sie nicht verstehen wollen, muß ich Ihnen wohl auf die Sprünge helfen. Meine Order lautete, die Mine bei Punta Roca Partida anzulaufen und die Frachtgaleone mit Goldbarren beladen zu lassen, um sie dann nach Havanna zu geleiten. Dort soll ein Konvoi für die Weiterverschiffung einer größeren Partie ins Mutterland zusammengestellt werden.“
„Prozeduren dieser Art sind mir geläufig“, entgegnete Don Francisco wütend, „ich sehe nicht, was daran ungewöhnlich ist.“
„Wie ich schon sagte: Das Ungewöhnliche ist meine Rückkehr nach Vera Cruz. Mir scheint, Sie wollen einfach nicht verstehen, verehrter Don Francisco. Das Gold, das ich bei Punta Roca Partida übernehmen sollte, war nicht mehr vorhanden.“ Don Lurio hielt inne und wartete die Wirkung seiner Worte ab.
Don Franciscos Kinn sackte herab, und es hatte den Anschein, als würde er den Mund nicht wieder schließen können.
„Soll das heißen“, sagte er tonlos, „Sie bringen mich mit diesem Umstand in Zusammenhang?“
„Nicht ich“, entgegnete Don Lurio mit unverhohlenem Hohn. „Costa Cordes, der Kommandant der Goldmine, hat mir klar und deutlich mitgeteilt, Sie, Don Francisco, hätten das für Havanna bestimmte Gold an Bord Ihrer Galeone ‚Santa Rosa‘ mannen lassen. Costa Cordes sagte, er sei machtlos gegen diese Anordnung gewesen, was ich natürlich begreife. Rechnen Sie es meinem Anstand und dem Verbundenheitsgefühl von Offizier zu Offizier zu, daß ich Sie zunächst zu einer persönlichen Unterredung aufgesucht habe, ehe ich weitere Schritte unternehme.“
Don Francisco brachte nicht sofort eine Antwort heraus, er konnte nur entgeistert den Kopf schütteln. Mit unsicheren Schritten ging er zum Tisch und setzte sich auf einen der Sessel.
„Das ist ungeheuerlich“, sagte er schweratmend, „einfach ungeheuerlich! Ich weiß nicht, was in diesen Costa Cordes gefahren ist, daß er sich zu einer solchen Anschuldigung versteigt.“ Er hob den Kopf und sah seinen späten Besucher an. „Ich kann jetzt verstehen, daß Sie aufgebracht sind, Don Lurio. Ich an Ihrer Stelle hätte nicht anders reagiert. Aber Sie hätten mir gleich zu Anfang sagen sollen, um was es geht.“
Don Lurio stutzte erneut. Irritiert musterte er den Kapitän der „Santa Rosa“. Dann gab er sich einen Ruck, zog sich einen Schemel heran und setzte sich ihm gegenüber.
„Bei unserer gemeinsamen Offiziersehre – sagen Sie mir die Wahrheit.“
„Ich habe keinen Grund, sie zu verschweigen, Don Lurio. Es war so: Meine Order lautete, drei gefangene Engländer von Havanna nach Vera Cruz zu bringen, die hier vor Gericht gestellt werden sollen. Die drei befinden sich übrigens noch an Bord, weil ich sie erst morgen vormittag bei Dienstbeginn den örtlichen Behörden ausliefern kann.“
„Weiter“, drängte Don Lurio, „zur Sache.“
„Wir gerieten in den Hurrikan. Ich hatte hohe Verluste in der Mannschaft und bei den Soldaten an Bord. Außerdem wurde das Schiff stark beschädigt. Nun, wir haben die schlimmsten Schäden mit Bordmitteln behoben. Da uns der Sturm bis vor Punta Roca Partida verschlagen hatte, lief ich kurzerhand den Stützpunkt bei der Goldmine an und rekrutierte zwangsweise zwanzig Soldaten aus der Truppe des Kommandanten Costa Cordes. Ich hatte keine andere Wahl, wenn ich meinen Auftrag ausführen wollte, die Gefangenen nach Vera Cruz zu bringen. Das Schiff war hoffnungslos unterbemannt. Also: Ich habe die zwanzig Mann an Bord genommen und die Reise nach Vera Cruz unverzüglich fortgesetzt.“
„Das ist alles?“ erwiderte Don Lurio ungläubig.
„Nicht ganz. Ich habe Costa Cordes versprochen, ihm die zwanzig Soldaten zurückzubringen, sobald ich wieder über die erforderliche Sollstärke an Mannschaften verfüge. In Vera Cruz dürfte es keine Schwierigkeit sein, neue Decksleute anzumustern. Das ist die ganze Geschichte. Wenn Sie mir nicht glauben, gebe ich Ihnen Genehmigung, das Schiff vom Kielschwein bis zu den Toppen zu durchsuchen.“
Don Lurio schnitt energisch mit der flachen Hand durch die Luft.
„Nicht nötig, Don Francisco. Ihr Wort als Offizier genügt mir.“ Er legte die Unterarme auf den Tisch und beugte sich vor. „Wenn ich alles zusammenreime, sieht es so aus, als ob wir es mit einer Riesenschweinerei zu tun haben. Verzeihen Sie den Ausdruck, aber anders kann man das wohl nicht bezeichnen.“
De Albrandes atmete scharf aus. Er konnte nur immer wieder den Kopf schütteln. Schließlich stützte er sich mit beiden Händen auf den Tisch und erhob sich schwerfällig, wie nach einer enormen körperlichen Anstrengung.
„Auf diesen Schreck“, sagte er, „erlaube ich mir, Ihnen ein Glas Rio ja anzubieten.“
Don Lurio nickte. Er fühlte sich erleichtert. Eine Anschuldigung gegen einen Offizierskameraden vorbringen zu müssen, ging auch ihm nicht ohne weiteres über die Zunge – noch dazu, wenn dieser Offizier vom gleichen Rang war wie er selbst.
Don Francisco brachte zwei einfache Gläser und einen Krug aus dem Schapp herüber, stellte die Gläser auf den Tisch und goß den rubinroten Wein ein.
„Ich bin froh“, sagte Don Lurio, „daß der Vorwurf zunächst einmal ausgeräumt ist. Es wäre eine unerträgliche Situation gewesen. Auch für mich, das können Sie mir glauben.“ Er nahm das Glas entgegen, das Don Francisco ihm zuschob.
Die beiden Männer prosteten sich zu.
„Trotzdem bleibt die entscheidende Frage offen“, sagte Don Francisco gedehnt.
„Ich weiß, ich weiß.“ Don Lurio nickte und stellte sein Glas ab. „Sie brauchen nichts zu sagen. Mich bewegen die gleichen Gedanken wie Sie. Wie, in aller Welt, kommt Costa Cordes dazu, eine so ungeheure Anschuldigung zu erheben?“
„Ich möchte es nicht aussprechen.“ Don Francisco preßte die Lippen aufeinander.
„Dann tue ich es für Sie.“ Don Lurio schob die Hände auf den Tisch und ballte sie zu Fäusten. „Es gibt nur eine einzige denkbare Erklärung: Costa Cordes ist auf die Wahnsinnsidee verfallen, das Gold für sich selbst auf die Seite zu schaffen. Aber ich schwöre Ihnen, Don Francisco, wenn es so sein sollte, dann wird er das bitter bereuen.“
„Ich verstehe das nicht“, sagte Don Francisco kopfschüttelnd, „soweit mir bekannt ist, hat Costa Cordes einen ausgezeichneten Ruf als pflichttreuer und zuverlässiger Mann. Er muß sich doch darüber im klaren sein, welche Riesendummheit er begangen hat.“
Don Lurio lachte leise.
„Das Gold hat schon manchem den Kopf verdreht. Ich will den Teufel nicht an die Wand malen. Aber wenn es sich tatsächlich so verhalten sollte, dann muß dieser saubere Kommandant schleunigst seines Postens enthoben werden.“
„Was schlagen Sie vor?“
Don Lurio leerte sein Glas und stellte es mit einer abrupten Bewegung wieder auf den Tisch.
„Wir müssen sofort nach Punta Roca Partida auslaufen. Das heißt, die Frachtgaleone wird vorläufig hier im Hafen bleiben, bis die Dinge geklärt sind. Außerdem würde sie uns nur behindern, da wir keine Zeit verlieren dürfen. Sie allerdings, Don Francisco, brauche ich unbedingt als Zeugen. Ist Ihr Schiff ausreichend seetüchtig?“
„Das schon. Nur – was wird aus den Gefangenen?“
„Sind sie an Bord nicht sicher untergebracht?“
„Doch, selbstverständlich. Wir haben sie gefesselt und in die Vorpiek gesperrt.“
„Ausgezeichnet. Dann bleiben sie an Bord. Unsere Aufgabe, eine mögliche Unterschlagung größten Stils aufzudecken, ist jetzt wichtiger als alles andere. Außerdem können Sie nach Klärung der Dinge sofort nach Vera Cruz zurücksegeln.“
„Einverstanden“, erwiderte Don Francisco bereitwillig. „Die zwanzig Soldaten aus der Mine werde ich dann eben auch später auswechseln.“
Die beiden Kapitäne verloren keine Zeit. Don Lurio begab sich sofort zurück auf seine eigene Galeone, während Don Francisco bereits Befehl gab, die „Santa Rosa“ seeklar zu machen.
Bereits eine Stunde später hatten die drei Kriegsgaleonen den Hafen von Vera Cruz verlassen und segelten unter Vollzeug mit Kurs auf Punta Roca Partida.
Die Mannschaftsdienstgrade an Bord aller drei Schiffe schickten geheime Flüche in den Nachthimmel. Jene, die sich nicht in Bereitschaft an Bord befunden hatten, waren von Suchtrupps in den Bodegas zusammengetrommelt worden. Keiner von ihnen hatte gewagt, sich der Order von Don Francisco und Don Lurio zu widersetzen. In einer Stadt wie Vera Cruz war der Arm der Obrigkeit allumfassend. Man konnte sich nicht damit herausreden, von dem Einsatzbefehl nichts gewußt zu haben.
Wenn es auch noch so geschmerzt hatte – die meisten der Decksleute und Seesoldaten hatten es vorgezogen, ihre gerade begonnenen Tändeleien schleunigst zu unterbrechen. Die deutlichen Schnapsfahnen, mit denen sie an Bord erschienen, verzieh man ihnen. Ein Fortbleiben hätte indessen üble Folgen gehabt. Meuterer erwartete in Neuspanien nicht unbedingt die Todesstrafe. Aber die Fronarbeit in den Gold- und Silberminen konnte grausamer sein als ein gnädiger Tod.
Don Lurio Spadolin und Don Francisco de Albrandes pflegten unterdessen auf ihren Achterdecks ihren Grimm. Obwohl die Galeonen bereits rauschende Fahrt liefen, hätten sie gern noch ein paar Segel mehr gehabt, um so schnell wie irgend möglich ihr Ziel zu erreichen.
Don Julio Costa Cordes mußte total verrückt geworden sein. Anders war sein sonderbares Verhalten nicht zu erklären.
2.
Der beginnende neue Tag kündigte sich mit glühendem Rot an, das über der östlichen Kimm des Golfes von Mexiko aufstieg. Sehr rasch stieg der Feuerball der Sonne höher und sandte sein strahlendes Licht von einem wolkenlosen Himmel auf die nur spärlich gekräuselten Fluten hinunter.
An diesem Morgen des 26. September 1593 war in der Goldmine von Punta Roca Partida die Entscheidung bereits gefallen.
Das frühe Sonnenlicht begleitete zwei höchst ungleiche Schiffe auf ihrem Weg. Noch bei Dunkelheit hatte Old Donegal Daniel O’Flynn die Segel setzen lassen. Das war in jener kleinen Bucht gewesen, die sich etwa eine halbe Meile nordwestlich von der spanischen Mine befand.
Im Verband mit der „Isabella IX.“ mutete die „Vergulde Sonne“ wie ein Zwerg an. Die dreimastige Galeone der holländischen Piraten hatte ein Registergewicht von etwas mehr als dreihundert Tonnen. Dagegen wirkte die „Isabella“ mit ihren 550 Tonnen fast gigantisch.
Entsprechend eingeschüchtert war der kleine Haufen der Piraten gewesen, als die mächtige Galeone der Seewölfe plötzlich vor der Bucht aufgetaucht war. Die holländischen Schnapphähne hatten keinen Widerstand geleistet, zumal sich auch die Mehrzahl ihrer Kumpane in der Mine befand und längst außer Gefecht gesetzt worden war.
Nun war es ein Prisenkommando der Arwenacks, das laut Anweisung des alten O’Flynn auf der „Vergulde Sonne“ das Regiment führte. Länger als ein paar Stunden hatten sich die Holländer an dem in der Mine erbeuteten Reichtum nicht erfreuen können.
Old Donegal reckte sein Faltengesicht in den frischen Morgenwind und grinste der aufgehenden Sonne entgegen. Die Piratengaleone hatte nicht viel von dieser Sonne, mit deren Namen sie sich prahlerisch schmückte. Jetzt sah der Dreimaster eher klein und häßlich aus, ein Abbild der Niederlage, die die Piraten erlitten hatten.
Natürlich hatte auch dies für den alten Mann einen geheimnisvollen Hintergrund. Doch er behielt es für sich. Sein Wissen den Arwenacks mitzuteilen, hätte für ihn bedeutet, Perlen vor die Säue zu werfen. Verdammt, nein, sie hatten es nicht länger verdient, von ihm über Unerklärliches aufgeklärt zu werden. Bei ihnen war er als Spinner verschrien, als einer, der nur zu gern Gespenster sah und Gruselgeschichten erzählte.
Doch wenn sie ihn auch nicht ernst nahmen, so beharrte er doch auf seiner Meinung, daß es zwischen Himmel und Erde Dinge gab, für die alle Intelligenz der armseligen Menschheit nun einmal nicht ausreichte.
Was die holländischen Galgenstricke und ihren Dreimaster betraf, so lagen die Dinge für Old Donegal Daniel O’Flynn indessen ziemlich klar auf der Hand. Diesen lächerlichen Dreimaster mit der goldenen Sonne zu vergleichen, war mehr als Vermessenheit. So etwas grenzte an Frevel. Klar, daß sich auch die geheimnisvollen Mächte, die die Naturgewalten beherrschten, nicht unbegrenzt herausfordern ließen.
Eben drum war den Holländer-Lümmeln diese Niederlage beschert worden, gewissermaßen als Rache der Natur für die Unverfrorenheit, mit der sie ihr Schiff getauft hatten. So etwas konnte nach Old Donegals Meinung nicht gutgehen. Schiffe segelten nur dann unter einem guten Stern, wenn sie einen Frauennamen trugen – wie die „Isabella“. Daran gab es nichts zu rütteln.
Mit mäßiger Fahrt glitten die beiden Galeonen auf die Bucht zu, die der Goldmine von Punta Roca Partida als natürlicher Hafen diente. Die Befehlsstimme des alten O’Flynn dröhnte über die Decks, als er Order gab, die letzten Segel wegzunehmen.
Zum ersten Male erblickten die Männer die Mine und ihre Umgebung bei Tageslicht. Unmittelbar an die Bucht grenzend, erhoben sich mächtige Felsen, die vulkanischen Ursprungs waren. Schwarz gähnten die. Löcher der Stolleneingänge. Den Hütten und Baracken des Lagers war anzusehen, daß man hier nicht für die Ewigkeit gebaut hatte. Das galt auch für die Gießerei, in der das geförderte Gold in aller Eile zu Barren eingeschmolzen wurde.
Die Dons hatten nur ein einziges Ziel im Sinn: So schnell wie möglich so viel Reichtum wie möglich an sich zu raffen. Da interessierte es nicht, ob die bedauernswerten Sklaven menschenwürdig untergebracht waren. Da spielte es keine Rolle, wenn die tropische Fäulnis schon nach wenigen Monaten durch die Bretterwände drang.
Hauptsache, sie sackten das Gold ein, ohne viel Zeit zu verlieren.
Old Donegal grinste bei dem Gedanken. Hölle und Teufel, wieviel von all dem schönen Gold hatten sie den Dons schon weggeschnappt! Und Englands königliche Lissy hatte ihnen sogar den Auftrag dazu gegeben – mit Brief und Siegel. Als Freibeuter, mit einem offiziellen Kaperbrief ausgestattet, hatte Philip Hasard Killigrew das Recht, den Spaniern zu schaden, wo er nur konnte.
Denn England und auch andere Nationen hatten kein geringeres Recht auf ihren Anteil an der Neuen Welt als Spanien. Außerdem war das, was König Philipp in Neuspanien betrieb, schlicht und einfach ein systematisches Ausplündern. Die Ureinwohner dieses Landes waren entrechtet, in ihrem eigenen Land mußten sie als Sklaven für die fremden Herren aus der Alten Welt schuften, eine Tatsache, die Männern wie dem Seewolf und seinen Gefährten in höchstem Maße zuwider war.
Der alte O’Flynn ließ die beiden Galeonen in der Bucht vor Anker gehen und preite das Prisenkommando auf der „Vergulde Sonne“ an. Er brauchte das Beiboot der Holländer, um an Land zu gehen. Beide Jollen der „Isabella“ waren für das nächtliche Kommandounternehmen verwendet worden, das die Arwenacks so erfolgreich zu Ende gebracht hatten.
Oberhalb der Bucht, auf dem Felsengelände der Mine, hatte sich eifrige Betriebsamkeit entfaltet.
Edwin Carberry, Ferris Tucker und die anderen trieben die restlichen Gefangenen auf dem Platz vor den Hütten zusammen. Die Holländer trugen noch die Brustpanzer und Kürbishosen, die sie den spanischen Soldaten abgeknöpft hatten. Alle waren bereits gefesselt worden, etliche hatten im Kampf Schrammen und Beulen und auch einige handfestere Verwundungen davongetragen. Willig trabten sie auf den Vorplatz, in ihren niedergeschlagenen Mienen gab es nicht mehr den geringsten Hauch von Widerstandswillen, eher furchtsamen Respekt.
Denn die Donnerstimme Ed Carberrys fuhr ihnen mächtig in die Knochen.
„Bewegt euch gefälligst, ihr Schlickratten! Hurtig, hurtig, oder ich ziehe euch das Fell in Streifen von euren verdammten Affenärschen! Schlaft nicht ein, sonst kitzle ich euch mit der Neunschwänzigen wach!“
So und ähnlich ging es pausenlos, und Jan Ledeburs niedergeschmetterte Strolche duckten sich bei jeder neuen Freundlichkeit wie unter einem Hieb. Die simplen Naturen unter ihnen fürchteten allen Ernstes, daß man ihnen das Fell über die Ohren zog und es wahrhaftig zu Streifen verarbeitete.
Die Arwenacks konnten unterdessen nur grinsen. Was ihr Profos, dieser Klotz von einem Kerl, da fortwährend vom Stapel ließ, waren in ihren Ohren wohlvertraute Töne. Einem, der das noch nicht kannte, mußte es allerdings einen Schauer über den Rücken treiben.
Der Seewolf ließ die Männer mit den Gefangenen allein und begab sich hinüber in die Gießerei. Dort hatte Big Old Shane damit begonnen, die Sklaven von ihren Ketten zu befreien. Batuti half ihm und spielte den Dolmetscher, zumindest was die schwarzhäutigen unter den Sklaven betraf. Werkzeug hatte der Schmied von Arwenack in ausreichender Zahl und Qualität vorgefunden.
Mit hellem Klang hallten die Hammerschläge. Das Gebäude war noch von der Hitze der Schmelzöfen erfüllt. Denn Ledebur hatte aus der Gießerei herauszuholen versucht, was herauszuholen war. Er hatte sich nicht damit begnügt, jenes Gold zu rauben, das bereits in Barren geschmolzen war. So viel wie möglich hatte er auch von dem vorhandenen rohen Edelmetall einschmelzen lassen wollen.
Dabei hatten Ledebur und seine Leute die Sklaven zu einer mörderischen Schinderei angetrieben. Schlimmer als Tiere waren die Indianer und die Schwarzen behandelt worden. Batuti hatte es am eigenen Leib miterlebt, als er sich unter die dunkelhäutigen Sklaven gemischt hatte.
In fast andächtiger Stille hatten sich die Sklaven in der Gießerei versammelt. Einer nach dem anderen trat vor, um sich am Amboß von den Ketten befreien zu lassen. Shane führte Hammer und Meißel mit sicherer Hand. Meist schon nach dem ersten oder zweiten Schlag zersprang das Kettenglied, das er sich vorgenommen hatte.
„Wie geht es voran?“ erkundigte sich Hasard.
Big Old Shane blickte nur kurz auf.
„Eine Stunde werden wir noch brauchen.“
„Mehr als ein Drittel haben wir noch nicht geschafft“, fügte Batuti hinzu und deutete mit einer Kopfbewegung auf die Reihen der Wartenden. Er unterstützte den Schmied von Arwenack, indem er den Sklaven half, die Ketten richtig auf dem Amboß zu plazieren.
Shane konnte dadurch ohne große Unterbrechung seine Hammerschläge anbringen.
„In Ordnung“, sagte der Seewolf und nickte. „Sobald wir draußen Klarheit haben, schicke ich euch Verstärkung.“
Er wollte sich abwenden. Doch da war etwas, das ihn noch einen Moment verharren ließ. Waren es die vielen Gesichter, die ihm zugewandt waren? Der Ausdruck dieser vielen Augenpaare?
Tasuta katkend on lõppenud.