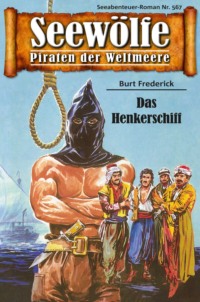Loe raamatut: «Seewölfe - Piraten der Weltmeere 567»
Impressum
© 1976/2019 Pabel-Moewig Verlag KG,
Pabel ebook, Rastatt.
eISBN: 978-3-95439-974-1
Internet: www.vpm.de und E-Mail: info@vpm.de
Burt Frederick
Das Henkerschiff
Auf der Insel Lesbos regiert nackte Gewalt
Ein sanfter Nachtwind strich über die Bucht.
Die Männer hatten das Boot auf den weißen Strand gezogen. Sie warteten dort, wie Stavros Kyriaki es ihnen befohlen hatte.
Im Dunkeln, unter dem grünen Dach einer mächtigen Zeder, strich er sanft über Larisas Haar. Sie schmiegte sich an ihn und versuchte, so zärtlich zu sein wie stets.
Doch er spürte ihre innere Unruhe. „Wovor hast du Angst?“ fragte er leise.
Sie erschrak wie ein kleines Mädchen, das bei etwas Verbotenem ertappt wurde.
„Es ist nichts“, erwiderte sie rasch und vermied es, ihn anzusehen. „Es ist gar nichts …“
Die Hauptpersonen des Romans:
Stavros Kyriaki – der junge Grieche kämpft gegen die Türken-Herrschaft und hat nicht viele Chancen.
Larisa Zarai – seine Verlobte wird gefangengenommen und erhält ein verführerisches Angebot.
Hatip Bayindir – der Türke hat etwas merkwürdige Vorstellungen, um sich und weitere Fettsäcke zu belustigen.
Edmundo Rojo – der Mann aus Sizilien reist von Hafen zu Hafen und ist im Gewerbe eines Scharfrichters tätig.
Cara Rojo – seine Tochter wirft ein Auge auf Dan O’Flynn, aber der hält sich zurück.
Philip Hasard Killigrew – dem Seewolf gelingt es, nicht an zwei Fronten kämpfen zu müssen.
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
1.
„Im Schwindeln bist du wahrhaftig keine Meisterin“, sagte er kopfschüttelnd. „Wenn das, was dich bedrückt, irgend etwas mit mir zu tun hat, solltest du es mir sagen. Bislang haben wir nie etwas voreinander verheimlicht. Ich finde, dabei sollte es auch bleiben.“
Sie blickte aus ihren großen dunklen Augen zu ihm auf.
Er bewunderte ihre Schönheit, während sie nach Worten suchte. Vor dem Hintergrund des silbernen Mondlichts, das den Strand schimmern ließ, sah Larisa Zarai aus wie eine griechische Göttin. Sie trug die einfache Leinenkleidung der Landbevölkerung von Lesbos. Doch selbst wenn sie Lumpen angehabt hätte, wäre das Ebenmaß ihrer Statur und ihrer Gesichtszüge dadurch nicht beeinträchtigt worden. Ihr Haar glänzte wie schwarze Seide. Es fiel in sanften Wogen und umschmeichelte ihre Schultern.
„Ich habe große Angst“, gestand sie und senkte den Kopf. „Aber das ist es nicht allein. Ich könnte die Angst wahrscheinlich ertragen, wenn ich nicht – nicht die Sorge hätte, daß diese Angst stärker wird als meine Liebe zu dir.“
„Was willst du damit sagen?“ Er runzelte die Stirn.
„Ich fürchte mich, zu unserem Treffpunkt zu kommen.“ Sie deutete auf das Dickicht, das oberhalb des von Felsen durchsetzten Uferbereichs begann. „Ich spüre, daß wir beobachtet werden, Stavros. Jemand belauert uns. Jemand, der es vor allem auf dich abgesehen hat.“
„Liebes“, sagte er sanft und schloß seine Arme fester um sie. „Du brauchst dir nicht den Kopf darüber zu zerbrechen. Ich lebe in ständiger Gefahr. Es kann mir jederzeit passieren, daß mir jemand auflauert. Daran wird sich nichts ändern, solange ich gemeinsam mit unseren Landsleuten für die Freiheit kämpfe.“
„Heute abend ist es anders“, erwiderte sie. „Ich habe ein merkwürdiges Gefühl. Ich wollte nicht darüber sprechen, um dich nicht zu beunruhigen. Nun hast du mich dazu gezwungen.“
Er lächelte. „Es tut mir nicht einmal leid. Sag mir mehr über dieses merkwürdige Gefühl.“
„Du lachst über mich?“
„Aber nein. Ich nehme dich ernst. Frauen spüren manchmal Dinge, von denen wir Männer nichts ahnen.“
Sie löste sich ein kleines Stück von ihm und schlang die Arme um seinen Nacken. „Es ist einfach nur ein Gefühl. Ich weiß, daß eine Gefahr da ist. Aber wenn du bei mir bist und mich festhältst, bedeutet es kaum noch etwas für mich. Dann läßt meine Angst nach.“
„Ich glaube, ich ahne, auf was du hinauswillst“, entgegnete er und tippte ihr sanft mit dem Zeigefinger auf die Nase. „Möchtest du mich langsam und sorgfältig darauf vorbereiten?“
„Stavros!“ rief sie mit leiser Empörung. „Sei nicht ungerecht. Ich habe nicht davon angefangen, diesmal nicht.“
„Aber du würdest es am liebsten tun, nicht wahr?“
„Natürlich, das weißt du.“
„Also doch.“
„Nein. Es hat nicht das geringste mit dieser Beklemmung zu tun, die ich heute abend empfinde.“
Er lachte leise. „Aber deine bösen Angstgefühle passen gut zum Thema.“
„Und wenn es so wäre?“ entgegnete sie trotzig. „Ich habe nie verhehlt, daß ich für immer bei dir sein möchte. Dabei habe ich mich nicht einmal aufgedrängt. Du hast mich zuerst gefragt, ob ich deine Frau werden will.“
„Wenn alles vorbei ist. Wenn bessere Zeiten für uns. Griechen eingekehrt sind.“
„Das werden wir vielleicht nicht mehr erleben. Ich kann nicht so lange warten. Ich bin bereit, meine Eltern zu verlassen und für immer bei dir zu bleiben.“
„Ausgeschlossen“, sagte er rauh. Es fiel ihm schwer, ihr wehzutun. Aber es ging nicht anders. „In unserem Lager gibt es keine Frauen. Du wärest die erste. Bevor das überhaupt möglich wäre, müßte ich versuchen, einen Mehrheitsbeschluß zu brechen. Dann hätten die anderen auch die gleichen Rechte wie ich. Mit der Disziplin wäre es …“
„Stavros“, fiel sie ihm ins Wort. „Ich kenne alle deine Argumente. Wenn du wirklich wolltest, würdest du einen Weg finden. Es ist so, daß ich mein Leben für immer sinnloser halte. Du lebst für deinen Kampf gegen den Tyrannen. Ich lebe für unsere heimlichen Treffen. Manchmal sehen wir uns tagelang nicht. Das ist schwer zu ertragen.“
„Für mich auch.“
„Dann ändere etwas daran. Du hast es in der Hand.“
„Ich kann nicht allein entscheiden. Das mußt du verstehen. Außerdem – was würden deine Eltern dazu sagen?“
„Sie haben nichts dagegen einzuwenden. Ich habe schon mit ihnen gesprochen.“
„Was?“ Er sah sie ungläubig an.
„Ja, es ist wahr. Gerade heute habe ich mit ihnen gesprochen. Sie sind verständnisvolle Menschen, das weißt du. Andere in unserem Alter, so sagen sie, sind längst verheiratet. Einer jungen Frau trägt es einen schlechten Ruf ein, wenn sie mit zwanzig Jahren immer noch nicht verheiratet ist. Wie ich.“
„Larisa, jetzt wirst du ungerecht. In unserem Fall verhält sich alles etwas anders. Ich habe mir vorgenommen, die Schreckensherrschaft Hatip Bayindirs zu bekämpfen und zu brechen, damit alle Griechen auf Lesbos nicht länger von den Türken geknechtet werden. Für ein solches Ziel muß man Opfer bringen, das mußt du doch einsehen.“
Sie hauchte ihm einen Kuß auf die Lippen. „Meistens sehe ich es auch ein, das weißt du. Aber manchmal fällt es mir eben sehr schwer. So wie heute. Es liegt wohl an dieser Angst …“
Er legte ihr den Zeigefinger auf die Lippen.
„Kein Wort mehr“, befahl er mit gespielter Strenge. „Wir drehen uns sonst im Kreis.“ Er küßte sie, und sie sträubte sich nicht.
Er wußte, daß sie im Grunde einer Meinung waren. Ihr sehnlichster Wunsch war auch der seine. Aber Larisa war sich auch darüber im klaren, daß sie seine Argumente nicht mit einer Handbewegung vom Tisch fegen konnte.
Nach einer kurzen Weile verabschiedete sie sich, wie es stets sein mußte, wenn sie sich an dem geheimen Platz in der Bucht trafen. Stavros führte Larisa zum Strand, wo die vier Männer beim Boot warteten.
Sie brachten es zu Wasser und nahmen ihre Plätze auf den Duchten ein. Stavros half Larisa auf die Achterducht. Sie übernahm die Ruderpinne, wie sie das gewohnt war.
Stavros Kyriaki blieb am Strand stehen und blickte dem Boot nach, bis es hinter der nordöstlichen Landzunge verschwand und auf Ostkurs ging. Für Larisa war der Weg zu Wasser einfacher. Der Bauernhof ihrer Eltern befand sich landeinwärts von der übernächsten Bucht.
Die Küstenregion war bergig. Es hätte einen mühevollen und langwierigen Umweg für Larisa bedeutet, zu Lande den Treffpunkt zu erreichen. Denn es war ein geeigneter Ort, weil Bayindirs Schergen aus Mithimna diese unwegsame Region noch nicht unter Kontrolle hatten.
Stavros ging zu seinem Pferd und schwang sich in den Sattel. Obwohl die Gefahr seiner Meinung nach geringer war, als Larisa befürchtete, hatte er die Hufe des Braunen mit Lappen umwickelt.
„Ein Irrlicht“, sagte Old Donegal Daniel O’Flynn überzeugt. „In diesen Breiten rührt es daher, daß der Gehörnte versucht, die Seefahrer auf einen falschen Kurs zu locken. Obwohl sie diese Irrlichter kennen, findet er immer wieder seine Opfer. Ihre Schiffe zerschellen dann an Klippen oder geraten auf Untiefen.“
Ben Brighton, Erster Offizier in der Crew des Seewolfs, hörte grinsend zu. Er hatte den Dienst auf dem Achterdeck der Dubas von Hasard übernommen. Der russische Zweimaster segelte unter Vollzeug. Vor handigem Wind aus westlichen Richtungen lief das aus Eiche gebaute Schiff prächtige Fahrt über Backbordbug. Kurs Südost.
In den frühen Morgenstunden des nächsten Novembertages Anno 1597 würden sie die Insel Lesbos erreichen. Das hatte Dan O’Flynn in seiner Funktion als Navigator ermittelt. Grundlage waren Seekarten, die sie in Istanbul aufgestöbert hatten. Sie wußten daher auch, daß Lesbos zu den ostägäischen Inseln gehörte, die die Türken besetzt hielten.
Pete Ballie stand schweigend am Ruder. Im blassen Mondlicht wirkte er wie ein unerschütterliches Standbild.
Old Donegal war vor einer guten Stunde auf dem Achterdeck erschienen, hatte gesagt, daß er wieder mal nicht schlafen könne, und Ben Brighton hatte es nicht fertiggebracht, ihn einfach wegzuschicken.
So hörte er geduldig den gespenstischen Erläuterungen des Alten zu und gab gelegentlich eine Antwort, während Pete lediglich unbeteiligter Zuhörer zu sein brauchte.
Dieses Licht beobachteten sie nun schon seit geraumer Zeit. Es veränderte seine Position nicht.
„Der Gehörnte kann vermutlich nicht dahinterstecken“, sagte Ben Brighton.
„Warum nicht?“ Old Donegal sah ihn von der Seite an.
„Weil das Licht sowieso auf unserem Kurs liegt. Stimmt’s, Pete? Oder hast du den Kurs in der letzten halben Stunde geändert?“
„Unsere Hecksee ist so schnurgerade“, entgegnete Pete Ballie, „daß ein Zyklop sie glatt als Lineal verwenden könnte.“
„Die gibt’s hier nicht“, sagte Old Donegal prompt.
„Und ob!“ trumpfte Pete grinsend auf. „So, wie’s deinen Gehörnten hier gibt, gibt’s auch die einäugigen Riesenkerle.“
„Zyklopen sind Griechen“, entgegnete der alte O’Flynn beharrlich. „In den türkischen Herrschaftsbereich wagen die sich nicht vor.“
„Erstens lenkst du vom Thema ab“, sagte Ben Brighton lächelnd. „Und zweitens kann deine Begründung nicht ganz stimmen. Auf Lesbos und den anderen Inseln sollen nämlich auch Griechen leben – wenn auch von den Türken unterdrückt.“
„Hm, ja“, sagte Old Donegal verdrossen und kratzte sich am Hinterkopf. „Vielleicht gilt das eher für die türkischen Küstengewässer, was ich meinte.“
„Dein Höllenfürst hat uns jedenfalls nicht vom Kurs abgelenkt“, sagte Ben. „Und dein angebliches Irrlicht liegt immer noch auf derselben Position.“
Was höchst selten der Fall war, geschah in diesem Moment. Old O’Flynn wurde still und nachdenklich.
Ben Brighton und Pete Ballie wechselten einen Blick und grinsten. Sie hatten es tatsächlich zustande gebracht, das „Fachgespräch“ mit Old Donegal zum Erliegen zu bringen. Und das, obwohl das „Irrlicht“ immer noch vorhanden war. Aber vielleicht war auch gerade diese Tatsache der Grund für Old Donegals anhaltendes Schweigen.
Nur das Singen des Windes im laufenden und stehenden Gut war zu hören, dazu die anderen Geräusche, an die sich die Arwenacks nun schon längst gewöhnt hatten: das leise Ächzen des Schiffskörpers in seinen Verbänden, das Knarren von bestimmten Teilen der Takelage und das Rauschen des Rumpfes, wie er durch die Fluten schnitt.
Zusammen mit dem Windgesang war es eine Geräuschkulisse, die den Männern an Bord in Fleisch und Blut übergegangen war, seit sie den Zweimaster aus russischer Eiche im Schwarzen Meer „übernommen“ hatten.
Unvermittelt – zehn Minuten oder eine Viertelstunde mochten in Schweigen vergangen sein – mischten sich andere Geräusche in die vertraute Kulisse.
Anfangs war es nur wie ein leises Pochen – anhaltend, mehrstimmig.
„Da trampelt eine ganze Teufelscrew mit den Pferdefüßen“, flüsterte Pete Ballie. „Bestimmt versuchen sie, das Irrlicht von der Stelle zu bewegen, und sie schaffen es nicht.“
Old Donegal knurrte unwillig. Auch wenn diese Burschen es manchmal nicht glaubten, er kriegte noch immer mit, wann sie ihn auf den Arm nahmen und wann nicht.
Wie auch immer, seine Theorie vom teuflischen Irrlicht ließ sich nicht aufrechterhalten. Was der feixende Pete Ballie als Pferdefußgetrampel darstellte, hörte sich mehr und mehr nach höchst menschlichen Arbeitsgeräuschen an.
Hämmern.
Auch das Bild des Lichtscheins veränderte sich jetzt. War es eben noch ein heller runder Fleck in beträchtlicher Entfernung gewesen, so zerfaserte es jetzt in einzelne Punkte, die jedoch nahe beieinanderlagen.
Laternen. Mehr als ein Dutzend.
Ben Brighton hatte sein Spektiv geholt. Er zog es auseinander und richtete es auf jene Helligkeit, die sich dort aus der monddurchtränkten Dunkelheit schälte. Das Bild, das durch das Okular erkennbar wurde, war trübe. Ben konnte jedoch Einzelheiten deutlicher erkennen als mit bloßem Auge.
Ein Schiff, das vor Treibanker lag. Die Laternen waren über alle Decks verteilt und beschienen aufgegeite Segel und eine beträchtliche Wuhling auf der Kuhl und auf der Back. Eine Karavelle, der Bauart nach.
Offenbar handelte es sich um ein ehemaliges Kriegsschiff, das um den größten Teil seiner Armierung erleichtert worden war und nun zivilen Zwecken diente. Soweit Ben auf die Entfernung Konstruktionsmerkmale einstufen konnte, mußte es sich um ein spanisches oder ein italienisches Schiff handeln.
Genauere Einzelheiten ließen sich noch nicht erkennen. Er ließ das Spektiv sinken. Die Entfernung zu dem hellerleuchteten Zweimaster schätzte er auf eine knappe Seemeile. Bei der hohen Fahrt, die die Dubas lief, verringerte sich die Distanz jedoch zusehends.
Ben Brighton wandte sich nach vorn. „Luke!“
„Sir?“ Luke Morgan, der als Deckswache eingeteilt war und von der Back aus den Lichtschein beobachtet hatte, drehte sich um.
„Alle Mann an Deck! Segel wegnehmen und Treibanker ausbringen!“
„Aye, aye, Sir.“ Luke wiederholte den Befehl und stürmte dann in die Unterdecksräume, um die Arwenacks aus den Kojen zu holen.
In den Achterdeckskammern waren Hasard und die anderen bereits wach geworden. Es lag an diesem Gespür für besondere Ereignisse an Bord. Es riß sie aus dem tiefsten Schlaf, wenn etwas geschah, was nicht zum gewohnten Ablauf der Bordroutine gehörte.
Auf dem Hauptdeck führten die Männer die Befehle des Ersten Offiziers aus.
Der Seewolf wirkte so frisch und ausgeruht, als hätte er bereits die ganze Nacht hinter sich. Ben Brighton informierte ihn mit wenigen Worten.
Alle weiteren Einzelheiten waren mittlerweile durch die Spektive deutlich genug sichtbar.
An Bord der Karavelle reparierten sie Sturmschäden. Sie mußten es damit so eilig haben, daß sie auch die Nachtstunden für die Arbeit nutzten. Auch der Namenszug ließ sich jetzt entziffern. Die Karavelle hieß „Aurora“. Sowohl im Spanischen als auch im Italienischen bedeutete das Wort „Morgenröte“.
Hasard hatte der Entscheidung seines Ersten Offiziers sofort zugestimmt. Als die Dubas schließlich etwa hundert Yards von der „Aurora“ entfernt vor Treibanker lag, ließ der Seewolf das Beiboot fieren. Gemeinsam mit Dan O’Flynn, Don Juan de Alcazar und Ferris Tucker pullte er hinüber.
Sie erreichten den Lichtschein. Das Hämmern und Sägen hatte aufgehört. Die Männer an Bord arbeiteten mit nacktem Oberkörper. Sie waren schweißüberströmt. Der Sturm, in den sie geraten waren, hatte die „Aurora“ kräftig gerupft.
„Bitten, an Bord kommen zu dürfen!“ rief Don Juan auf Spanisch.
„Wir empfangen Sie mit großer Freude, Señores!“ antwortete einer der Männer an der Steuerbordverschanzung.
Wie sich wenig später herausstellte, war er der Kapitän der „Aurora“. Er stellte sich als Edmundo Rojo vor. Ein Mann in den besten Jahren. An seinem gestählten Körper gab es allem Anschein nach kein einziges Gramm überschüssigen Fetts. Mit seinem nackten, muskelbepackten Oberkörper hatte er gearbeitet wie alle anderen Männer an Deck auch.
Bekleidet war er mit Stulpenstiefeln und einer Pluderhose, die von einem breiten Ledergurt gehalten wurde. Sein eckiger Schädel war von schwarzem Haar bedeckt, der Oberlippenbart verlieh seinem Gesicht zusammen mit den grauen Augen etwas Kaltes und Unnahbares. Wenn er diese Eigenschaft zu spüren schien, so versuchte er zumindest, sie durch übermäßige Höflichkeit auszugleichen.
Edmundo Rojo führte seine Gäste in die Kapitänskammer des Schiffs und forderte sie auf, sich zu setzen.
„Sie sind kein Spanier?“ fragte Philip Hasard Killigrew.
Rojo kehrte mit einem großem Weinkrug von einem Schapp zurück. Er stellte den Krug auf den Tisch und wollte dem Seewolf antworten. Doch das Geräusch des sich öffnenden Schotts hielt ihn davon ab.
Die Männer, die mit einem Crewmitglied gerechnet hatten, zogen überrascht die Brauen hoch.
Was da vorsichtig und mit fragender Miene eintrat, war eine junge Frau von ungewöhnlicher Schönheit. Das schwarze Haar trug sie in sehr kurzem Schnitt, was jedoch ihre feingezeichnete Gesichtsform wirkungsvoll unterstrich. Ihre Augen waren dunkel und voller Glut, doch allein die Offenheit ihrer Miene ließ erkennen, daß sie alles andere als ein männerverschlingendes Weib war.
Dan O’Flynn spürte den Blick aus diesen Glutaugen und hatte den Eindruck, das da etwas mehr war als nur Interesse oder Neugier. Bildete er sich das vielleicht nur ein?
Sie war hinreißend, eine von jenen Frauen, für die ein Mann jede Dummheit begehen konnte. Dan erwiderte ihren Blick mit einem Lächeln, und es freute ihn, ihr leichtes Erröten zu bemerken, das ganz und gar nicht gespielt war.
„Ich bitte um Verzeihung, wenn ich störe“, sagte sie mit einer Stimme, die wie dunkler Samt war. „Aber bei dem Lärm an Bord kann man sowieso nicht schlafen. Also, dachte ich mir, kann ich ebensogut ein wenig zur Hand gehen.“
„Meine Tochter Cara“, sagte Edmundo Rojo stolz und fügte hinzu, indem er sich ihr zuwandte: „Die Señores sind Engländer, bis auf jenen Señor“, er wies mit einer angedeuteten Verneigung auf Don Juan, „der aus Spanien stammt.“
Die Männer standen auf, reichten Cara die Hand und stellten sich vor. Abermals spürte Dan ihren Blick mit besonderer Intensität, und er hatte den Eindruck, daß die sanfte Wärme ihres Händedrucks ein wenig länger anhielt, als man es bei einer normalen Begrüßung für angemessen halten konnte.
„Serviere uns bitte den Wein“, sagte Edmundo Rojo und setzte sich an das freie Kopfende des Tisches.
„Aber gern“, entgegnete Cara und fügte lächelnd und mit leisem Vorwurf hinzu: „Hast du deinen Gästen kein Brot angeboten, Vater?“
Er schlug die Hände gegeneinander. „Du liebe Güte! Wie konnte ich vergessen, daß wir eine junge Dame an Bord haben, die in der Kombüse für Außergewöhnliches sorgt! Cara versorgt uns jeden zweiten oder dritten Tag mit frischem Brot. Alle Männer an Bord werden verwöhnt.“
Cara brachte kristallene Gläser und dann eine große Holzplatte mit in Scheiben geschnittenem frischem Brot. Es war weiß und knusprig. Die Männer probierten es, während Cara Wein einschenkte. Das Brot hatte einen herzhaften Geschmack.
„Phantastisch!“ rief Dan O’Flynn begeistert.
„Ich habe es heute morgen frisch gebacken“, sagte Cara leise.
Dan suchte ihren Blick. „Jeder Mann an Bord dieses Schiffes ist zu beneiden.“
„Ich bin sicher, mein Vater würde die Mannschaft um ein neues Mitglied erweitern“, erwiderte sie schlagfertig.
Die Männer lachten. Edmundo Rojo hob sein Glas und prostete den Gästen zu. Cara setzte sich auf den freien Stuhl, bereit, nachzuschenken, sobald ein Glas leergetrunken war.
„Ich habe Ihre Frage nicht beantwortet“, sagte Rojo und blickte den Seewolf an. „Ihr Spanisch ist perfekt und ohne Akzent, Señor Killigrew. Es erstaunt mich daher nicht, daß Ihnen meine Aussprache sofort aufgefallen ist.“
„Vielleicht täusche ich mich auch“, entgegnete Hasard. „Señor de Alcazar ist in jedem Fall der kompetentere Mann. Ich kann unmöglich alle Dialekte des kastilischen Spanisch auseinanderhalten.“
„Ich glaube, du liegst mit deiner Vermutung schon ziemlich richtig“, sagte Don Juan. „Ich würde bei Señor Rojo auch annehmen, daß er zumindest nicht vom spanischen Mutterland stammt.“
„So ist es, Señores“, sagte der Kapitän der „Aurora“ und stellte sein Glas ab. „Ich will mich nicht unnötig interessant machen, und wir sollten schnell das Thema wechseln. Cara und ich stammen aus Sizilien. Allerdings waren unsere Vorfahren ausnahmslos Spanier, die sich dort niederließen.“
„Wir sind vor der türkischen Küste in einen bösen Sturm geraten“, sagte Cara. „Deshalb sind Sie ja auch auf uns aufmerksam geworden, Señores. Wann begegnet man schon einem Schiff, auf dem noch bei Nacht gearbeitet wird.“
„Vor allem hatten wir großes Glück, daß wir nicht auf Legerwall gedrückt wurden“, erklärte ihr Vater. „Auf der offenen See konnten wir den Sturm dann abreiten. Aber dieser verdammte Bursche hat ein paarmal kräftig zugeschlagen. Das schwerwiegendste war wohl der Ruderschaden, den er uns verpaßt hat. Ganz zu Anfang hat es uns den Bugspriet weggerissen, und dann ging es Schlag auf Schlag.“
„Das war in der Nacht zu gestern, nicht wahr?“ entgegnete der Seewolf.
„So ist es“, erwiderte Rojo. „Wir sind seit dem Morgengrauen mit den Reparaturarbeiten beschäftigt, und es ist noch immer kein Ende abzusehen. Wir sollten eigentlich morgen in Mithimna auf Lesbos eintreffen. Ich habe dort geschäftlich zu tun. Aber den Termin werde ich wohl nicht einhalten können.“
Hasard und die anderen wechselten Blicke. Der Seewolf wandte sich wieder dem Kapitän der „Aurora“ zu und wies mit einer Kopfbewegung zu dem rothaarigen Hünen, der ihm gegenübersaß. „Mister Tucker ist unser Schiffszimmermann, Señor Rojo. Wenn Sie möchten, wird er sich die Schäden an Ihrem Schiff ansehen und Ihnen mit einigen unserer Männer zur Hand gehen.“
„Das ist mehr, als ich annehmen kann“, sagte Rojo. „Ihr Angebot ist überaus großzügig, Señor Killigrew.“
Hasard schüttelte energisch den Kopf. „Wir befolgen ein ungeschriebenes Gesetz, das auf den Weltmeeren gilt. Der Stärkere hilft dem Schwächeren. Morgen kann uns passieren, daß wir Hilfe brauchen. Genieren Sie sich also um Himmels willen nicht.“
Edmundo Rojo atmete tief durch. „Also gut“, sagte er mit gesenkter Stimme. „Ich müßte lügen, wenn ich behaupten wollte, für Ihr Angebot nicht dankbar zu sein.“
Tasuta katkend on lõppenud.