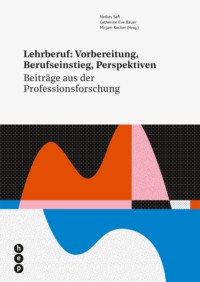Loe raamatut: «Lehrberuf: Vorbereitung, Berufseinstieg, Perspektiven (E-Book)»

Netkey Safi, Catherine Eve Bauer, Mirjam Kocher (Hrsg.)
Lehrberuf: Vorbereitung, Berufseinstieg, Perspektiven
Beiträge aus der Professionsforschung
ISBN Print: 978-3-0355-1580-0
ISBN E-Book: 978-3-0355-1581-7
1. Auflage 2019
Alle Rechte vorbehalten
© 2019 hep verlag ag, Bern
Inhalt
Einleitung: Aktuelle Themen und Perspektiven der Forschung zum Lehrberuf
1Hintergrund
2Zur Relevanz der professionellen Entwicklung von Lehrpersonen als Forschungsthema
3Aufbau des Sammelbandes
Teil 1: Vorbereitung auf den Lehrberuf
Motiviert für den Berufswechsel: Spielt der frühere berufliche Status eine Rolle?
Larissa Maria Troesch, Dilan Aksoy und Catherine Eve Bauer
1Einleitung
1.1Berufswahlmotivation
1.2Berufsziele
1.3Fragestellung
2Methode
2.1Durchführung und Stichprobe
2.2Instrumente
2.3Statistische Analysen
3Ergebnisse
3.1Berufswahlmotivation
3.2Berufsziele
4Diskussion
4.1Berufswahlmotive: Weitgehend unabhängig von der vorgängigen Berufsbiografie
4.2Berufsziele: Berufswechselnde zielen stärker auf Schulleitung oder Bildungsadministration
4.3Früherer beruflicher Status: Kein Einfluss auf Berufsziele und Berufswahlmotive
4.4Limitationen
4.5Implikationen
Fachmittelschule und Gymnasium als Zugangswege zu Pädagogischen Hochschulen in der Schweiz. Zubringer zum Studiengang Primarstufe im Vergleich
Sandra Hafner
1Ausgangslage
2Theoretischer Rahmen zur Analyse schulischer Profile
3Methodisches Vorgehen
4Vergleichende Darstellung der beiden PH-Zubringer
4.1Bildungsziele
4.2Wissensformen und Modi der Wissensvermittlung
5Zusammenfassung und Diskussion
Den «Praxishunger» stillen. Eine empirische Untersuchung zum Potenzial der Erfüllung psychologischer Bedürfnisse für die erfolgreiche Realisierung von Schulpraktika
Benjamin Dreer
1Einleitung
2Bedürfnisse Studierender im Schulpraktikum
3Methode
3.1Fragestellung
3.2Design
3.3Stichprobe
3.4Erhebungsinstrument
4Ergebnisse
5Diskussion und Fazit
Das elektronische Kompetenzentwicklungsportfolio. Ein Instrument zur Reflexionsförderung im Lehramt
Yvette Völschow, Simone Israel und Julia-Nadine Warrelmann
1Der Bedarf an Selbstreflexion für Lehramtsstudierende
2Das elektronische Kompetenzentwicklungsportfolio an der Universität Vechta
2.1Vorstellung der Portfolioarbeit
2.2Vorgehen
2.3Unterstützung bei der Selbstklärung durch Peer Coaches
3Theoretische Bezugspunkte
4Chancen und Hindernisse für die universitäre Lehramtsausbildung
5Schlussfolgerungen, Ausblick und Herausforderungen
Subjektive Eignung und Entschiedenheit für den Lehrberuf: Passt das immer zusammen?
Ernst Hany, Nadine Böhme, Tobias Michael und Melanie Keiner
1Theoretischer Hintergrund
2Hypothesen
3Methode
3.1Durchführung und Stichprobe
3.2Instrument- und Skalenbeschreibung
4Ergebnisse
5Diskussion
Berufliche Identitätsbildung als Prozess und Entwicklungsaufgabe im Studium
Julia Košinár
1Einleitung
2Die Herausbildung pädagogischer Orientierungen: Zwischen Schülerhabitus und Lehrerhabitus
3Entwicklung eines beruflichen Selbstverständnisses – phasenspezifische Ausdifferenzierung einer Entwicklungsaufgabe
4Deutung und Bearbeitung der Aufgabe «Entwicklung eines beruflichen Selbstverständnisses»
4.1Relevanz
4.2Kompetenz
4.3Beanspruchung
5Einlassung auf Anforderungen als Ausgangsmoment für die berufliche Identitätsbildung
6Berufliche Identitätsbildung – eine Typenfrage?
6.1Selbstverwirklichung
6.2Entwicklung
6.3Vermeidung
6.4Bewährung
7Diskussion und konzeptuelle Überlegungen für die Lehrerausbildung
Teil 2: Einstieg in den Lehrberuf
Gut begonnen, halb gewonnen? Die Bedeutung der Berufseinstiegsphase von Lehrpersonen für die Entwicklung des beruflichen Belastungserlebens
Victoria Bleck, Tatjana Weber und Frank Lipowsky
1Der Berufseinstieg und dessen Bedeutung
2Das Projekt «Wege im Beruf»
2.1Stichprobe
2.2Forschungsschwerpunkte
3Entwicklung der beruflichen Belastung über den Berufseinstieg hinaus
3.1Hintergrund
3.2Fragestellungen
3.3Methodik
3.4Ergebnisse
4Diskussion und Ausblick
4.1Zusammenfassung und Diskussion
4.2Ausblick
4.3Implikationen
Schützt Selbstregulation vor emotionaler Erschöpfung? Subjektive Belastung und personale Ressourcen von Lehrpersonen am Ende der Berufseinstiegsphase
Simone Berweger, Andrea Keck Frei, Zippora Bührer, Christine Wolfgramm und Christine Bieri Buschor
1Einleitung
2Hohe Komplexität der Anforderungen und Belastungserleben im Lehrberuf
3Methodisches Vorgehen
3.1Stichprobe
3.2Instrumente
3.3Statistische Analysen
4Ergebnisse
4.1Bivariate Zusammenhänge
4.2Regressionsanalyse
5Diskussion
Kompetent und motiviert in den Lehrberuf
Daniela Freisler-Mühlemann und Yves Schafer
1Einleitung
2Professionalisierung in der Berufseinstiegsphase
2.1Personale Ressourcen
2.2Soziale Ressourcen
3Fragestellungen
4Methode
4.1Stichprobe
4.2Instrumente
5Ergebnisse
6Diskussion
Beginning Teachers’ Engagement Profiles across Four Country Settings. Implications for Teacher Education and Early Career Induction
Paul W. Richardson and Helen M. G. Watt
1Introduction
2What are the motivations, professional engagement and career development aspirations of beginning teachers?
3Are there discernible «clusters» of beginning teachers already at entry to the profession, and (how) do these differ across diverse contexts?
4What happens to initial motivations for different types of beginning teachers?
5Summary and implications for teacher education, policy and employers
6Acknowledgments
Teil 3: Perspektiven im Lehrberuf
Passion für den Lehrberuf, Commitment und Kompetenzentwicklung. Absichten zum Verbleib im Lehrberuf von quereinsteigenden Lehrpersonen
Mirjam Kocher, Andrea Keck Frei, Christine Bieri Buschor und Ramona Hürlimann
1Einleitung
2Verbleib im Beruf und Kompetenzen von Lehrpersonen
3Motivationale Aspekte
4Methode
4.1Erhebung
4.2Stichprobe
4.3Instrumente
4.4Auswertung
5Ergebnisse
5.1Wie entwickeln sich die Kompetenzen der Quereinsteigenden im Studium und im Übergang zur Berufstätigkeit?
5.2Wie schätzen die Quereinsteigenden motivationale Aspekte ein?
5.3Wie schätzen die Quereinsteigenden das Arbeitsklima an ihrer Schule ein?
5.4Welche Aspekte wirken sich positiv auf die Verbleibsabsicht aus?
6Diskussion
Lehrpersonen unterrichten – oder nicht? Berufspläne von Quereinsteigenden im Vergleich zu Regelstudierenden
Kirsten Schweinberger und Netkey Safi
1Einleitung
2Theoretischer Hintergrund und Fragestellung
2.1Das Quereinstiegsprogramm der PH FHNW
2.2Gründe für den Ausstieg
2.3Verbleib im Lehrberuf
2.4Fragestellungen
3Methode
3.1Durchführung und Stichprobe
3.2Instrument
4Ergebnisse
4.1Fragestellung 1: Unterschiede in den Berufsplänen von Regelabsolvierenden und Quereinsteigenden
4.2Fragestellung 2: Verändern sich die Berufsaspirationen bei Quereinsteigenden über den Zeitraum von einem Jahr?
4.3Fragestellung 3: Können die Prädiktoren Kompetenzwahrnehmung, Arbeitszufriedenheit, Zufriedenheit mit der Berufswahl, Akzeptanz im schulischen Umfeld die Berufsaspiration «Klassenlehrperson» vorhersagen?
5Diskussion
6Fazit
Kündigende Lehrpersonen – belastet, unzufrieden oder die Berufslaufbahn gestaltend?
Manuela Keller-Schneider
1Einleitung
2Theoretische Rahmung und Fragestellungen
3Methodisches Vorgehen
4Ergebnisse
4.1Kündigungsmotive: Analyse der offenen Fragen
4.2Gründe und Ziele der Kündigung: Ergebnisse der skalierten Fragen
4.3Typen unterschiedlicher Profile von Gründen und Zielen der Kündigung
5Diskussion
The Changing Face of the Teaching Force in the United States of America
Richard Ingersoll, Elizabeth Merrill, Daniel Stuckey and Gregory Collins
1Introduction
2Data and Methods
3Results
4Discussion
Zusammenfassung und Ausblick: Aktuelle Forschung zum Lehrberuf
Catherine Eve Bauer und Netkey Safi
1Reflexion und Selbstregulation als Kernkompetenzen der Zukunft
2Wie lassen sich Lehrkräfte langfristig im Beruf halten? Fokus Berufswahl und berufliche Perspektiven
3Implikationen für die Lehrerinnen- und Lehrerbildung
Autorinnen und Autoren
Einleitung: Aktuelle Themen und Perspektiven der Forschung zum Lehrberuf
1Hintergrund
Der Lehrberuf ist einem wesentlichen Wandel unterworfen. Ausbildungsgänge werden durchlässiger, Karrieremöglichkeiten flexibler, Berufsbiografien variabler, die Anforderungen an die Lehrpersonen verändern sich. Vor diesem Hintergrund befasst sich der Sammelband mit den Themen Vorbereitung auf den Lehrberuf, Einstieg in den Lehrberuf und Perspektiven im Lehrberuf. Folgende Fragen stehen dabei im Fokus: Wer entscheidet sich heute für den Lehrberuf – auf welchen Wegen, aus welchen Gründen und mit welchen Zielen? Wer eignet sich für den Lehrberuf? Welche Bedeutung haben personale Ressourcen in der Berufseinstiegsphase, und in welchem Zusammenhang stehen sie zu Gefühlen der Belastung? Welche Facetten professionellen Handelns sind für angehende und amtierende Lehrpersonen zentral, und wie kann die Lehrerinnen- und Lehrerbildung sie beim Aufbau der entsprechenden Kompetenzen unterstützen? Welche Faktoren unterstützen die professionelle Entwicklung in unterschiedlichen Phasen der Berufslaufbahn, und wie wirken sie sich auf den längerfristigen Berufsverbleib aus?
Diese und weitere Fragen werden hier aus Sicht der Wissenschaft und der Praxis näher beleuchtet. Die in diesem Band vereinten empirischen und theoretischen Beiträge wurden im Rahmen der internationalen Tagung «Wege in den Lehrberuf – Pathways to the Teaching Profession» (September 2018) an der Pädagogischen Hochschule der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) in Brugg/Windisch vorgestellt und diskutiert. Die Autorinnen und Autoren stammen weitgehend aus dem deutschsprachigen Raum und befassen sich seit Längerem mit verschiedenen Fragen und Themen der Lehrerinnen- und Lehrerbildung. Zwei englischsprachige Beiträge ergänzen den Blick auf die Thematik aus einer amerikanischen und einer australischen Perspektive.
Der Sammelband ist das Ergebnis einer langjährigen Forschungskooperation zwischen den Pädagogischen Hochschulen FHNW, Zürich und Bern und knüpft an einen früheren Band an, «Berufswechsel in den Lehrberuf. Neue Wege der Professionalisierung» (Bauer, Bieri & Safi, 2017).
2Zur Relevanz der professionellen Entwicklung von Lehrpersonen als Forschungsthema
Der Lehrberuf ist den sich ständig verändernden gesellschaftlichen Rahmenbedingungen ausgesetzt und daher immer wieder Phasen des Wandels unterworfen. Veränderungen auf demografischer, schulstruktureller oder steuerungsbezogener Ebene wirken sich direkt auf die Anforderungen aus, die an die Rekrutierung, Ausbildung und professionelle Handlungskompetenz von Lehrkräften gestellt werden. Auch die zunehmende Öffnung der Lehrerinnen- und Lehrerbildung für neue Personengruppen sorgte in den letzten Jahrzehnten für Veränderungen, schuf neue Zugangswege in den Lehrberuf und die Möglichkeiten neuer Bildungs- und Berufslaufbahnen (Stichwort Quer- und Seiteneinstieg) (Criblez, 2017).
Während sich das «Wohin» pädagogischer Professionalisierung einigermaßen pragmatisch umreißen lässt – die Professionalisierung soll Lehrpersonen dazu verhelfen, die hochkomplexen und beanspruchenden beruflichen Anforderungen langfristig kompetent und bei guter Gesundheit bewältigen zu können –, ist das «Was» und «Wie» der professionellen Entwicklung Gegenstand einer langjährigen wissenschaftlichen Debatte (vgl. z. B. Helsper & Tippelt, 2011). Professionelle Entwicklungsprozesse von Lehrpersonen werden etwa als Berufssozialisation beschrieben oder als biografische Entwicklungsprozesse, als Aufbau von Expertise oder Kompetenz, als das Durchschreiten von Stufen des Lehrenlernens – vom puren Überleben bis hin zur Entwicklung von Routine – oder auch als Umgang mit den für den Lehrberuf typischen Widersprüchen und Unwägbarkeiten, die Lortie (2002) so treffend als «endemic uncertainties» bezeichnet (für eine Übersicht vgl. Messner & Reusser, 2000). So heterogen diese Blickwinkel und Forschungsansätze auch sind, so führen sie dennoch alle zu dem Schluss: Die Grundausbildung bildet zwar ein wichtiges Fundament für die Professionalisierung; sie allein kann jedoch, angesichts des raschen Wandels der beruflichen Wirklichkeit, eine erfolgreiche Berufslaufbahn von Lehrkräften nicht mehr gewährleisten (Messner & Reusser, 2000). In diesem Kontext gewinnt die langfristige professionelle Entwicklung von Lehrkräften im Rahmen ihrer gesamten beruflichen Laufbahn umso mehr an Relevanz.
3Aufbau des Sammelbandes
Der vorliegende Band nimmt sich dieser Thematik mit Fokus auf den deutschsprachigen Bildungsraum an. Darüber hinaus werden Beiträge aus zwei groß angelegten Forschungsprojekten aus Australien und den USA miteinbezogen, die, international gesehen, von herausragender Bedeutung sind. Die Beiträge sind analog zum Aufbau einer Berufslaufbahn in die Vorbereitung auf den Lehrberuf, den Berufseinstieg in den Lehrberuf und die Perspektiven im Lehrberuf gegliedert.
Teil 1: Vorbereitung auf den Lehrberuf
Diesem Themenbereich widmen sich Beiträge, die sich schwerpunktmäßig mit der Berufswahl, der Berufseignung und der Ausbildung von angehenden Lehrkräften befassen.
 Motiviert für den Berufswechsel: Spielt der frühere berufliche Status eine Rolle?
Motiviert für den Berufswechsel: Spielt der frühere berufliche Status eine Rolle?
(Larissa Maria Troesch, Dilan Aksoy und Catherine Eve Bauer)
Unterschiedliche Zugänge in den Lehrberuf sind mit unterschiedlichen Berufswahlmotiven verbunden. Da sich berufliche Motive und Ziele als langfristig bedeutsam für das Engagement und den Berufsverbleib erwiesen haben, ist die Frage relevant, was Berufsleute dazu bewegt, den Lehrberuf als Zweit- oder Drittberuf zu ergreifen.
 Fachmittelschule und Gymnasium als Zugangswege zu pädagogischen Hochschulen. Zubringer zum Studiengang Primarstufe im Vergleich
Fachmittelschule und Gymnasium als Zugangswege zu pädagogischen Hochschulen. Zubringer zum Studiengang Primarstufe im Vergleich
(Sandra Hafner)
Neben der eidgenössischen Maturität als traditionellem Zugangsweg etablieren sich in der Schweiz weitere Zugänge an die pädagogischen Hochschulen, darunter der über den Fachmittelschulabschluss. Die Autorin stellt sich die Frage, welche Vorbereitungslogiken und Bildungsziele mit diesen unterschiedlichen Zugängen verbunden sind.
 Den «Praxishunger» stillen. Eine empirische Untersuchung zum Potenzial der Erfüllung psychologischer Bedürfnisse für die erfolgreiche Realisierung von Schulpraktika
Den «Praxishunger» stillen. Eine empirische Untersuchung zum Potenzial der Erfüllung psychologischer Bedürfnisse für die erfolgreiche Realisierung von Schulpraktika
(Benjamin Dreer)
Angehende Lehrpersonen verspüren meist einen starken Drang, schon früh im Studium umfassend praktisch tätig zu werden. Für die pädagogischen Hochschulen ergibt sich daraus die Herausforderung, im Rahmen schulpraktischer Ausbildungsphasen lernwirksame Angebote zur individuellen Professionalisierung anzubieten. Der Autor stellt dar, welche Bedürfnisse sich hinter diesem «Praxishunger» verstecken und wie diese in Zusammenhang stehen mit dem erfolgreichen Absolvieren von Praktikumsphasen.
 Das elektronische Kompetenzentwicklungsportfolio. Ein Reflexionsinstrument zur professionellen Identitätsentwicklung im Lehramtsstudium
Das elektronische Kompetenzentwicklungsportfolio. Ein Reflexionsinstrument zur professionellen Identitätsentwicklung im Lehramtsstudium
(Yvette Völschow, Simone Israel und Julia-Nadine Warrelmann)
Die Reflexion des eigenen professionellen Handelns gilt als zentrales Instrument zur Verknüpfung von theoretischem Wissen und praktischem Handeln in der Grundausbildung. Die Autorinnen zeigen Möglichkeiten der Reflexions- und Reflexivitätsförderung mittels Portfolioarbeit auf mit dem Ziel, die professionelle Identitätsentwicklung zu begleiten.
 Subjektive Eignung und Entschiedenheit für den Lehrberuf: Passt das immer zusammen?
Subjektive Eignung und Entschiedenheit für den Lehrberuf: Passt das immer zusammen?
(Ernst Hany, Nadine Böhme, Tobias Michael und Melanie Keiner)
Dieser Beitrag untersucht auf der Basis einer exploratorischen Studie Zusammenhänge zwischen der Berufseignung und der Sicherheit der Studierenden, die richtige Berufswahl getroffen zu haben, und geht der Frage nach, wie sich diese Erkenntnisse für die Identitätsförderung im Rahmen der Grundausbildung nutzen lassen.
 Berufliche Identitätsbildung als Prozess und Entwicklungsaufgabe im Studium
Berufliche Identitätsbildung als Prozess und Entwicklungsaufgabe im Studium
(Julia Košinár)
Welche Berufsrolle Lehrpersonen sich zuschreiben, ist für ihr professionelles Handeln von zentraler Bedeutung. Der Beitrag beleuchtet, wo die Grundlagen der Entwicklung einer professionellen Identität zu lokalisieren sind, wie Prozesse der beruflichen Identitätsbildung verlaufen und welche Bedingungsfaktoren dabei bedeutsam sind.
Teil 2: Einstieg in den Lehrberuf
Im zweiten Themenbereich sind Beiträge zusammengefasst, die schwerpunktmäßig den Übergang von der Grundausbildung in den Beruf und/oder die Anforderungen der ersten Berufsjahre in den Fokus rücken.
 Gut begonnen, halb gewonnen? Die Bedeutung der Berufseinstiegsphase von Lehrpersonen für die Entwicklung des beruflichen Belastungserlebens
Gut begonnen, halb gewonnen? Die Bedeutung der Berufseinstiegsphase von Lehrpersonen für die Entwicklung des beruflichen Belastungserlebens
(Victoria Bleck, Tatjana Weber und Frank Lipowsky)
Der Lehrberuf ist geprägt von einem hochkomplexen Aufgabenprofil und gilt als Beruf mit hohem Risiko der beruflichen Belastung. Doch bleibt langfristig belastet, wer sich im Berufseinstieg überfordert fühlt? Diese Längsschnittstudie begleitet Lehrkräfte vom Berufseinstieg in die mittlere Berufsphase hinein und untersucht, wie sich das subjektive Belastungserleben im Verlauf der Jahre verändert.
 Schützt Selbstregulation vor emotionaler Erschöpfung? Subjektive Belastung und personale Ressourcen von Lehrpersonen am Ende der Berufseinstiegsphase
Schützt Selbstregulation vor emotionaler Erschöpfung? Subjektive Belastung und personale Ressourcen von Lehrpersonen am Ende der Berufseinstiegsphase
(Simone Berweger, Andrea Keck Frei, Zippora Bürrer, Christine Wolfgramm und Christine Bieri Buschor)
Die Fähigkeit, eigene Handlungen und Emotionen zu steuern, ist eine zentrale Kompetenz im Umgang mit komplexen Anforderungen, die vor negativen Belastungsfolgen wie emotionaler Erschöpfung und Burn-out schützt. Die Autorinnen untersuchen die Zusammenhänge zwischen subjektivem Belastungserleben, Arbeitszufriedenheit und negativen Belastungsfolgen zwei bis vier Jahre nach Berufseintritt.
 Kompetent und motiviert in den Lehrberuf
Kompetent und motiviert in den Lehrberuf
(Daniela Freisler-Mühlemann und Yves Schafer)
Trotz langjähriger Ausbildung steigen nach der Diplomierung nicht alle ausgebildeten Lehrkräfte direkt in den Lehrberuf ein. Die Autorinnen gehen der Frage nach, ob diese Entscheidung mit geringeren Kompetenzen oder Ressourcen der Nichteinsteiger und Nichteinsteigerinnen zusammenhängt.
 Beginning Teachers’ Engagement Profiles across Four Country Settings: Implications for Teacher Education and Early Career Induction
Beginning Teachers’ Engagement Profiles across Four Country Settings: Implications for Teacher Education and Early Career Induction
(Paul W. Richardson and Helen M. G. Watt)
Berufseinführungsprogramme haben im englischen Sprachraum eine lange Tradition und gewinnen auch in deutschsprachigen Ländern zunehmend an Bedeutung. Das australische Forscherteam beleuchtet die Frage, ob sich anhand ihrer Berufswahlmotive unterschiedliche Typen von Berufseinsteigenden identifizieren lassen, was dies für die weitere professionelle Entwicklung bedeutet und wie die Berufseinführung darauf reagieren kann.