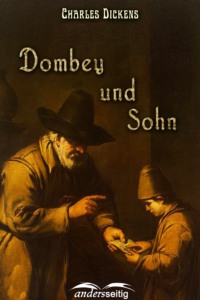Loe raamatut: «Dombey und Sohn»
Charles Dickens
Dombey und Sohn
Impressum
Covergestaltung: Olga Repp
Illustration: Paul Th. Hoffmann
Übersetzer: Carl Kolb
Digitalisierung: Gunter Pirntke
2017 andersseitig.de
ISBN:
9783961183135 (ePub)
9783961183142 (ePub)
andersseitig Verlag
Dresden
www.andersseitig.de
info@new-ebooks.de
(mehr unter Impressum-Kontakt)
Inhalt
Impressum
Band 1
Einleitung.
Erstes Kapitel. Dombey und Sohn.
Zweites Kapitel. In welchem zeitige Vorsorge für einen Fall getroffen wird, der bisweilen in den geordnetsten Familien vorkommt.
Drittes Kapitel. In welchem sich Mr. Dombey als Mann und Vater an der Spitze seines Hauswesens zeigt.
Viertes Kapitel. In dem einige weitere erste Anzeichen in betreff des Schauplatzes dieser Abenteuer auftreten.
Fünftes Kapitel. Pauls Gedeihen und Taufe.
Sechstes Kapitel. Pauls zweite Verwaisung.
Siebentes Kapitel. Vogelperspektive von Miß Tors Wohnung und ihre Liebhabereien..
Achtes Kapitel. Pauls weitere Fortschritte – sein Gedeihen und sein Charakter.
Neuntes Kapitel. In welchem den hölzernen Midshipman Angelegenheiten treffen.
Zehntes Kapitel. Enthält die Folgen, die das Unglück des Midshipman nach sich zieht.
Elftes Kapitel. Paul betritt einen neuen Schauplatz.
Zwölftes Kapitel. Pauls Erziehung.
Dreizehntes Kapitel. Mr. Dombeys Bureau.
Vierzehntes Kapitel. Paul wird immer altmodischer und geht nach Hause in die Ferien.
Fünfzehntes Kapitel. Erstaunliche Verschmitztheit des Kapitän Cuttle und ein neues Geschäft für Walter Gay.
Sechzehntes Kapitel. Was die Wellen immer sagten.
Siebzehntes Kapitel. Kapitän Cuttle macht ein kleines Geschäft für die jungen Leute.
Achtzehntes Kapitel. Vater und Tochter.
Neunzehntes Kapitel. Walters Abreise.
Zwanzigstes Kapitel. Mr. Dombey macht eine Reise.
Einundzwanzigstes Kapitel. Neue Gesichter.
Zweiundzwanzigstes Kapitel. Wie Mr. Carker, der Geschäftsführer, ein kleines Geschäft betreibt.
Dreiundzwanzigstes Kapitel. Florence ist einsam und der Midshipman geheimnisvoll.
Vierundzwanzigstes Kapitel. Das Studium eines liebenden Herzens.
Fünfundzwanzigstes Kapitel. Seltsame Neuigkeiten von Onkel Sol.
Sechsundzwanzigstes Kapitel. Schatten der Vergangenheit und der Zukunft.
Siebenundzwanzigstes Kapitel. Tiefere Schatten.
Achtundzwanzigstes Kapitel. Veränderungen.
Neunundzwanzigstes Kapitel. Wie Mrs. Chick die Augen aufgehen.
Dreißigstes Kapitel. Die Zeit vor der Hochzeit.
Einunddreißigstes Kapitel. Die Trauung.
Band 2
Zweiunddreißigstes Kapitel. Der hölzerne Midshipman geht in die Brüche.
Dreiunddreißigstes Kapitel. Gegensätze
Vierunddreißigstes Kapitel. Wieder eine Mutter und eine Tochter.
Fünfunddreißigstes Kapitel. Das glückliche Paar.
Sechsunddreißigstes Kapitel. Der offizielle Einzugsschmaus.
Siebenunddreißigstes Kapitel. Mehr als eine Warnung.
Achtunddreißigstes Kapitel. Miß Tox nimmt eine alte Bekanntschaft wieder auf
Neununddreißigstes Kapitel. Weitere Abenteuer des Schiffskapitäns Edward Cuttle.
Vierzigstes Kapitel. Häusliche Verhältnisse
Einundvierzigstes Kapitel. Neue Stimmen auf den Wellen
Zweiundvierzigstes Kapitel. Vertraulich und zufällig.
Dreiundvierzigstes Kapitel. Nachtwachen
Vierundvierzigstes Kapitel. Eine Trennung
Fünfundvierzigstes Kapitel. Die zuverlässige Mittelsperson.
Sechsundvierzigstes Kapitel. Prüfend und nachdenklich
Siebenundvierzigstes Kapitel. Der Donnerschlag
Achtundvierzigstes Kapitel. Florencens Flucht.
Neunundvierzigstes Kapitel. Der Midshipman macht eine Entdeckung.
Fünfzigstes Kapitel. Mr. Toots Herzeleid.
Einundfünfzigstes Kapitel. Mr. Dombey und die Welt.
Zweiundfünfzigstes Kapitel. Geheime Mitteilung
Dreiundfünfzigstes Kapitel. Weitere Nachricht
Vierundfünfzigstes Kapitel. Die Flüchtlinge.
Fünfundfünfzigstes Kapitel. Rob, der Schleifer, verliert seine Stelle.
Sechsundfünfzigstes Kapitel. Mehrere Personen entzückt und der Preishahn entrüstet.
Siebenundfünfzigstes Kapitel. Wieder eine Hochzeit.
Achtundfünfzigstes Kapitel. Später.
Neunundfünfzigstes Kapitel. Vergeltung
Sechzigstes Kapitel. Handelt hauptsächlich von Hochzeiten.
Einundsechzigstes Kapitel. Erlösung
Zweiundsechzigstes Kapitel. Schluß.
Band 1
Einleitung.
Den Roman »Dombey und Sohn« schuf Dickens in den Jahren 1846 bis 1848, also nach den »Weihnachtserzählungen« und vor »David Copperfield«. Der damals etwa Fünfunddreißigjährige, auf der Höhe seines Schaffens stehend, beschäftigt sich auch hier wieder, wie schon in seinen früheren Arbeiten, mit den »moralischen Problemen« des Lebens, wenn man sich so ausdrücken darf. Die Probleme laufen alle auf die eine Hauptfrage hinaus: Wie ist das Leben recht zu gestalten, so daß wir nicht im Unmaß verhärten? Das rechte Maßhalten bedingt den schönen, wahren und guten Menschen. Aber alles Unmaß ist Sünde und führt ins Verderben. Unmaß im Besitz führt zur Habgier und zum Geiz und zu der Vereinsamung, wie sie Scrooge im »Weihnachtsabend« an sich erfahren hat. Unmaß im Selbstbewußtsein aber leiten zu Hochmut und Stolz und zu jener selbstgewählten grausam marternden Einsamkeit, unter deren Auswirkungen die Kinder des reichen Kaufherrn Dombey so schwer leiden.

Die Figur des Captain Cuttle, einer der Nebenfiguren aus Dickens Roman
Das ganze Werk ist eine großartige psychologische Darstellung der Geschichte eines solchen stolzen, eisernen Herzens, das sich mit Hochmut umpanzert, bis die Katastrophe hereinbricht: Wehe dem Wesen, das nicht zu lieben gelernt hat! Es mag die ganze Welt gewinnen, sie bleibt äußerer Glanz und erwärmt nicht sein Inneres. Es mag zuzeiten stolz und unnahbar dastehen und glauben, die liebende Demut sei Torheit und überflüssig. Aber es wird erfahren, daß zuletzt aller Hochmut aushöhlt, die Seele leer läßt und sie in der Einöde der Heimatlosigkeit frieren läßt, bis sie zu spät ihre Armseligkeit erkennt.
Für all das bietet der stolze Dombey das erschütternde Beispiel. Sein Ehrgeiz läßt ihn überall auf falsche Karten setzen. So verliert er den sorgfältig geschützten und gehegten Sohn Paul, den er nicht um des Kindes selbst willen, sondern um der Firma, des Geschäfts, des äußeren Ansehens willen liebt. So jagt er, den Verlust seiner ersten, wirklich guten Frau gar nicht empfindend, einer blendend schönen Erscheinung nach, der unglückseligen Edith, deren Mutter eine ränkevolle elegante Kupplerin ist. Durch die Verbindung mit dieser äußeren Schönheit, die er nicht liebt, sondern sich durch reiche Ausstattung erkauft, glaubt er sein Ansehen in der Welt erhöhen zu können. Aber Edith betrügt ihn mit seinem Geschäftsführer, und der äußerlich vornehme, dünkelhafte Dombey wird seelisch in den völligen Bankerott gestürzt, den er sich selbst verdient hat. Das Schicksal, das er erlebt, ist zugleich strenge Gerechtigkeit.
Aber wundervoll ist es nun zu beobachten, wie Dickens es versteht, neben dieser Welt der Kälte, der Berechnung, der lieblosen Hoffahrt eine Welt der Liebe, Hilfsbereitschaft und Güte aufblühen zu lassen. Neben der Gerechtigkeit waltet nun die Gnade und das erlösende Erbarmen, das die Eisesstarre des stolzen Herzens der Dombey-Welt schmilzt und einen Lebensfrühling schließlich heraufzaubert im Sinne von: Ende gut, alles gut! Ohne diese Losung, ohne diesen Glauben an die schließliche Siegeskraft des Guten in der Welt, hat Dickens, wie wir es schon aus den früheren Bänden dieser Ausgabe wissen, überhaupt keinen Roman schreiben und zum Abschluß bringen können. Diese Welt der Liebe blüht auf in den von Dombey verachteten Gestalten, die ihn später retten: in einer lieblichen Tochter, Florence, in der der Dichter ein Idealbild reiner Mädchenhaftigkeit und Weiblichkeit gezeichnet hat, in den originellen Käuzen, wie dem alten Instrumentenmacher Gills und dem wackeren Kapitän Cuttle, einem braven Seebären von rührend-komischer Unbeholfenheit, aber dem treuesten Herzen, das es auf der Welt geben kann. Dickens zeigt hier, wie echtes Gold sich oft unter unscheinbar rauher Außenhülle verbirgt. Endlich in dem prächtigen Walter, dem frischen Jungen, der sich in schweren Sturmesnöten zum gutgearteten Jüngling entwickelt. In den liebenden Mächten, die diese Gestalten verkörpern, läßt der Dichter den Titelhelden seines Romans die Rettung aus dem Zusammenbruch finden.
Außer den immer bleibenden menschlichen Wahrheiten, die sich in diesem Werke herausheben, bietet das Buch ein schon kulturhistorisch interessantes Spiegelbild der damaligen englischen Gesellschaft. Wir sind geneigt, über manche altmodische Umständlichkeiten jener empfindsameren Zeit, als die unsere ist, zu lächeln. Aber wer weiß: werden nicht auch unsere Enkel wieder lächeln über manche Torheiten unserer heutigen Gesellschaft, über Torheiten, die wir heute noch gar nicht als solche empfinden? Man muß Dickens mit Zeit und Behagen lesen, wie wir schon in der Einleitung zu den »Pickwickiern« ausführten. Dann wird man gerade aus dem zeitlichen Kolorit manchen erkenntniswerten Schatz auch für unsere moderne Zeit mitnehmen.
Die Durcharbeitung dieses Werkes fiel für den Herausgeber in eine Zeit, da er selbst durch Amtsgeschäfte und berufliche Tätigkeit sehr in Anspruch genommen war. Um so dankbarer ist er daher seiner bisherigen treuen Helferin an diesem Unternehmen, Frau Clara Weinberg, für die geleistete Unterstützung.
Den 26. Januar 1928.
P. Th. H.
Erstes Kapitel. Dombey und Sohn.
Dombey saß in der Ecke des abgedunkelten Zimmers in dem großen Lehnstuhl neben dem Bett, und Sohn lag, warm eingewickelt, in einem Korbnestchen, das unmittelbar vor dem Feuer auf einem niedrigen Schemel stand und der Glut sich so nah befand, als ob die Konstitution des jungen Herrleins Ähnlichkeit habe mit der einer Semmel, die braun geröstet werden muß, solange sie noch frisch ist.

Die Figur des Toots, einer der Bewunderer der von Dombey vernachlässigten Florence
Dombey war ungefähr achtundvierzig Jahre alt, Sohn etwa achtundvierzig Minuten. Dombey war etwas kahl, ziemlich rot und, obschon sonst ein wohlproportionierter Mann, doch zu ernst und zu pomphaft in seinem Äußern, um durch dieses sonderlich anzusprechen, während Sohn sehr kahl, sehr rot und, wenn auch unleugbar ein sehr schönes Kind, im allgemeinen vorderhand etwas zerdrückt und verbeult aussah. Auf Dombeys Stirn hatten Zeit und Sorge, wie an einem Baum, der bald zum Fällen reif ist, allerlei Merkmale eingegraben: denn besagte beiden Schwestern schreiten schonungslos durch die Menschenforsten und lassen überall die Zeichen ihres Dagewesenseins zurück. Das Gesicht von Sohn aber war von tausend kleinen Furchen gekreuzt, die dieselbe hinterlistige Zeit mit dem flachen Teil ihrer Sense auszuglätten bestimmt war – eine Vorbereitung für die tieferen Eindrücke späterer Jahre.
Überglücklich ob der langersehnten Ereignisse klimperte und klimperte Dombey mit der schweren goldenen Uhrkette, die unter dem eleganten blauen Frack hervorblitzte, während die Knöpfe des erwähnten Kleidungsstückes in den matten Strahlen des fernen Feuers phosphorisch funkelten. Sohn dagegen reckte seine Händchen in die Höhe, ballte sie zu Fäustchen und schien mit dem Dasein, in das es so unerwartet getreten war, Händel anfangen zu wollen.
»Mrs. Dombey«, begann Mr. Dombey, »das Haus wird fortan nicht bloß der Firma nach, sondern nun auch wieder in der Tat Dombey und Sohn sein. Dombey und Sohn!«
Diese Worte übten einen so starken Einfluß aus, daß der Sprecher (freilich nicht ohne einiges Zögern, da er an dergleichen nicht gewöhnt zu sein schien) dem Namen der Mrs. Dombey einen Ausdruck der Zärtlichkeit beifügte, er sagte nämlich:
»Mrs. Dombey, meine – meine Liebe,«
Ein flüchtiges Rot, das Merkzeichen einer kleinen Überraschung, glitt über da« Antlitz der Wöchnerin, als sie ihre Blicke zu Mr. Dombey erhob.
»Er wird in der Taufe den Namen Paul erhalten, meine Mrs. Dombey, – natürlich.«
Sie wiederholte matt das »natürlich«, oder schien es wenigstens durch die Bewegung ihrer Lippen tun zu wollen; dann aber schloß sie die Augen wieder.
»Seines Vaters Name, Mrs. Dombey, und seines Großvaters! Wollte Gott, sein Großvater hätte diesen Tag erlebt.«
Und abermals fügte er – genau in demselben Ton wie früher – bei:
»Dombey und Sohn!«
Diese drei Worte umfaßten die einzige Idee von Mr. Dombeys Leben. Die Erde war nur da, damit Dombey und Sohn Geschäfte darin machen konnten, und Sonne und Mond hatten bloß die Bestimmung, für Dombey und Sohn zu scheinen, Flüsse und Meere waren da, um die Schiffe der Firma zu tragen; die Regenbogen versprachen nur ihr schönes Wetter; Sterne und Planeten liefen in ihren Kreisen, um unabänderlich einem System zu folgen, von dem Dombey und Sohn den Mittelpunkt bildete. Gewöhnliche Abkürzungen erhielten in seinen Augen ganz neue Bedeutungen, die bloß auf seine Firma Bezug hatten, und A. D. lautete in seiner Zeitrechnung nicht als Annus Domini, sondern als Annus Dombei – und Sohn.
Er hatte sich, wie vor ihm sein Vater, im Laufe der Zeit vom Sohn zu Dombey heraufgearbeitet und fast zwanzig Jahre lang die Firma als alleiniger Repräsentant vertreten. Die Hälfte dieser Periode war ihm im Ehestand entschwunden – wie einige sagen, mit einer Dame, die ihm nicht ihr Herz zur Morgengabe brachte, sondern ihr Glück in der Vergangenheit suchte und sich darin fügen mußte, den gebrochenen Geist an das ergebungsvolle Dulden der Gegenwart zu fesseln. Dergleichen Gerede kam übrigens nicht leicht Mr. Dombey zu Ohren, wie sehr er auch dabei beteiligt war, und wenn es je auch so weit gekommen wäre, so würde er zu allerletzt daran geglaubt haben. Dombey und Sohn hatten zwar schon oft in Häuten, nie aber in Herzen Geschäfte gemacht, denn letztere waren ein Geschäftszweig, den sie gerne jungen Burschen und Mädchen, den Kostschülern und den Bücherschreibern überließen. Mr. Dombey pflegte zu sagen, daß ein Ehebund mit ihm an und für sich jedem auch nur mit gewöhnlichem Verstand begabten Frauenzimmer sehr wünschenswert und ehrenvoll sein müsse, und die Hoffnung, einem solchen Hause einen neuen Associé zu geben, könne nicht fehlen, in der anspruchslosesten Weiberbrust ein Gefühl des glühendsten Ehrgeizes zu wecken. Mrs. Dombey habe mit ihm diesen sozialen Ehevertrag eingegangen, der ihr, selbst eine Bezugnahme auf die Fortpflanzung der Familienfirma, fast notwendig die Teilnahme an einer gentilen und wohlhabenden Stellung sicherte, und alle diese Vorteile vollkommen eingesehen, ja noch außerdem durch tägliche Erfahrung sich überzeugen können, welche Stellung er in der Gesellschaft einnehme; sie habe stets an seiner Tafel obenan gesessen, und habe die Honneurs seines Hauses nicht nur in geziemender Weise, sondern auch mit dem Anstand einer seinen Dame gemacht; sie müsse daher notwendig glücklich sein, ob sie nun wolle oder nicht. Oder jedenfalls lag ihr dabei nur ein einziger Hemmstein im Wege. Ja. Dies würde er zugegeben haben. Nur ein einziger, der aber zuverlässig viel in sich faßte. Sie waren zehn Jahre verheiratet gewesen, ohne bis auf die Stunde, in welcher Mr. Dombey auf dem Lehnstuhl neben dem Bette mit der goldenen Uhrkette klimperte, einen Sprößling erzielt zu haben.
Daß ich's recht sage, wenigstens keinen erheblichen. Vor etwa sechs Jahren war zwar ein Mädchen geboren, und das Kind, das sich eben erst unbemerkt ins Gemach gestohlen hatte, duckte sich jetzt schüchtern in eine Ecke, von der aus es seiner Mutter ins Gesicht sehen konnte. Aber was war ein Mädchen für Dombey und Sohn! In dem Kapitel des Firmanamens und der Firmawürde erschien ein solches Kind nur wie eine falsche Münze, die nirgends angelegt werden konnte – ein mißratenes Ding, weiter nichts.
Im gegenwärtigen Augenblick war übrigens Mr. Dombeys Wonnebecher so zum Überquellen angefüllt, daß er fühlte, er könne wohl einige Tröpflein des Inhalts missen, um den Staub auf dem Nebenpfade seiner kleinen Tochter damit zu benetzen. Er sagte daher:
»Florence, du kannst hingehen und dein Brüderlein ansehen, denn ich denke mir, daß dies dein Wunsch ist. Aber rühre es beileibe nicht an.«
Die Kleine warf einen lebhaften Blick auf den blauen Frack und die steife weiße Halsbinde, welche nebst ein Paar knarrenden Stiefeln und einer laut tickenden Taschenuhr ihre Idee von einem Vater verkörperten; aber ihre Augen kehrten unmittelbar darauf wieder zu dem Gesicht ihrer Mutter zurück, und sie rührte sich nicht von der Stelle, während sie zugleich ihre Lippen geschlossen hielt.
Im nächsten Moment öffnete die Dame ihre Augen und wurde des Kindes ansichtig. Die Kleine eilte auf sie zu, stand auf die Zehen, um ihr Gesichtchen besser an dem mütterlichen Busen verbergen zu können, und klammerte sich an die Wöchnerin mit einer so verzweifelten Innigkeit, wie man sie in ihren Jahren nicht erwartet hätte.
»O Gott behüte mich!« sagte Mr. Dombey, indem er ärgerlich aufstand. »Wahrhaftig, dies ist ein sehr unbesonnenes Benehmen und wird das Fieber nur steigern. Es ist wohl am besten, ich frage bei Doktor Peps an, ob er nicht vielleicht die Güte haben will, noch einmal heraufzukommen. Ich will hinunter gehen. Es wird nicht nötig sein, daß ich Euch erst bitte«, fügte er bei, während er bei der Chaiselongue vor dem Feuer einen Augenblick stehen blieb, »auf diesen jungen Gentleman ganz besondere Sorgfalt zu verwenden, Mrs. –«
»Blockitt, Sir?« ergänzte die Wärterin, ein jungferliches Stückchen verblichener Geziertheit, das sich nicht erdreistete, seinen Namen als Tatsache hinzustellen, sondern ihn nur in der Form einer milden Frage andeuten wollte. »Auf diesen jungen Gentleman, Mrs. Blockitt.«
»Nein, Sir, gewiß nicht. Ich erinnere mich, als Miß Florence geboren wurde –«
»Ja, ja, schon gut«, entgegnete Mr. Dombey, indem er sich über das Korbbettchen beugte und zu gleicher Zeit die Stirne runzelte, »Bei Miß Florence war es schon recht, aber hier ist der Fall anders. Dieser junge Gentleman hat eine Bestimmung zu erfüllen. Eine Bestimmung, kleiner Bursch!«
Während dieser Anrede erhob er eines von den Händchen des Knaben an seine Lippen und küßte es: dann aber schien er sich zu besinnen, daß diese Handlung seiner Würde Abbruch getan haben könnte, und er verließ deshalb etwas verlegen das Gemach.
Doktor Parker Peps, einer der Hofärzte und ein Mann, der wegen seiner Kunst in der Beihilfe zur Vergrößerung bedeutender Familien sich eines hohen Rufs erfreute, ging mit auf dem Rücken gekreuzten Händen im Besuchzimmer auf und ab, zur unaussprechlichen Bewunderung des Hausarztes, der schon seit sechs Wochen unter allen seinen Patienten, Freunden und Bekannten den Fall als einen solchen ausposaunt hatte, der ihm keinen Augenblick Ruhe lasse, weil er Tag und Nacht jede Stunde gewärtig sein müsse, in Gemeinschaft mit Doktor Parker Peps beigezogen zu werden.
»Habt Ihr gefunden, Sir«, begann Doktor Parker Peps mit tiefer, klangreicher Stimme, die übrigens gleich dem Türklopfer für den gegenwärtigen Anlaß gedämpft war, »daß Eure teure Gemahlin durch Euren Besuch aufgeregt wurde?«
»Stimuliert, sozusagen?« fügte der Hausarzt leise bei und verbeugte sich sodann gegen den Doktor, als wollte er sagen: »Entschuldigt, daß ich ein Wörtchen einflocht, aber es handelt sich hier um eine wertvolle Kundschaft.«
Mr. Dombey war sehr betroffen ob dieser Frage, denn er hatte so wenig an die Patientin gedacht, daß er nichts darauf zu antworten wußte. Seine Erwiderung lautete dahin, daß es ihm zur Beruhigung gereichen werde, wenn Doktor Peps noch einmal oben einen Besuch machen wolle.
»Gut. Wir dürfen es Euch nicht verbergen, Sir«, sagte Doktor Peps, »daß der Mangel an Kräften bei Ihren Gnaden, der Frau Herzogin – bitt' um Verzeihung, ich verwechsle die Namen: wollte sagen, bei Eurer liebenswürdigen Gemahlin sehr groß ist. Wir haben es mit einem gewissen Grad von languor zu tun, mit einer allgemeinen Abwesenheit von Elastizität, die wir lieber – nicht –«
»Sehen möchten«, setzte der Hausarzt mit einer abermaligen Kopfverbeugung hinzu.
»Ganz richtig«, entgegnete Doktor Parker Peps: »die wir lieber nicht sehen möchten. Es kommt mir vor, als ob dieses System der Lady Cankaby – entschuldigt, ich meinte, der Mrs. Dombey: ich verwechsle die Namen der Fälle –«
»Sie kommen so gar häufig vor«, murmelte der Hausarzt, »daß sich in der Tat nichts anderes erwarten läßt. Wäre es ein Wunder, wenn's nicht so sei, bei der großen Praxis, die Doktor Parker Peps im Westend hat –«
»Danke, vollkommen richtig bemerkt«, versetzte der Doktor. »Es kommt mir vor, als habe das System unserer Patientin einen Stoß erlitten, von dem sie nur durch eine große, kräftige und –«
»Nachdrückliche«, murmelte der Hausarzt.
»Ganz recht«, pflichtete der Doktor bei – »durch eine nachdrückliche Kraftanstrengung sich wird erholen können. Mr. Pilkins hier, der vermöge seiner Stellung als Hausarzt dieser Familie – ich muß sagen, ich kenne niemand, der eines solchen Vertrauens würdiger wäre –«
»O!« murmelte der Hausarzt. »Lob von Sir Hubert Stanley!«
»Ihr seid allzu gütig«, erwiderte Doktor Parker Peps. »Mr. Pilkins, der kann sein Fach am besten ausfüllen, der mit der Konstitution der Patientin im normalen Zustand bekannt ist – und ein solches Wissen ist für uns bei der Bildung unserer Ansichten über solche Fälle von hoher Wichtigkeit – teilt mein Dafürhalten, daß die Natur zu einer vollen Widerstandsfähigkeit veranlaßt werden muß, und wenn unsere interessante Freundin, die Gräfin von Dombey – ich bitte wieder um Verzeihung – Mrs. Dombey – nicht imstande –«
»Sein sollte«, ergänzte der Hausarzt.
»Diese erfolgreich zu überstehen«, fuhr Doktor Parker Peps fort, »so dürfte es wohl zu einer Krisis kommen, die wir beide aufrichtig beklagen würden.«
Hierauf blieben sie einige Minuten stehen und sahen zu Boden; dann aber gingen sie auf einen stummen Wink des Doktor Parker in das obere Gemach. Der Hausarzt öffnete seinem beruflich höher stehenden Kollegen die Tür und folgte ihm voll der unterwürfigsten Höflichkeit.
Wenn wir sagen wollten, Dombey sei durch die Worte der Arzte nicht nach seiner Art ergriffen worden, so würden wir ihm Unrecht tun. Er war allerdings nicht der Mann, der einer Erschütterung im eigentlichen Sinne zugänglich war, trug aber doch ein gewisses Bewußtsein in sich, daß es ihm sehr leid tun würde, wenn seine Gattin ernstlich erkrankte und stürbe, da ihm dann für sein Silberzeug, seine Möbel und die Hausgerätschaften etwas fehlte, was wohl zu ihnen gehörte. Aber ohne Zweifel hätte seine Trauer einen gewissen ruhigen, gentlemanischen, geschäftsmäßigen und gefaßten Charakter behauptet.
Seine Betrachtungen über diesen Gegenstand wurden aber bald durch das Rauschen von Kleidern auf der Treppe und dann durch das plötzliche Hereinstürzen einer Dame unterbrochen, die, obwohl sie in den mittleren Jahren stand, sich aber, was die Enge des Korsetts betraf, sehr jugendlich trug. Sie eilte mit einem gewissen verschraubten Wesen in Gesicht und Haltung auf ihn zu, schlang ihre Arme um seinen Hals und rief mit erstickter Stimme:
»Mein teurer Paul, er ist ganz ein Dombey!«
»O, schon gut!« entgegnete ihr Bruder – denn dies war Mr. Dombey – »ich denke selbst auch, daß er den Familienzug trägt. Aber sei nicht so ungestüm, Louisa.« »Es ist sehr töricht von mir«, sagte Louisa, indem sie Platz nahm und ihr Taschentuch herauszog, »aber er – er ist ein so vollkommener Dombey! In meinem Leben habe ich nie etwas Ähnlicheres gesehen!«
»Aber wie steht es mit Fanny selbst?« fragte Mr. Dombey. »Was hältst du von ihrem Zustand?«
»Mein lieber Paul, es ist durchaus nichts«, antwortete Louisa – »mein Wort dafür, durchaus nichts. Allerdings ist sie erschöpft, aber lang nicht in dem Grade, wie bei mir, als ich mit George oder Frederik Wöchnerin war. Man muß ihr wieder zu Kräften verhelfen, das ist alles. Wenn die liebe Fanny eine Dombey wäre! Trotzdem, ich stehe dafür, sie wird sich machen: ich zweifle nicht daran, daß sie sich noch machen wird. Mein lieber Paul, ich weiß, es ist sehr schwach und töricht von mir, daß ich vom Kopf bis zu den Füßen so zittere: aber es ist mir so seltsam, daß ich dich um ein Glas Wein und um einen Bissen von diesem Kuchen bitten muß. Ich meinte, ich müsse zum Treppenfenster hinausstürzen, als ich von meinem Besuch bei Fanny und bei dem kleinen Schnäbelchen herunterkam.«
Die letzten Worte hatten ihren Ursprung in einer plötzlichen lebhaften Erinnerung an den Neugeborenen. Sie hatte aber kaum ausgesprochen, als sich an der Tür ein leises Pochen vernehmen ließ.
»Mrs. Chick«, sagte draußen eine sehr sanfte weibliche Stimme, »wie geht es Euch jetzt, meine liebe Freundin?«
»Mein teurer Paul«, nahm Louisa leise das Wort, indem sie sich zugleich von ihrem Sitze erhob, »es ist Miß Tox – das wohlwollendste Geschöpf. Ohne sie hätte ich nicht herauskommen können. Miß Tox, mein Bruder Mr. Dombey. Lieber Paul, meine ganz besondere Freundin, Miß Tox.«
Die so speziell vorgestellte Dame war ein langes mageres Frauenzimmer von so verblichener Außenseite, daß es den Anschein hatte, als sei sie, wie es die Modewarenhändler nennen, von Haus aus nicht »echtfarbig« gewesen, und deshalb in der Wäsche allmählich ganz und gar verschossen. Außerdem aber hätte man sie als die wahre Blume von Sanftmut und Höflichkeit bezeichnen können. Infolge ihrer langen Gewohnheit, allem, was in ihrer Gegenwart gesprochen wurde, ein bewunderndes Ohr zu schenken, wobei sie die Redenden anzusehen pflegte, als sei sie innerlich beschäftigt, die Bilder derselben in ihre Seele aufzunehmen und sich nur mit dem Leben von ihnen zu trennen, hatte sich ihr Kopf völlig nach der einen Seite verschoben. An ihren Händen bemerkte man stets ein krampfhaftes Zucken, sich wie in unwillkürlicher Bewunderung aus eignem Antrieb zu erheben, und ihre Augen waren einer ähnlichen Manier unterworfen. Sie hatte die weichste Stimme, die man nur hören kann, und ihre erstaunlich sperberartige Nase war in der Mitte oder am Schlußsteine des Rückens mit einem kleinen Knauf versehen, der gegen ihr Gesicht abwärts lief, wie in unüberwindlicher Entschlossenheit, nie ein Aufwerfen des gedachten Gesichtsvorsprungs zu gestatten.
Obschon ihr Kleid vollkommen nett und gut war, drückte sich doch eine gewisse Eckigkeit und Knappheit darin aus. In ihren Hüten und Hauben pflegte sie wunderliche, unkrautartige Blümchen zu tragen, und in ihrem Haar bemerkte man bisweilen seltsame Gräser: auch konnte jeder, der sich dafür interessierte, an ihren Kragen, Rüschen, Manschetten und sonstigem Spitzenzeug – kurz an allem, was an ihrem Kleid die Bestimmung hatte, sich zu vereinigen, die Wahrnehmung machen, daß die beiden Enden nie auf freundschaftlichem Fuß miteinander standen, sondern stets eine große Neigung verrieten, die Verbindung nicht ohne Kampf vollziehen zu lassen. Für ihren Winterputz hatte sie Pelzkragen, Boas und Muffe, die stets in herausfordernder Weise auf der einen Seite standen und wild ihre Haare sträubten; auch besaß sie die Liebhaberei, stets kleine Beutel mit Federschlössern bei sich zu führen, die, wenn sie geöffnet werden sollten, wie kleine Pistolen losgingen, und sooft sie sich in vollem Putz zeigte, prunkte an ihrem Hals das geschmackloseste aller Schlösser mit einem alten, glotzenden Auge, in dem auch nicht eine Spur von Sinn lag. Diese und andere ähnliche Merkmale dienten dazu, die Ansicht zu verbreiten, Miß Tor sei eine Dame von zwar beschränkten, aber doch unabhängigen Mitteln, die sie im besten Lichte erscheinen ließ. Möglich, daß ihr trippelnder Gang diesen Glauben ermutigte, weil man daraus entnehmen konnte, der Umstand, daß sie einen gewöhnlichen Schritt in drei abteilte, habe notwendig seinen Ursprung in der Gewohnheit, alles aufs beste zu tun.
»In der Tat,« sagte Miß Tor mit einem bewundernswürdigen Knix, »die Ehre, Mr. Dombey vorgestellt zu werden, ist eine Auszeichnung, nach der ich mich längst gesehnt habe, obschon ich sie in diesem Augenblicke nicht erwartet hätte. Meine teure Mrs. Chick – darf ich sagen, Louisa?«
Mrs. Chick nahm die Hand der Freundin in die ihrige, setzte den Fuß ihres Weinglases darauf, unterdrückte eine Träne und sprach mit gedämpfter Stimme:
»Gott behüte, wozu auch diese Frage?«
»Meine teure Louisa also«, versetzte Miß Tor, »meine süße Freundin, wie geht es Euch jetzt?«
»Besser«, erwiderte Mrs. Chick. »Darf ich Euch etwas Wein anbieten? Ihr seid fast ebenso in Sorge gewesen wie ich, und habt es daher wohl verdient.«
Mr. Dombey schenkte ihr ein.
»Miß Tor, Paul«, fuhr Mrs. Chick fort, indem sie noch immer die Hand ihrer Freundin festhielt, »war Zeuge, wie sehr ich mich im voraus auf das Ereignis des heutigen Tage« freute, und hat daher eine kleine Gabe für Fanny angefertigt, die ich ihr zu überreichen versprach. Es ist nur ein Nadelkissen für den Toilettentisch, Paul, aber ich sage und werde stets sagen, ja, ich muß sagen, daß Miß Tor ihre freundliche Gesinnung der Gelegenheit allerliebst angepaßt hat. Den Gruß: ›zum Willkomm des kleinen Dombeylein‹ muß ich Poesie nennen.«