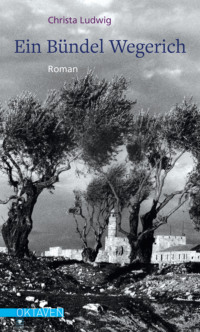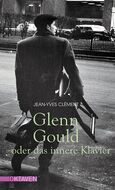Loe raamatut: «Ein Bündel Wegerich»
Christa Ludwig
Ein Bündel Wegerich
Roman
OKTAVEN
Wo soll ich hin, wenn kalt der Nordsturm brüllt –? – Die scheuen Tiere aus der Landschaft wagen sich – Und ich – vor deine Tür, ein Bündel Wegerich.
Else Lasker-Schüler, Die Verscheuchte
Herzog von Wien, sehr lieber Dichter,
… ich habe den Ring, den Joseph von Egypten trug, als er sich seinen Brüdern zu erkennen gab …, schreibt Else Lasker-Schüler im August 1909 an Karl Kraus. In Bagdad sagte mir mal eine Zauberin, ich hätte viele Tausendjahre als Mumie im Gewölbe gelegen und sei nicht mehr und nicht weniger als Joseph, der auf arabisch Jussuf heißt.
Meint sie das ernst? Ihr ist völlig klar: Der Empfänger des Briefes weiß, dass sie nie in Bagdad war.
Drei Jahre später zerbricht ihr schon lange instabiles Leben, als Herwarth Walden sie verlässt. Von nun an übernachtet sie in Hotels und lebt in den Berliner Künstlercafés. Und in Theben. In der Nacht meiner größten Not erhob ich mich zum Prinzen von Theben, also zu der ägyptischen Existenz von Joseph, Jakobs Lieblingssohn. (Gemeint ist das ägyptische Theben, nicht das griechische.) Sie unterschreibt Briefe mit Jussuf, Prinz von Theben, und entwirft ihr fiktives Land in Prosaschriften und Briefen. Freunde, denen sie schon seit Jahren Phantasienamen gibt, haben darin klangvolle Auftritte. Karl Kraus bekam nicht nur den Titel Herzog von Wien, sondern auch Dalai Lama.
Verrückt?
Man sollte bedenken, dass Manipulationen an der eigenen Biografie Mode waren, besonders Orient und Indianer waren beliebt. Dem Mann, der als Kara Ben Nemsi durch die Wüste und mit Blutsbruder Winnetou durch den Wilden Westen zog, hat man die erfundenen Identitäten eine Zeitlang abgenommen. Und Rilke z. B. legte sich adlige Vorfahren zu. Während er glaubwürdig mit seiner vornehmen Herkunft aufzutreten versuchte, übersteigert Lasker-Schüler die Eingriffe in ihren Lebenslauf so, dass die dichterische Absicht erkennbar ist: Ich bin in Theben (Ägypten) geboren, wenn ich auch in Elberfeld zur Welt kam, im Rheinland. Ich ging bis 11 Jahre zur Schule, wurde Robinson, lebte fünf Jahre im Morgenlande, und seitdem vegetiere ich.
Sie rettet sich in Spiel und Ironie, nicht in Fantasy. Ihre Prosaschriften bilden auf ihre eigene Weise Wirklichkeit ab. Erste Teile ihres Briefromans Malik (Briefwechsel mit Franz Marc) konnten 1917 nur unter Schwierigkeiten veröffentlicht werden, weil sie als Antikriegsroman gesehen wurden.
Ein Bündel Wegerich ist ein Roman über zwei Jahre ihres Lebens in Jerusalem, basierend auf dem, was überliefert ist, dieses aber weiterdenkend. Sie ist nicht, wie so oft behauptet wird, einsam und verlassen im Exil gestorben. Alle Personen in diesem Buch haben damals in Jerusalem gelebt und sich, wie hier beschrieben, um sie bemüht. Die einzige erfundene Figur ist Tasso. Dieser Roman zeigt Lasker-Schüler im Alter, so, wie sie alterte, ja, sie alterte, aber ihre früheren Leben vergingen nicht, sie ist noch immer: Kind, siebzehn Jahre, junge Frau, Mutter … wie durchscheinende Diapositive sind hier ihre Lebensphasen übereinandergelegt, und je nach Lichteinfall wird mal das eine, mal das andere deutlicher sichtbar.
Christa Ludwig
Prolog auf dem Friedhof
Jerusalem 1998
Da bringen sie ihr schon wieder einen Grabstein!
Ich folge unauffällig, aus sicherer Entfernung, der deutschen Delegation, die einen schwarzen Stein durch die vielen hellen auf dem Friedhof am Ölberg trägt. Ich kann sie nicht verlieren, ich weiß, wohin sie gehen.
Warum lassen sie das nicht endlich? Die kriegen sie doch nicht unter die Erde. Nicht in ein ordentliches Grab. Sie hat ihr Geburtsdatum in allen Ausweisen gefälscht. Vielleicht hat sie uns mit ihrem Todestag genauso betrogen und sie lebt noch, eine Methusalem-alte Frau, die in Wahrheit ein junges Mädchen ist – oder ein junger Mann, das wechselte damals und es würde heute nicht anders sein.
Zum dritten Mal nun ihr Name, gemeißelt in Stein! Der erste ist der schönste. Wir brachten ihn vor 53 Jahren. Ich war Mitte zwanzig, aber nicht mehr lange, bald danach war ich ein alter Mann. Der Grabstein, der erste, leicht rosa aus Galiläastein, sollte während der jordanischen Besatzung für eine Straße quer über den Friedhof verbaut werden. Aber er war ungeeignet, groß und sperrig, man fand ihn später am Straßenrand und brachte ihn zurück. Er trägt nun eine Tafel, auf der ihr Name zum zweiten Mal steht. Sie ist weiß, jüdisch, hebräisch. Sie fällt hier nicht auf. Und nun bringen sie einen deutschen Grabstein, schwarz, und es stehen deutsche Worte darauf.
Wie hat sie das geschafft? Sie bringt einen deutschen Grabstein mit deutschen Worten auf den jüdischen Friedhof am Ölberg! Aber sie liegt nicht darunter. Sie wurde auch als Tote noch einmal vertrieben, wahrscheinlich liegt sie längst in einem Massengrab. Da ist sie immerhin nicht allein. Sie war nicht gern allein.
Ich bleibe im Hintergrund, obwohl mich von den Deutschen, die da den schwarzen Stein bringen, niemand kennt. Meine Erinnerung an diese Frau ist nicht mit dem Meißel gehauen, sondern mit Tinte und Blei geschrieben. Ich weiß genau, wo die drei Kladden sind. Ich habe sie gehütet all die Jahre lang. Hätte ich sie veröffentlichen sollen? Unser gemeinsames Buch – ihr letztes und mein erstes?
«Machen Sie ein Märchen daraus», hatte sie befohlen. «Oder was Lustiges. Auf keinen Fall was für die Literaturwissenschaft! Sie dürfen alles damit machen. Sie sind doch ein Dichter!»
Während sie im Hadassah-Krankenhaus lag und starb, habe ich die drei Kladden aus ihrem Zimmer geholt. Ich habe sie nicht gestohlen, es war ein Auftrag. Ich habe Kommentare an die Ränder und zwischen ihre Zeilen geschrieben, ganze Seiten hinzugefügt, aber nichts an ihren Worten geändert. Ich begann damit bald nach ihrem Tod im Januar 1945, als man in Jerusalem noch trauern konnte um gerade mal 767 Juden, deren Schiff das Britische Mandat nicht landen ließ. Ich beendete diese Arbeit, als wir allmählich erfuhren, was in diesem Deutschland wirklich geschehen war. Die Katastrophe am Ende unseres gemeinsamen Buches begann – das Datum steht noch heute in der dritten Kladde – am 20. Januar 1942. Ich alterte so schnell, wie ich langsam begriff, was an diesem Tag in Berlin am Wannsee eingeleitet wurde. Danach habe ich nie wieder eine Zeile geschrieben.
Ein dunkler Stein, schwarz und glänzend, sie tragen seine deutsche Schrift vorbei an hebräischen Buchstaben. Ich will ihn später anschauen, allein.
Die Kladden werde ich nicht suchen müssen. Ob ich ihre Schrift noch lesen kann? Vielleicht besser als meine.
Die erste Kladde
Juni 1940 bis Ende 1940
Ich hatte sie mir nicht ausgesucht. Aber ich war jung, ich brauchte etwas zum Bewundern, zum Verehren, und es musste ein großer Dichter sein, doch es gab auch in einer Stadt wie Jerusalem mit einem überproportional hohen Dichteraufkommen außer ihr niemanden, der Verse geschrieben hatte wie:
Ich kann den Abend nicht mehr
Über die Hecken tragen.
Mit diesem Satz ging ich tagelang durch die Stadt, bis ich ihn urplötzlich verstand, aber nicht hätte erklären können, was ich verstand. Dann sah ich sie und wusste sofort, das ist sie!, denn sie war eine stadtbekannte Kuriosität, und ich war zutiefst erschrocken.

Man kann hier auf keinen Fall mit Murmeln spielen.
Obwohl es Kuhlen in den Steinen gibt, die alle hell sind, nicht alle gleich, aber alle hell, und wir zwei Krücken, mein Schirm und ich, gehen stockgerade durch diese Stadt, er hat den Knick kurz vor dem Griff, ich werde schon zwei Handbreit unter dem Atlaswirbel in die Schwanenhalskurve geworfen, wir blicken nach unten und stolpern selten, und wir schauen ins Helle, Jerusalem, das – das ist eine Stadt, Jeruschalajm, auch Kriechtiere schauen ins Licht. Mein Vater warf Diamanten unter den Kies auf den Gartenwegen, nicht nötig hier, hier ist der Bodensatz hell, alles, was Steinen einfallen kann zwischen Weiß und Grau und Sand, ist über die Gehwege gelegt, wir treten auf Morgennebel, Sommerwolken, Vanillecreme, Buttersemmeln, Knochen.
Aber die Kuhlen sind klein. Wie mit dem Daumen in den Stein gedrückt. Nicht mehr als eine Murmel hat darin Platz, kaum einmal zwei. Und Murmeln sind gesellige Knicker. Sie wollen beieinander sein, ganz dicht, Vögel in einem Nest, ein Wurf junger Hunde in einem Korb, Tote in einem Massengrab.

Meist trug sie schwarze Männerhosen, die ihr viel zu weit waren, dazu bunte Tücher und große Ohrringe. Sie schlurfte gebeugt, in sich zusammengefallen, zart und knochig, durch die Jaffa Road. Wenn aber etwas geschah, das sie empörte oder begeisterte, sei es dass ein Eseltreiber sein Tier schlug oder ein britischer Offizier Clark Gable ähnelte oder sie in einem jungen Juden den wiedergeborenen Jonathan erkannte, dann belebte sich ihr Körper, vor allem die großen Hände, mit denen sie den Eseltreiber ohrfeigte, Clark Gable nachwinkte oder auf Jonathan wies.
Mit Ohrfeigen ging sie, wie mit den meisten Dingen, großzügig um. Das behaupteten zumindest einige ihrer Bekannten. Betroffene? Im Juni 1940 galt der kurze Weg vom Hotel Vienna die Ben Yehuda Street hinauf, vorbei am Café Sichel und hinüber zum Hotel Atlantic als die ohrfeigenanfälligste Strecke in Jerusalem. Sie hatte nämlich im Hotel Vienna am Zionsplatz gewohnt, ihr Lieblingshotel bei allen ihren Palästinareisen. Nach Kriegsbeginn konnte sie nicht mehr in die Schweiz zurückkehren und musste das Vienna verlassen, weil es belegt war. Sie fand ein kleines Zimmer im Hotel Atlantic, aber sie vergaß nach jeder zweiten Tasse Kaffee, dass sie hatte umziehen müssen, und beendete ihre Stadtgänge regelmäßig an der Rezeption des Vienna, wo sie energisch nach ihrem Schlüssel verlangte. Wenn sie dann zum Atlantic ging, war sie schlecht gelaunt, und alle ihr Entgegenkommenden mussten mit Ohrfeigen rechnen, auch wenn sie keine Esel prügelten, es genügte, dass sie weder Clark Gable ähnlich sahen noch einem wiedergeborenen Jonathan.

Meine Tasche zieht mich nach unten. Sie ist schwer. Ich sollte nicht so viele Gedichte herumschleppen. Nicht solche. Aber ich kann die doch nicht auf den Caféhaustischen liegen lassen. Oder ich muss andere Gedichte schreiben. Die nicht so schwer runterhängen.

Sie saß in den Cafés, trank Kaffee, aß Anisplätzchen und schrieb Gedichte auf Rechnungen, Speisekarten und Zeitungsränder. Manchmal, wenn sie dann in ihrem Zimmer die Gedichte auspackte und fremde Rechnungen fand, ging sie zurück ins Café und wollte zahlen. Wenn man ihr sagte, das sei nicht ihre Rechnung, das müsse sie nicht zahlen, es sei auch schon bezahlt, wurde sie wütend und schrie, sie sei kein Bettler und schon gar kein Schmarotzer, sie sei reich. Oder aber sie knallte eine fremde Rechnung auf die Kuchentheke, behauptete, das habe sie nicht verzehrt, und verlangte das Geld zurück. So oder so – auf der Rückseite standen Gedichte.
Ich saß oft drei Tische von ihr entfernt, gerade so weit, dass ich sie unentdeckt beobachten konnte, und ich lauerte darauf, dass sie die Zettel auf dem Caféhaustisch liegen ließ, was nur selten geschah. Das aber war dann einer jener Tage, an denen ich nichts als glücklich war und einfach vergaß, wie viele Flüchtlingsschiffe vor Haifa lagen und nicht landen durften. Ich stürzte mich, kaum war sie gegangen, auf den Zettel, las das Gedicht und lernte es auswendig.
Der Tag, an dem sie sich zu mir umdrehte, war ein Sonntag. Es waren darum mehr Juden und Araber als Engländer auf der Straße und die Stadt wirkte wie befreit vom britischen Mandat. Ich sah sie, als sie aus dem Hotel Atlantic kam und über die Ben Yehuda Street, auf der sonntags nur wenige Autos fuhren, zum Café Sichel ging. Ich ließ sie an mir vorbeigehen, schaute ihr nach, ich dachte:
Meine Lieder trugen des Sommers Bläue
Und kehrten düster heim …
Da wandte sie sich um, wies mit dem Stockschirm auf mich, empört, sodass ich Schlimmeres als eine Ohrfeige erwartete, aber sofort sank der Zorn in ihrem Gesicht mit dem Schirm auf den Boden. Sie lächelte und ging weiter mit einer Kopfbewegung, die eine eindeutige Einladung war. Ich fühlte nach meinem Geldbeutel. Es war mir klar, dass ich würde zahlen müssen. Zum ersten Mal saß ich neben ihr an ihrem Lieblingstisch.
«Sie spionieren mir nach», sagte sie. «Was denken Sie sich eigentlich dabei?» Ich sagte:
«Mein Herz ist eine traurige Zeit,
Die tonlos tickt.»
Und damit waren wir Komplizen.
«Ich brauche einen verschwiegenen Freund für ein Geheimnis», sagte sie. «Sie schreiben doch Gedichte?»
Ich zögerte, aber dann nickte ich, und sie nannte mich Tasso. Es war die erste literarische Auszeichnung meines Lebens und es blieb die einzige. Ich wusste damals von ihrer Angewohnheit, allen ihren Freunden andere Namen zu geben, Gottfried Benn hieß bei ihr Giselheer, der Nibelunge. Mich aber nannte sie Tasso! In diesem Augenblick war ich frei von jeglichem Zweifel an ihrer prophetischen Gabe und hielt meine literarische Karriere für gesichert.
«Ich bin eine vorzügliche Menschenkennerin», sagte sie. «Ich irre mich nie. Und Sie sind treu, Sie folgen mir schon lange. Ich glaube, Sie sind der Mann, den ich suche.»
Ich rührte in meinem Kaffee und mied ihren Blick.
Sie sagte:
«Wenn ich tot bin, Spiele du mit meiner Seele.»
Da schaute ich sie an. Sie grinste.
Am nächsten Tag lief ich die Ben Yehuda Street auf und ab, doch sie war nicht da, auch nicht im Sichel. Erst als ich in die Jaffa Road einbog, sah ich sie. Sie ging Richtung Altstadt und schaute sich alle paar Meter um. Als sie mich entdeckte, kam sie sofort auf mich zu. Ich verstand, dass sie mich gesucht hatte.
«Wir dürfen uns nicht mehr im Sichel treffen», flüsterte sie. «Ich muss Sie vor meinen anderen Freunden verbergen wie meinen Geliebten vor meinen Ehemännern. Verstehen Sie?»
«Nein», sagte ich.
«Gut», nickte sie, «kommen Sie.»
Wir gingen – oder schlichen – zum Hotel Atlantic und hinauf in ihr Zimmer im ersten Stock. Kurz bevor wir die Ben Yehuda Street erreichten, fuhr ein britisches Polizeiauto mit Sirene vorbei. Sie schaute ihm nach, ich nicht. Ich hätte es gar nicht bemerkt, wenn sie nicht stehen geblieben wäre. Mein Hirn war ein vollkommen unaufgeräumter Zettelkasten mit Versen, es sagte alle ihre Gedichte gleichzeitig auf und die von etlichen anderen noch dazu, ich wusste nicht einmal, von wem die einzelnen Zeilen stammten, da sagte sie: «Wahrscheinlich jagen sie wieder Extremisten. Mögen Sie Extremisten?»
Aber sie wartete meine Antwort nicht ab, ging weiter, murmelte: «Es wird Zeit, dass hier jemand etwas unternimmt.»
Ihr Zimmer war klein. Es roch nach verfaultem Fleisch.
«Für mich allein würde es schon reichen», sagte sie. «Ich bin ja bescheiden. Aber ich lebe hier mit Jussuf und David. Jussuf» – sie zeigte auf den Tisch – «braucht nicht viel Platz. Für den König ist es jedoch zu eng. Er liebt die Weite.»
Auf dem Tisch lagen Zeichnungen, ich erkannte das Motiv, das also war er: Jussuf, der Prinz von Theben, ihr Alter Ego, ihre erfundene Identität, man sprach davon in der Stadt, diese Dichterin, die Verrückte, sie nannte sich Jussuf, mit diesem Namen unterschrieb sie nicht nur ihre Briefe, und häufig blieb offen, was man als verrückter ansah, dass sie damit als Mann auftrat oder dass sie Jakobs Sohn mit seinem arabischen Namen zitierte.
Von einem David sah ich jedoch nichts.
Jussuf führte hier also eine zweidimensionale Existenz. Man konnte ihn stapeln in allen seinen Erscheinungsformen, mit seinen Kamelen und den Kuppeln seiner Paläste. Sie hatte ihn gezeichnet: von vorn mit den Freunden, den Stern in der Stirn; allein im Profil, den Halbmond in der Schläfe; als Prinz; als Malik, erhängt in der Kammer; als gebeugten Gottsucher in der Wüste, und immer dasselbe Gesicht, ihr eigenes, vor dreißig Jahren, alles Jussuf.
«Ich habe Joseph verloren», sagte sie, «vor vielen Jahren schon. Nun aber werde ich alt und muss zurück zu den Anfängen, sonst kann ich nicht mehr schreiben. Ich werde mir Joseph jetzt neu erschreiben und Sie warten hier, ja?»
Das war eine Bitte, die flehentliche Bitte eines Kindes, das Angst hat, verlassen zu werden. Sie fing an, die Zeichnungen einzusammeln.
«Ich kann Ihnen leider keinen Stuhl anbieten. Den einen brauche ich zum Schreiben, der Schaukelstuhl gehört David. Kennen Sie Martin Buber?»
Bevor ich wusste, warum, hatte ich ein schlechtes Gewissen.
«Der Professor!», sie spuckte das Wort schräg an ihren Zeichnungen vorbei. «Was der alles weiß! Und mich verspottet er in aller Öffentlichkeit! Und in meiner Anwesenheit!»
Ich ging nicht darauf ein. Ich war selber in dem Vortrag gewesen, in dem Buber gesagt hatte, was Leute für Visionen hielten, seien Wahnvorstellungen. Da war sie aufgestanden und hatte den Saal empört verlassen. Einige hatten gelacht, auch ich. Und nun stand sie da, ihre Zeichnungen im Arm und sie sagte: «Und ich habe Visionen! David kommt zu mir, mal als singender, Harfe spielender Trostspender für den wahnsinnigen Saul, mal als Krieger, als tollkühner Kämpfer gegen die Philister, die Schleuder in der rechten Hand, Steine in der linken, mal als gebrochener Sünder heim in die Paläste schleichend von einer verbotenen Liebesnacht mit Bath Seba. Sehen Sie nur …»
Ich sah nichts.
«… heute ist er kindlich jung, der Hirtenknabe, nicht der König. Er hat den Irrsinn noch nicht flackern sehen im Auge des tobsüchtigen Saul, er kennt nur das Flackern des Hirtenfeuers, das ihm die Hände erwärmt, Finger wie Harfensaiten, die klingen in hell auflodernden Flammen, wenn er die Holzscheite richtet, David ganz ohne Goliath, die Schleuder, erschlafft in der Linken, hat noch keinen Stein geworfen, der auf einen Menschen gerichtet ist.»
Sie legte David, dem unsichtbaren Hirtenknaben im Schaukelstuhl, Jussuf, den Prinzen von Theben, handkoloriert, in den Schoß.
«David», flüsterte sie, «erkennt den Gezeichneten, das Mondmal in der Schläfe, das Sternzeichen auf der Stirn, durch Mond und Sterne gehen Träume ein und aus.»
Sie gab dem Schaukelstuhl einen kleinen Schubs. Sachte schaukelte der Sänger das Bildnis des Träumers.
Der Tisch war frei.
Und zum ersten Mal sah ich die Kladde, eine schwarze große Kladde, liniert, sie schrieb auf eine der ersten Seiten:

Joseph hieß der glänzende, schwarze Knopf, nachtschwarz mit goldenen Punkten, mit goldenen Punkten wie Sterne.

Ihr zuschauen, wie sie schrieb! Nicht mehr heimlich, wie sonst im Café Sichel, drei Tische von ihr entfernt und nur aus den Augenwinkeln blickend. Sie hatte mich gebeten zu bleiben. Sie brauchte mich. Ich war Teil ihres Gedichts.

Meine liebe Mutter hatte mir das Kästchen mit den Knöpfen geschenkt, weil ich mich immer so langweilte. Es war eine hölzerne Schatulle mit Intarsien auf dem Deckel. Unter Schnörkeln und Ornamenten aus poliertem Holz, pinienhell, kirschbaumrot, ebenholzdunkel, wohnten und hausten die Abgerissenen, die Herabgefallenen oder jene, die ihr fadenscheinig gewordenes Kleidungsstück überlebt hatten. Die meisten waren runde Scheiben aus Holz, Metall oder Perlmutt mit zwei oder vier Löchern. Das waren die einfachen Leute. Sie passten an Schürzen, Arbeitshemden, Alltagskleider. Ging einer verloren, fand sich immer ein ähnlicher in der Schatulle, der seinen Dienst übernehmen konnte. Man suchte nicht lang nach dem Vermissten, irgendwann wurde er mit Brotkrumen und Kartoffelschalen zusammengekehrt, notdürftig gereinigt und in die Schatulle geworfen, auf die rechte Seite, in das große Fach zu all den anderen schlicht durchlöcherten Scheiben, Werktagsknöpfe, die nur eine Aufgabe hatten in diesem Leben, nämlich durch ein Knopfloch zu schlüpfen und zwei Teile eines Kleidungsstückes zusammenzuhalten.
Auf der linken Seite des Kästchens residierten in separaten, sorgsam mit rotem Samt ausgeschlagenen Zimmern die feineren Leute. Da hatte jede Familie ihren Wohnsitz, gleichartige, gleichfarbene Knöpfe in groß und klein, die großen hatten sich einmal über Brust und Bauch eines Abendmantels gereiht, die kleinen breite Manschetten der Ärmel geschlossen. Auch hier gab es noch Unterschiede, elfenbeinerne und goldene, einige aus Schildpatt und Bernstein. Die sahen aus wie erstarrte Honigtropfen, immer leckte ich mir die Finger, wenn ich die berührt hatte, und immer schmeckten die Finger süß. Das kam aber nicht von dem Bernstein. Alles war süß in meinem Leben, als ich fünf Jahre alt war, später erst schmeckten die Finger salzig, wenn ich daran leckte. Eines aber war all den Knöpfen in den Samtkammern gemein: sie waren Kugeln, Halbkugeln, Kugelsegmente, keiner von ihnen war durchlöchert, durchbohrt. Die mit Löchern warf ich alle ohne jedes Erbarmen auf die rechte Seite in das große, übervolle Sammelabteil.
Die adligen Knöpfe in den samtenen Herrensitzen hatten auf ihrer Unterseite ein kleines metallenes Plättchen eingelassen, und daran war eine Öse befestigt, damit man auch sie annähen konnte an Taft, Flanell und Seide. Bei Joseph fehlte diese Öse, sie war irgendwann einmal abgebrochen, diese einzige Stelle, die seinen Sternenhimmel mit Stoff verband. Wenn aus dieser Gesellschaft einer verloren ging, weil ein mürbe gewordener Faden ihn nicht mehr hielt an einem Nachmittagskleid oder einem Gehrock, dann lagen sie auf den Knien, das Dienstmädchen und die Köchin, das Kindermädchen und der Hauslehrer, krochen über Parkett und Teppiche, tasteten unter Empire-Kommoden und Biedermeierschränken und suchten nach dem verlorenen Knopf. Am eifrigsten suchte ich selber, auch meine Schwestern, Anna zumindest, wenn die auch schon elf war, und häufig drückte sogar Paul, der jüngste meiner drei Brüder, die Bügelfalten seiner neuen Hosen platt. Allein schon wegen Paul liebte ich verlorene Knöpfe. Denn Paul war nun dreizehn, im letzten Jahr so rasch emporgewachsen, dass ich den Kopf weit in den Nacken legen musste, wenn ich zu ihm aufschaute, und da sieht man ja nichts als Nasenlöcher. Und weil Paul mich nicht auf den Arm nahm, wie meine angebetete Mutter, war Knöpfe suchen meine einzige Gelegenheit, seinem schönen Gesicht ganz nah zu sein. Wir machten ein Spiel daraus, jagten um Sessel und Tischbeine, als sei so ein Knopf ein fliehendes Karnickel, wir stießen die Köpfe gegeneinander und grinsten uns an, denn Paul kannte mein Geheimnis und hütete es. Wenn nämlich ich so glücklich war, den vermissten Knopf zu finden, so schloss ich schnell die Hand um diese Beute, diesen Schatz, und suchte eifrig weiter, bis man aufgab und sich mit dem Verlust abfand. Ich wusste, was dann stets geschah. Alle gleichgeformten Verwandten des Verlorenen wurden von dem betreffenden Kleidungsstück abgeschnitten und bezogen einen Ruhesitz in der Schatulle. Da konnte ich meinen Fund dann dazulegen, es zählte niemand mehr nach, und ich hatte eine neue Familie von höherem Stand. Sechs Familienmitglieder waren es mindestens, die auf diesem Weg in das Kästchen einzogen, meist mehr, und immer fügten sie sich in Sippschaften und Großfamilien, ich erkannte die Ähnlichkeit von Vettern und Cousinen, was nicht blutsverwandt war, war angeheiratet und hing über drei Knöpfe wieder mit diesen zusammen. Nur Joseph nicht, Joseph aus Jett, nachtschwarz mit goldenen Punkten wie Sterne. Der war einzig und blieb allein und hatte keine Brüder.
Nicht einmal eine Öse hatte er an seiner Unterseite, somit bestand keinerlei Hoffnung, ihn jemals wieder mit Stoff zu verbinden. Hat er überhaupt einmal eine Öse gehabt? War er nicht so wenig mit den anderen verwandt, dass er nur äußerlich wie ein Knopf erschien, in Wahrheit aber keiner war, niemals einer gewesen war und nur an seiner Oberseite als ein solcher auftrat, weil er denn doch irgendwo, wenn schon nicht an einem Kleidungsstück, so in jener Schatulle, ein Domizil haben musste. War es so? Es war nicht so. An seiner Unterseite verblieb die Stelle, wo die Öse abgerissen war, wie eine Wunde, ehemals scharfkantig, inzwischen abgeschliffen an marmornen Tischen und Fensterbänken, auch auf dem Parkett, das hatte Kratzer gemacht, nun machte es keine mehr, die Wunde war verheilt, es blieb eine Narbe, die eindeutig bewies, hier war einmal etwas gewesen, Joseph war ein Knopf wie die anderen Knöpfe auf dieser oder jener Seite der Schatulle.

Und ich stand noch immer mitten im Zimmer. Ich konnte mich nicht einmal an die Fensterbank oder wenigstens an eine Wand lehnen, und die Hoffnung, dass sie ein Gedicht von höchstens drei Strophen schreiben würde, hatte ich inzwischen aufgeben müssen.

Ich gab ihm eine eigene Kammer, mal ganz am Rande, mal mittendrin. Die anderen Herrschaften mussten dann umziehen. Das taten die gar nicht gern. Es waren sesshafte Leute, und Joseph war nicht besonders beliebt. Er brachte Unruhe in das feste Gefüge der Sippschaften und Familien, und nicht nur weil die umziehen mussten. Immer kollerten ein paar bislang nicht unangenehm aufgefallene Silber- oder Elfenbeinknöpfe aus ihrem Stammsitz in Josephs einsames Domizil, es war, als ob er sie anziehe, ja, einige der durchlöcherten, unscheinbaren Scheiben sprangen über die Barriere ins andre Abteil, in Josephs roten Samt, und manchmal, wenn ich nicht gut aufpasste, fiel er mir gar selber in die rechte Hälfte, in das Gedränge der Durchbohrten und Durchlöcherten, wo er doch überhaupt nicht hingehörte. Oder?
Einige gab es auf der samtenen Seite der Schatulle, die Joseph etwas weniger fremd schienen. Denn die hier heimischen halbkugeligen Schönheiten aus Bernstein und Elfenbein hatten keineswegs nur die nützliche Aufgabe, ein Kleidungsstück zusammenzuhalten. Sie waren Pracht und Zierrat zwischen Rüschen und Falten, sie sollten prunken auf Goldbrokat und Seidensatin, und manche waren zur puren Zierde aufgenäht, hatten sich niemals durch die Enge eines Knopflochs zwängen müssen, weder hinein noch hinaus. War Joseph einmal einer von denen gewesen? Wenn ich auf seinen Sternenhimmel blickte, glaubte ich es. Wenn er mir aber, mal wieder, unter die Durchlöcherten gefallen war und ich lange, befremdlich lange, darin wühlen musste, bis ich ihn endlich wiederfand, dann spürte ich, dass er sehr wohl wusste, was ein Knopfloch war.
Am liebsten schleppte ich die Schatulle unter den Tisch im großen Salon. Dort war mein Tempel. Im Rechteck der vier gedrechselten Säulen, umgeben von der geklöppelten Spitze der Tischdecke und den langen weißen Fransen, war ich Priesterin, Tempelhüterin, mehr noch: allmächtige Göttin. Denn dort kippte ich den Inhalt der Schatulle, rechte Seite und linke, wie ein böses Schicksal auf den Teppich. Und in diesen Teppich war mehr geknüpft als blumige Ranken. Zwischen Akanthusblättern und Arabesken kämpften wütende Krieger mit Schild und Speer, auf die Rücken fliehender Hirsche sprangen gefleckte Leoparden. Ich schauderte im Dämmerlicht meines Tempels, wühlte die mit den Ösen und die Durchlöcherten wüst durcheinander, sammelte mit flatternden Händen alle wieder in die Sicherheit der Schatulle. Und jedes Mal die beklemmende Frage: Wohin ist Joseph gefallen? Gern hätte ich ihn stets als Ersten gerettet vor den Speeren der Krieger, aus den Krallen der Leoparden, aber das tat ich nicht, denn Göttinnen, auch wenn sie erst fünf Jahre alt sind, müssen gerecht sein, und daran hielt ich mich.
Wenn alle wieder geborgen waren, nur Joseph, wo immer er war, Unordnung und Unruhe in der Schatulle verbreitete, legte ich mich erschöpft auf den Teppich ohne Angst vor wilden Männern und Tieren und lauschte auf den Tritt des Vaters und der Brüder, sah blanke schwarze Schuhe vorübergehen und darüber die Bügelfalten wie Kiele von Schiffen, die in den Himmel flogen, schaute und lauschte am liebsten auf das seidene Knistern der Rüschensäume meiner Mutter.

Ich sah mich um, ob ich mich nicht doch irgendwo setzen könnte. Der Fußboden war staubig, schmutzig, da verschimmelten Wurstreste. Auf ihrem Bett – aber niemals hätte ich es gewagt, mich auf ihr Bett zu setzen – räkelte sich Der bekehrte Satan, ihr Theaterstück, in vorerst drei Akten. Drei ist jedoch keine Frieden stiftende Anzahl für teuflische Akte auf einem Bett, zumal ihr Satan am Ende des 3. Aktes noch keineswegs bekehrt war. Ich blieb also stehen und entlastete wenigstens mal das eine, mal das andere Bein.

Und doch gab es einen bösen Traum in meiner schönen Welt, eine Angst hatte ich außer der um Joseph. Es kamen viele Gäste in das Haus meiner Eltern in der Sadowastraße. Sie saßen um den Tisch im großen Salon und lasen sich Gedichte und Theaterstücke vor, und unter diesen hatte ich Männer gesehen, die kaum Haare auf dem Kopf hatten, einige gar keine, nur einen ziemlich ergrauten Streifen fast im Genick.
«Das ist so, wenn man älter wird», hatte die Mutter erklärt und sogleich in meine erschrockenen Augen getröstet: «Nur bei Männern, nur bei Männern. Deinen schwarzen Haaren wird nichts Schlimmeres geschehen, als dass sie grau werden.»
Das hatte mich nur wenig beruhigt. Paul also würden die blonden Haare ausgehen! Wie schrecklich, wie furchtbar, wie vollkommen unvorstellbar! Das war mein böser Traum. Er wurde niemals Wirklichkeit. Paul verlor seine Haare nicht. Er starb mit 21 Jahren an einem Sonntag im Winter.
Aber ich hatte auch einen herrlichen Traum. Den konnte ich jederzeit träumen. Ich musste nur Joseph aus der Schatulle nehmen, ihn mit geschickten Fingern durch Krieger und Leoparden über den Teppich schieben, und schon spannen und webten meine Gedanken einen Stoff um den Knopf, ein Kleid, wie man es niemals, nicht auf den glänzendsten Festen in der Sadowastraße sah, einen bunten Rock, und es war jener, den Jakob seinem Lieblingssohn Joseph schenkte.
Ich kannte viele Geschichten aus der Bibel. Paul hatte sie mir erzählt, und immer wieder wollte ich die Geschichte von Joseph hören. Paul war gerne Jude. Später wollte er dann Christ werden, aber nicht weil er nicht mehr Jude sein wollte, sondern weil er Christus liebte. In jener Zeit konnte man einigermaßen unbeschadet Jude sein und reich dazu. Von dem «Hepp! Hepp, Jud!», das die anderen Kinder meinen Schwestern nachriefen, wusste ich nichts, ich ging ja noch nicht zur Schule. Damals geschah in Deutschland nichts Bedenklicheres, als dass unverhältnismäßig viele Dichter geboren wurden. Das freilich ist immer ein alarmierendes Zeichen, denn wenn die einmal so zwanzig, dreißig, vierzig Jahre alt sind, dann wollen sie ja alle etwas zu dichten haben, etwas zu klagen, zu leiden, Lob- und Jubeljahre machen Bücher nicht voll und fett. Man kann das also leicht vorhersagen: Wenn unverhältnismäßig viele Dichter geboren werden, dann müssen in dreißig, vierzig Jahren die schlimmsten Katastrophen geschehen. Ach, wenn man sie doch nur gleich in der Wiege erkennen würde, die neuen Dichter, man könnte ihnen Schilfrohrkörbchen flechten und sie auf Flüssen aussetzen, man könnte sie wilden Tieren zum Fraße vor- oder sie rechtzeitig ins Feuer werfen. Aber – würde das die Welt verbessern? Was wenn die Katastrophen nach vierzig Jahren trotz der rechtzeitig gemordeten Dichter ausbrächen? Und keine Verse wären da, keine Reime, die das Ungeheuerliche wenigstens in Strophen auffingen, der Nachwelt in die Lesebücher druckten. Die lernt’s auswendig, behält die Reime, vergisst das Unglück, ach, vielleicht doch, vielleicht hätte man mich doch rechtzeitig verbrennen sollen, ich hätte es ertragen, immer war mir diese Welt zu kalt – auf welche Weise hätte ich mehr, hätte ich weniger gelitten? Sechzig Jahre später brannten meine Bücher.