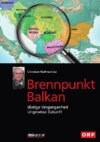Loe raamatut: «Im Kreuzfeuer», lehekülg 6
Die Sprachentrennung macht jedenfalls das ohnehin komplizierte und kaum regierbare bosnische Staatswesen nicht nur noch teurer. Sie erschwert auch das Zusammenwachsen der drei Volksgruppen, die im Grund genommen nur miteinander leben, weil es die USA und die europäischen Mittelmächte am Ende des Bosnien-Krieges 1995 so wollten. Wie mühsam dieses Zusammenwachsen auch noch mehr als zehn Jahre nach Kriegsende ist, zeigt der Schulunterricht. Zwar gehen Bosniaken, Kroaten und Serben in gemischten Gebieten nun wieder in dieselbe Schule, doch das Gemeinsame beschränkt sich oft auf das Gebäude und die Pausen. Denn gelehrt werden natürlich die drei Sprachen, und auch die Lehrpläne sind in politisch besonders sensiblen Fächern ebenso getrennt wie die Schulbücher. Was die Sprachen betrifft, wäre das etwa so, als würde für deutsche Schüler, die in Österreich in die Schule gehen, und für Österreicher, die Schulen in Deutschland besuchen, ein eigener Sprachunterricht bestehen. In Bosnien trägt somit das Bildungswesen zur fortgesetzten Trennung der Volksgruppen bei, anstelle verbindend und integrierend zu wirken. Viele „Internationale“ in Bosnien sind sich dieses äußerst fragwürdigen Zustands natürlich bewusst; daher kursierte unter ihnen auch folgender Witz: „Was ist eine Sprache? Ein Dialekt, der eine Armee hinter sich hat.“
Wie zutreffend dieser Witz ist, zeigt das Beispiel Montenegro, obwohl dort die Streitkräfte erst aufgebaut werden. Neben Serbien war Montenegro der einzige Staat, der vor dem Zerfall des alten Jugoslawien bereits auf dessen Territorium bestanden hatte. Sein bedeutendster Politiker und geistlicher Führer war Petar II., Petrović Njegoš, der von 1830 bis 1851 Montenegro als „Fürstbischof“ regierte. Sein Werk Der Bergkranz, dessen Erstausgabe 1847 in Wien gedruckt wurde, zählt zu den bedeutendsten Werken der serbischen Literatur.
Obwohl im Ersten Weltkrieg auf der Seite der Westmächte, wurde Montenegro nach 1918 an Serbien angeschlossen und verschwand von der Landkarte. Nach 1945 wurde Montenegro eine Teilrepublik des kommunistischen Jugoslawien. Die Bindungen zwischen Montenegro und Serbien waren so stark, dass Montenegro als einzige Teilrepublik auch nach dem blutigen Zerfall des alten Jugoslawien bei Serbien verblieb. Je mehr der Stern von Slobodan Milošević verblasste, desto stärker wurde auch der Widerstand in Montenegro, und 1998 kam es zum Bruch. Milo Đukanović, seit 1991 Ministerpräsident, setzte sich im innerparteilichen Machtkampf gegen die Milošević-Anhänger durch und siegte auch mit hauchdünner Mehrheit bei der Präsidentenwahl 1998. Damit begann die schrittweise politische Abspaltung, von der Einführung der Deutschen Mark als eigener Währung, die später durch den Euro ersetzt wurde, bis zur Übernahme der Kontrolle an den Grenzen; auch die staatlich betriebene Rückbesinnung auf die eigene Geschichte setzte ein. Dazu zählte die Herausgabe eigener Schulbücher, die bis dahin aus Serbien gekommen waren. An den Grenzen kam es zur Aufstellung von Schildern mit der Aufschrift Republik Montenegro, obwohl die Republik als Staat international noch gar nicht anerkannt war.
Trotz all dieser Maßnahmen zur Nationsbildung war Montenegro in der Frage der Loslösung von Serbien tief gespalten, weil sich etwa 30 Prozent der Bevölkerung als Teil der serbischen Nation begreifen. Daher kam es nach dem Ende der Ära Milošević in Serbien zunächst zur Bildung des Staatenbundes Serbien und Montenegro, einer Fehlgeburt, die drei Jahre dahinvegetierte und 2006 aufgelöst wurde. Denn acht Jahre nach dem Bruch zwischen Milošević und Đukanović Ende Mai 2006 stimmten schließlich beim Unabhängigkeitsreferendum 55,5 Prozent der Bevölkerung für die Selbständigkeit. Die 55-Prozent-Hürde, die die Europäische Union für die Anerkennung der Unabhängigkeit vorgegebenen hatte, wurde damit knapp übersprungen. 88 Jahre nach dem Anschluss erstand Montenegro wieder als selbständiger Staat. Dieser brauchte auch eine neue Verfassung, die schließlich im Oktober 2007 vom Parlament in Podgorica verabschiedet wurde. Zu den umstrittensten Artikeln zählt die Festlegung der Staatssprache, die bis zu diesem Zeitpunkt die serbische Sprache war. Schließlich fanden die Unabhängigkeitsbefürworter mit Vertretern der gemäßigten proserbischen Opposition einen Kompromiss, und Artikel 13 (Sprache und Schrift) der Verfassung lautet nun wie folgt:
„Die Amtssprache in Montenegro ist die montenegrinische Sprache. Das kyrillische und lateinische Alphabet sind gleichberechtigt. In amtlichem Gebrauch sind auch die serbische, bosnische, die albanische und die kroatische Sprache.“
Montenegro setzte damit einen weiteren Schritt zur Nationsbildung; je erfolgreicher dieser Staat auf dem Weg Richtung EU und NATO vor allem im Verhältnis zu Serbien sein wird, desto rascher wird das Bekenntnis zur montenegrinischen Nation wachsen. Dabei definiert sich Montenegro nicht als ethnisches Gemeinwesen, sondern als „Staat seiner Bürger“ (Artikel 1 der Verfassung), nicht zuletzt auch deshalb, um das ethnische Gleichgewicht zwischen den Volksgruppen nicht zu gefährden. Denn etwa fünf Prozent der Bevölkerung sind Albaner und sieben Prozent sind Bosniaken.
Die Einführung der montenegrinischen Staatssprache, die sich im täglichen Gebrauch de facto vom Serbischen noch weniger unterscheidet als das Kroatische, mag auf den ersten Blick skurril anmuten; doch gerade aus österreichischer Sicht ist Hochmut fehl am Platz. Denn nur wenige Monate, nachdem das Tausendjährige Reich des Oberösterreichers Adolf Hitler untergegangen war, ersetzte das österreichische Staatsamt für Unterricht im September 1945 das Lehrfach Deutsch durch den Begriff „Unterrichtssprache“. Diese Sprache wurde im Volksmund später „Hurdestanisch“ genannt, und zwar nach Unterrichtsminister Felix Hurdes, (1901–1974). Erst im Jahr 1955 kehrte das österreichische Unterrichtswesen dann endgültig zum Lehrfach Deutsch zurück. Über diese Sprachenpolitik hat Johann Georg Reißmüller in der FAZ vor einigen Jahren einen ausgezeichneten Artikel verfasst.2) Auch dieser Beitrag zeigt, dass Nationsbildungsprozesse durchaus ähnliche Muster aufweisen; das gilt auch für Montenegro und Österreich, die sich beide aus der „Konkursmasse“ eines größeren Staates verabschiedet haben. Im Fall Österreichs begünstigten die Großmächte jedoch diese Nationsbildung, während sie in Montenegro von ihnen erschwert wurde, war doch die EU kein Freund der Loslösung von Serbien, die schließlich nolens volens akzeptiert wurde.
Doch es geht in diesem Kapitel nicht um eine vergleichende Studie der Nationsbildung zwischen Österreich und Montenegro. Vielmehr soll der Blick dafür geschärft werden, dass Sprachenfragen und Sprachenpolitik zutiefst mit den Fragen der nationalen Identität (točno – tačno) verbunden sind. Der Kampf um die nationale Identität manifestiert sich daher insbesondere an den Schulen, weil Nationalitätenkonflikte eben auch Sprachenkonflikte sind. Je näher die Sprachen beieinander liegen, und je ungefestigter diese Nationen sind, desto erbitterter werden die Konflikte offenbar ausgetragen. Das gilt natürlich auch für das ehemalige Jugoslawien, dessen meiste Nachfolgestaaten – allen politischen Mythenbildungen zum Trotz – eben sehr junge eigenständige Nationen sind. Im Fall Bosnien und Herzegowina kann noch nicht einmal von einem gemeinsamen Staatsbewusstsein gesprochen werden, weil Serben, Kroaten und Bosniaken im Grund genommen auch mehr als zehn Jahre nach dem Krieg nicht freiwillig in einem Staat zusammenleben. Daher wird es noch einige Zeit brauchen, bis jener Witz umfassende Realität wird, der im Hotel Holiday Inn in Sarajevo spielt:
Unmittelbar nach dem Krieg kommt ein Gast in das Restaurant des Hotels und will beim Kellner eine Tasse Kaffee bestellen: „Hoću Kafu“ (Ich will Kaffee), sagt der Gast zunächst auf Serbisch. Der Kellner antwortet: „Ne može“ (Geht nicht). Denkt sich der Gast, der Kellner ist vielleicht gegen die Serben, daher wiederholt er die Frage auf Kroatisch: „Hoću Kavu“. Wiederum verneint der Kellner. Schließlich versucht es der Gast noch auf Bosnisch: „Hoću Kahvu“. Darauf reißt dem Kellner die Geduld, und er sagt: „Mein Herr! Mir ist es gleichgültig, ob sie Kafa, Kava, oder Kahva sagen. Wir haben kein Wasser!“
Anmerkungen
1) SCHMAUS, Alois: „Lehrbuch der serbokroatischen Sprache“. Max Huber Verlag, München, 1983.
2) REISSMÜLLER, Johann Georg, Frankfurter Allgemeine, 11. Februar 2004: „Was für eine Sprache haben die Österreicher in den ersten Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg gesprochen? Am 3. September 1945 gab das österreichische Staatsamt für Unterricht einen Erlaß heraus, der für die meisten Schularten an die Stelle der Lehrpläne aus der Zeit der Hitler-Herrschaft neue setzte. Darin hieß das Lehrfach Deutsch ,Unterrichtssprache‘. An der Spitze des Staatsamtes stand der Kommunist Ernst Fischer. Ging der Wechsel auf ihn zurück? Fischer betrieb damals eine radikale Entdeutschung Österreichs. Freilich mußte ihm der neue Sprachname auch etwas fragwürdig vorkommen. Er war ein talentierter Publizist und Schriftsteller; in den zwanziger Jahren führte das Wiener Burgtheater ein Stück von ihm auf. Sollte er jetzt sagen, er schreibe in ,Unterrichtssprache‘? Mancher Österreicher vermutete damals, Fischer habe eine Anordnung der Besatzungsmächte ausgeführt. Der sowjetischen folgte er gern; erst viele Jahre später überwarf er sich mit Moskau. Doch es ist ungewiß, ob sich die Siegermächte, die gewiß Österreich so weit wie möglich von Deutschland entfernen wollten, auf ein solches Umbenennen der Sprache einließen. Im Dezember 1945, nach der ersten Parlamentswahl, aus der die Kommunisten etwas armselig hervorgegangen waren, trat an die Stelle des Unterrichts-Staatssekretärs Fischer der Unterrichtsminister Felix Hurdes von der bürgerlichen Volkspartei. Anfang 1949 bekam das Fach Deutsch auch an den technischen und gewerblichen Lehranstalten den neuen Namen. Der Katholik Hurdes also in den Fußstapfen des Bolschewiken Fischer – oder auch er am Leitseil der Besatzungsmächte? Hurdes, der Konzentrationslagerhaft hinter sich hatte, war ein eifriger, sogar eifernder Gegner alles Deutschen in seinem Land. Die Mehrheit der Österreicher schrieb nun die unpopuläre ,Unterrichtssprache‘ allein ihm zu. Bald ging beißender Spott um: Hurdestanisch lernten die Kinder in der Schule, aus Österreich solle offenbar Hurdestan werden. Mit einem Erlaß vom 12. August 1952 wurde aus der ,Unterrichtssprache‘ die ,deutsche Unterrichtssprache‘. Da in Österreich Schulen mit deutscher, kroatischer, slowenischer und ungarischer Unterrichtssprache geführt würden, ergäben sich häufig Anfragen über die eindeutige Bezeichnung des Gegenstandes ,Unterrichtssprache‘. (…) Das war die amtliche Darstellung. Was die Regierung wirklich bewog, ,die Angelegenheit zu ordnen‘, scheint ihre Einsicht gewesen zu sein, daß die Bevölkerung über die Parteigrenzen hinweg die namenlose ,Unterrichtssprache‘ leid war. Hurdes war damals schon mehr als ein halbes Jahr nicht mehr im Ministeramt. Mit seinen christlich-sozialen solidaristischen Ideen war er, der gleich nach dem Krieg als Generalsekretär zur Führung der Volkspartei gehört hatte, an deren Rand geraten. Es war sein Nachfolger Ernst Kolb, der im August 1952 halb auf den alten Sprachnamen eingeschwenkt war. Im August 1955 schaffte der Nach-Nachfolger Drimmel die ,Unterrichtssprache‘ ganz ab. Auf dem Jahreszeugnis eines Wiener Realschülers vom Sommer 1956 sind von der Fachbezeichnung ,Deutsche Unterrichtssprache‘ das zweite Wort und der letzte Buchstabe des ersten mit schwarzer Tinte gestrichen, säuberlich mit dem Lineal. Erst ein Jahr darauf gab es überall neue, bereinigte Zeugnisformulare. Dabei ist es geblieben. Dieser Verlauf verfestigte in Österreich die Ansicht, Hurdes sei der Betreiber der ,Unterrichtssprache‘ gewesen. An Fischers Erlaß wollte sich niemand mehr erinnern. Und wenig Beachtung fand, daß Drimmel seinen Schlußstrich durch die ,Unterrichtssprache‘ zog, als Österreich mit dem Staatsvertrag von 1955 Souveränität, also Freiheit von der Einmischung der Siegermächte erlangt hatte. In der Verfassung hatte allerdings die ganze Zeit gestanden, daß, die deutsche Sprache die Staatssprache der Republik Österreich‘ ist. Wer auch immer Österreich die ,Unterrichtssprache‘ verordnet hat – wie mag er sich das Weitere vorgestellt haben? Sollten bald die Erwachsenen sagen, ihre Muttersprache heiße ,Unterrichtssprache‘? Sollte der monoglotte österreichische Außenminister Figl dem sowjetischen Außenminister launig gestehen, er verstehe nur ,Unterrichtssprache‘? Sollte er ausländische Botschafter dafür loben, daß sie sich schon so gut in ,Unterrichtssprache‘ zurechtfänden? Vielleicht war die Idee, wenn man den Schülern eintrichtere, sie lernten ,Unterrichtssprache‘, würden sie später vor ,Deutsch‘ als Namen ihrer Sprache zurückscheuen. Das wäre ein grotesker Irrtum gewesen.“
6.
Im Kreuzfeuer Mazedonien

Bei Kerzenschein zeigten sie mir ihre Bewaffnung: UÇK-Kämpfer in Mazedonien
Friede ist im Fernsehen nicht darstellbar“ – lautet eine zynische aber leider durchaus richtige Regel des Fernsehjournalismus. Daher erlebte ich nur wenige Monate nach dem Sturz von Slobodan Milošević am 5. Oktober 2000 in Serbien meine zweite journalistische Feuertaufe und zwar in Mazedonien. Dass es eine Feuertaufe im wahrsten Sinn Wortes werden sollte, ahnte ich nicht, als ich Mitte März zum ersten Mal nach Tetovo kam. Die Stadt ist albanisch geprägt1) und liegt im Nordwesten Mazedoniens. Vom Kosovo trennt sie der Gebirgszug Šar Planina, der militärisch kaum zu überwachen ist. Daher fiel es albanischen Freischärlern der UÇK nicht besonders schwer, sich über Gebirgspfade mit Waffen und Ausrüstung zu versorgen. Anders als im Kosovo-Krieg in der ersten Hälfte des Jahres 1999 war „UÇK“ nun aber nicht die Abkürzung für Ushtria Çlirimtare e Kosovës (Befreiungsarmee des Kosovos), sondern stand für Ushtria Çlirimtare Kombetare (Nationale Befreiungsarmee).
Dieser Unterschied im Namen bei gleicher Bezeichnung war mehr als nur semantischer Natur; trotzdem stammten viele Freischärler aus dem Kosovo oder hatten bereits dort oder in Südserbien gekämpft, wo ich mit ihnen in den Jahren 2000 und 2001 zum ersten Mal zusammengetroffen war.2) Denn das Verhältnis zwischen Serben und Albanern war und ist viel stärker belastet als jenes zwischen Mazedoniern und Albanern, die in Mazedonien vor, während und nach der blutigen Auseinandersetzung in der Regierung saßen. Vielfach dienten die Albaner als (korruptes) politisches Feigenblatt, während die Schaltstellen der Macht in den Händen der Mazedonier lagen (Polizei, Streitkräfte); trotzdem bleibt der Umstand der Regierungsbeteiligung bestehen. Daher richtete sich der Albaner-Aufstand nicht nur gegen die Mazedonier, sondern auch gegen die eigene politische Elite, die vielfach zu Recht als unfähig und korrupt empfunden wurde. Ebenso wichtig ist der zweite Faktor, durch den sich die Lage in Mazedonien gravierend von der im Kosovo unterschied. Im Kosovo kämpften die Albaner gegen eine tatsächlich bestehende serbische Unterdrückung, die ihr eigentliches Ziel, die Unabhängigkeit, legitimieren sollte. In Mazedonien waren die Albaner nicht unterdrückt aber vielfach diskriminiert, etwa im höheren Bildungswesen, das nur in mazedonischer Sprache absolvierbar war, oder im Zugang zur Verwaltung, zur Polizei und zu den Streitkräften. Die staatliche Einheit Mazedoniens wurde jedenfalls offiziell nicht in Frage gestellt, und die UÇK begründete ihren Kampf auch stets mit diesen Missständen und Diskriminierungen.
Begonnen hatte der Aufstand im Jänner 2001 mit einem Feuerüberfall auf eine Polizeistation im Norden des Landes. Als ich Mitte März nach Tetovo kam, hatten sich alle diplomatischen Beschwichtigungsversuche der Regierung in Skopje, die Lage sei unter Kontrolle und die Überfälle seien nur das Werk krimineller albanischer Banden, als unhaltbar erwiesen. Für mich war die Fahrt von Belgrad in das etwa 450 Kilometer entfernte Skopje und dann weiter nach Tetovo eine Fahrt ins Ungewisse. Erfahrungen mit Tränengas hatte ich schon beim Sturz von Slobodan Milošević gesammelt und mit albanischen Rebellen war ich bereits in Südserbien zusammengetroffen, wo die Gefechte weit weniger heftig gewesen waren als im Raum Tetovo. Doch diese Reise war meine erste Fahrt in ein richtiges Kampfgebiet.
Zum ersten Mal war ich Ende Mai 2000 in Skopje. Damals machte ich beim Champions-League-Finale im Handball zwischen Hypo Niederösterreich und Skopje Interviews mit österreichischen Spielerinnen. Wegen des Gesamtsiegs der Österreicher kam es zu beträchtlichen Ausschreitungen mazedonischer Anhänger: Trainer Gunnar Prokop wurde sogar niedergeschlagen. Wir konnten nach dem Spiel erst mit beträchtlicher Verspätung und unter Polizeischutz wieder in die Halle. Dort wartete ein Team des staatlichen mazedonischen Fernsehens, damit ich die Spielerinnen noch live befragen konnte. Im Übrigen war Reisen für mich damals mit großen bürokratischen Hindernissen verbunden. Ich hatte nur ein Ausreisevisum für Serbien und musste – von Fahrten nach Montenegro abgesehen – nach jeder Ausreise nach Wien zurück und bei der jugoslawischen Botschaft in Wien ein neues Einreisevisum beantragen, das aber unbürokratisch schnell erteilt wurde. Trotzdem blieb ein Unsicherheitsfaktor.
Journalistisch vorbereitet war ich auf den „Kampfeinsatz“ ein Jahr später überhaupt nicht; wertvolle Dienste bei Organisation und Lagebeurteilung leistete mir jedoch meine umfassende militärische Ausbildung als Milizoffizier des Bundesheeres. Doch mir fehlten Kontakte und Ansprechpartner in Mazedonien und so fuhr ich einfach Mitte März mit meinem serbischen Drehteam nach Tetovo. Auch alle meine Teams habe ich in gewisser Hinsicht militärisch und damit vorne angeführt; denn man kann keine spektakulären Bilder erwarten, wenn der Journalist im Hotel sitzt und das Kamerateam allein in die Gefahrenzone schickt. Ich ging stets voran, erkundete das Gelände und verhandelte mit Polizei, Militär und Aufständischen, sofern das Team nicht bessere Kontakte hatte. Aus diesem Grund verwende ich stets nur lokale Drehteams. Sie haben den nötigen Bezug zum Umfeld und die unerlässliche Kenntnis der örtlichen Gegebenheiten. Nach erstem Lehrgeld drehe ich auch nur mit Teams, die der jeweiligen Bevölkerung entstammen, um eventuelle Konflikte, Reibereien und Spannungen zu vermeiden.
Während wir in Skopje übernachteten, schliefen viele Journalisten direkt im Zentrum von Tetovo in einem „Hotel“, das in dieser Zeit das Geschäft seines Lebens machte. Gut verdient haben in dieser Zeit aber auch alle anderen Hotels in Skopje – und nicht nur sie. So fand sinnigerweise Anfang Mai – während EU, NATO und USA immer eindringlicher vor den Folgen der Kämpfe warnten – in Skopje eine Verteidigungsmesse statt. Alle wichtigen Waffenhersteller der Region waren vertreten. Angeboten wurde von der Tränengasgranate über das Schnellfeuergewehr bis hin zu gepanzerten Fahrzeugen alles, was man eben für ein Gefecht so braucht. Dazu zählten auch Fernrohre und Aufsätze für Scharfschützengewehre der Marke Swarowski. Zur Eröffnung hatten sich die Veranstalter etwas Besonderes einfallen lassen: Zur Musik der James-Bond-Filme traten vier Tänzerinnen in Kampfanzügen auf, um potenzielle Käufer so richtig in Stimmung zu bringen.
Topgrafisch gesehen wird Tetovo von einer Art „Schlossberg“ von den Überresten einer Festung aus osmanischer Zeit überragt. Am Berghang stehen viele kleine Häuser, zu denen verwinkelte Gassen führen. Einige dieser Häuser wurden immer wieder von mazedonischen Einheiten mit Artillerie beschossen, und viele Journalisten beobachteten das „Schauspiel“ bei Kaffee und Mineralwasser im kleinen Schanigarten des Hotels.
Relativ rasch kam ich über Interviews mit Albanern an einen jungen Verbindungsmann der UÇK. Verständigungsschwierigkeiten gab es praktisch nicht. Zwar beherrschte ich damals noch keine Grundbegriffe der albanischen Sprache, doch mit meinen Serbischkenntnissen ausgestattet hatte ich mich rasch ins Mazedonische eingehört, das fast alle Albaner sprechen. Außerdem war stets irgendein Albaner zur Hand, der in Deutschland, in der Schweiz oder in Österreich als Gastarbeiter sein Brot verdient hatte und jedenfalls radebrechend Deutsch konnte. Das galt auch für die UÇK selbst, dessen zweite – inoffizielle – „Kommandosprache“ aus den zuvor erwähnten Gründen Deutsch war. Dieses albanische Netzwerk ermöglichte es der UÇK, regelmäßig über die Art meiner Berichte in Österreich informiert zu werden. Ganz generell war und ist das Verständnis der Albaner für Kriegspropaganda weit besser entwickelt als das der Mazedonier und der Serben, die auch den Medienkrieg um den Kosovo klar verloren haben.
Wanderbares Mazedonien – Aufstieg zur UÇK
„Das halbe Leben des Soldaten heißt warten.“ Dieser Satz gilt auch für Journalisten, und so fuhren wir jeden Tag nach Tetovo und Umgebung auf der Jagd nach Bildern, neuen Geschichten und Kontakten. „Belohnt“ wurde ich schließlich durch unseren jungen Verbindungsmann, der mich mit anderen ausgewählten Drehteams zum Besuch eines lokalen Stabes der UÇK einlud. Allerdings durfte ich nur den Kameramann mitnehmen, während Tonmeister und Fahrer in Tetovo zu bleiben hatten. So wanderten wir denn über die Almen einem unbekannten Ziel entgegen. Das Wetter war ebenso schön wie die Landschaft, und ich hätte an einen Ausflug à la „Wanderbares Österreich“ denken mögen, hätten wir aus Tetovo nicht hin und wieder Artilleriefeuer gehört. Ich trug das Stativ, Kassetten und das Mikrofon, während mein serbischer Begleiter die etwa zehn Kilogramm schwere Kamera schleppte und außerdem mit schlechtem Schuhwerk und mangelnder Kondition zu kämpfen hatte. Unsere Mobiltelefone mussten wir deaktivieren, um die Funkpeilung zu erschweren. Dennoch gelang es mir, unsere Führer zu einer kurzen Ausnahme zu überreden. So verzog ich mich abseits in den Wald und setzte telefonisch einen kurzen Radiobericht für die Mittagssendungen ab. Leider hatte der Techniker im Funkhaus kein Verständnis für meine Lage, und so musste ich wegen mangelnder technischer Qualität den Beitrag dreimal wiederholen, was mich einige Nerven kostete.
Nach etwa zwei Stunden gelangten wir zu einem Dorf, in dem wir zum ersten Mal einige Kämpfer der UÇK zu Gesicht und auch vor die Kamera bekamen. Am frühen Nachmittag wurden die Journalisten allerdings von ihren Kameraleuten getrennt. Die Zeit wurde langsam knapp, denn für 19.30 Uhr hatte ich einen Beitrag für die Hauptabendnachrichten im Fernsehen zu produzieren und außerdem war ein Liveeinstieg geplant. Doch ich konnte den Kameramann weder finden noch telefonisch erreichen – sein Telefon verfügte nicht über Roaming und funktionierte daher nur in Serbien. Ich vereinbarte also mit den albanischen Aufständischen folgenden Handel: Der Kameramann sei nicht als Serbe, sondern als Kameramann des österreichischen Staatsfernsehens zu betrachten und entsprechend zu behandeln. Er würde gemeinsam mit anderen Teams nach Tetovo zurückkehren und dort – geschützt und bewacht von der UÇK – übernachten. In der Nacht herrschte Ausgangssperre, daher konnten wir ihn nach der Sendung in Tetovo nicht abholen.
Ich selbst bekam einen eigenen Führer, mit dem ich den Weg vom Dorf über die Almen im Laufschritt zurücklegte, um wenigstens den Liveeinstieg nicht zu verlieren. (Von meiner Kondition beeindruckt bot mir der Führer an, doch in die UÇK als Kämpfer einzutreten. Hätte ich zusagen sollen? Doch natürlich lehnte ich ab, hatte ich doch eine Familie zu versorgen, und fremde Kriege führe ich nicht.) Trotzdem war ich erst nach 18 Uhr wieder in Tetovo, und wir schafften es gerade noch rechtzeitig zum Liveeinstieg nach Skopje, während der Beitrag an diesem Tag mit Agenturbildern von Wien aus produziert wurde.
Den Kameramann holten wir am nächsten Morgen in Tetovo ab. Er hatte – geschützt von der UÇK – in einem kleinen Motel nur unter Albanern übernachtet. Er dürfte einer der wenigen Serben gewesen sein, der je unter dem Schutz albanischer Freischärler gestanden ist. Wäre ich mit ihm allein in dem Albaner-Dorf gewesen, so hätte ich ihn niemals zurück gelassen; doch gemeinsam mit anderen westlichen Journalisten und Teams war diese Entscheidung durchaus vertretbar, zumal auch Kameraleute wissen sollten, wie sie sich auf den Einsatz in Krisengebieten vorzubereiten haben.
Im Kreuzfeuer
Drei Dinge sind in Kampfgebieten besonders gefährlich: Minen, Scharfschützen und unvorhersehbare Zwischenfälle. Vermintes Gelände lässt sich weitgehend vermeiden, wenn man den Anweisungen von Polizei und Militär folgt und sich an die Informationen der ortsansässigen Bevölkerung hält. Scharfschützen hingegen sind Schicksal; so verfügten die Albaner in Mazedonien auch über großkalibrige Scharfschützengewehre mit einer Einsatzschussweite von mehr als einem Kilometer. Scharfschützen waren einer der Gründe, warum ich auch in Kampfzonen stets Krawatte und Sakko, aber niemals Splitterschutzweste und Helm getragen habe. Dadurch wollte ich vermeiden, mit einem Kombattanten verwechselt zu werden; außerdem behindern Weste und Helm die Arbeit und schränken die Beweglichkeit drastisch ein. Gegen gute Scharfschützen sind sie wertlos, weil diese auf den Kopf zielen. Es ist eben wie bei der Formel I: Wer ins Rennauto steigt, muss als Fahrer damit rechnen, dass er sterben kann. Es ist die freie Entscheidung des Journalisten, ins Kampfgebiet zu gehen, daher verdient er ebenso wenig Bewunderung wie ein Rennfahrer, der allerdings für sein Rennen weit besser ausgestattet und (leider) noch um vieles besser bezahlt wird als der Journalist im Krisengebiet.
Am gefährlichsten sind jedoch unvorhersehbare Ereignisse wie sie mir am 22. März 2001 in Tetovo widerfuhren. An einer kleineren Stadteinfahrt hatte die Sonderpolizei Wache bezogen. Die Kreuzung war gut gewählt. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite dienten Häuser als natürliche Deckung; auf der anderen Seite stand ein Kiosk; er bildete die Rückwand für einen halbkreisförmigen Kontrollposten, den die Sonderpolizei aus Sandsäcken errichtet hatte. Rechts davon stand eine Art Panzerspähwagen. Mehrere Polizisten waren in diesem Provisorium in Bereitschaft, einer davon auf der Lauer mit dem Gewehr im Anschlag. Von dieser Position aus konnte nicht nur die Einfahrtsstraße, sondern auch der „Schlossberg“ überwacht und beschossen werden.
Umlagert war dieser Kontrollposten natürlich auch von Kamerateams, die auf verwertbare Bilder hofften. Ich selbst versuchte, mich bei den Sonderpolizisten bekannt zu machen. Wenn schon keine verwertbaren Informationen herausspringen, kann ich vielleicht das Klima entspannen, was das Drehen erleichtern würde, dachte ich mir. Daher kaufte ich eine Flasche Weinbrand und schenkte sie den Polizisten, die mich auf einen Schluck in ihren Posten einluden. Zwei Polizisten und ich saßen auf dem Boden auf Sandsäcken und plauderten. Plötzlich eröffnete der wachhabende Polizist das Feuer; ich warf mich zu Boden, die Polizisten griffen über mich hinweg zu ihren Kalaschnikows und feuerten ebenfalls. Als es nach wenigen Augenblicken wieder still war, schlich ich mich seitwärts aus dem Kontrollposten und schaute auf die Straße. Ich sah einen alten Kleinwagen mit geöffnetem Kofferraum und geöffneten Vordertüren: Zwei Männer lagen neben dem Fahrzeug, ein alter Mann und sein Sohn in mittleren Jahren. Was geschehen war, erfuhr ich unmittelbar danach und habe es vielfach auf dem gedrehten Material gesehen.
Alles begann ganz normal mit einer Verkehrskontrolle durch die Sonderpolizisten. Der alte Mann auf dem Beifahrersitz und sein Sohn mussten aussteigen; es kam wohl zu einem Wortwechsel und statt seiner Papiere zückte der Fahrer eine Handgranate, um sie in den Kontrollposten zu werfen, in dem ich gerade saß. Die Polizisten reagierten schneller, erschossen beide Männer und ersparten es so dem ORF, den Job eines Balkan-Korrespondenten neu auszuschreiben, denn die Splitterwirkung der Handgranate wäre in diesem engen Raum wohl tödlich gewesen. Ich verständigte kurz und knapp Familie und ORF – und die Arbeit ging weiter, hatten wir doch nun spektakuläre Bilder für die Zeit im Bild. Albanische Medien schrieben tags darauf, der Fahrer habe nur ein Mobiltelefon in den Kontrollposten werfen wollen, doch das war natürlich haarsträubender Unsinn. Die letzten Schüsse waren gerade verhallt, und schon nutzte ein griechischer Journalist den grausigen Hintergrund als Kulisse für einen „Aufsager“, das ist eine Art Kommentar, bei dem der Journalist mit seinem Mikrophon im Bild zu sehen ist. Die meisten meiner Kollegen und ich selbst haben uns stets bemüht mehr Pietät zu zeigen, vor allem wenn es sich eindeutig um menschliches Leid handelte. Hinzu kommt, dass die Regeln des ORF recht streng sind, und die „besten“ Bilder ohnehin nicht gezeigt werden dürfen. Generell bin ich für eine realistische Darstellung, denn Kriege, Konflikte und Kämpfe sind zwangsläufig mit dem Tod verbunden. Und das sollte auch gezeigt werden, wenn auch das Wie immer diskussionswürdig bleibt. Leichenbeschau und Begräbnis der beiden Männer fanden am nächsten Tag statt. Über meinen UÇK-Gewährsmann erhielten wir das Angebot, beide Ereignisse aus besonders guter Position zu filmen, wenn ich bereit wäre, die Aufnahmen den Hinterbliebenen in Kopie zu überlassen. Diese entpuppten sich als langjährige Gastarbeiter in Niederösterreich, und die Übergabe der Videokassette fand schließlich in einem Wiener Kaffeehaus statt. Bei dieser Gelegenheit fragte mich der Albaner, ob sein Verwandter nicht doch ein Mobiltelefon habe in den Stützpunkt werfen wollen. Ich sagte, es sei leider wirklich eine Handgranate gewesen; und bei allem Verständnis für den schmerzlichen Verlust sei ich den Polizisten eigentlich dankbar, denn sonst könnte ich in Wien wohl kaum gemütlich meine Melange trinken. Diese offenen Worte taten der Freundschaft keinen Abbruch. Jedes Mal, wenn der Gastarbeiter während des Konflikts zu seiner Familie nach Tetovo fahren wollte, rief er mich an, ob die Lage auch sicher genug für diese Reise sei. Als die Kämpfe schließlich unter Vermittlung von EU und NATO Mitte August 2001 mit dem Friedensabkommen von Ohrid endeten, schenkte mir der Mann meine erste Grammatik der albanischen Sprache, die ich nach wie vor benutze, um meine Kenntnisse zu verbessern.
Tasuta katkend on lõppenud.