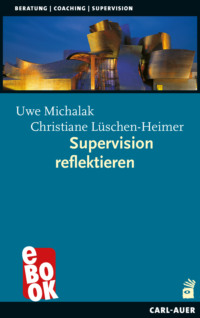Loe raamatut: «Supervision reflektieren»
Die Reihe »Beratung, Coaching, Supervision«
Die Bücher der petrolfarbenen Reihe Beratung, Coaching, Supervision haben etwas gemeinsam: Sie beschreiben das weite Feld des »Counselling«. Sie fokussieren zwar unterschiedliche Kontexte – lebensweltliche wie arbeitsweltliche –, deren Trennung uns aber z. B. bei dem Begriff »Work-Life-Balance« schon irritieren muss. Es gibt gemeinsame Haltungen, Prinzipien und Grundlagen, Theorien und Modelle, ähnliche Interventionen und Methoden – und eben unterschiedliche Kontexte, Aufträge und Ziele. Der Sinn dieser Reihe besteht darin, innovative bis irritierende Schriften zu veröffentlichen: neue oder vertiefende Modelle von – teils internationalen – erfahrenen Autoren, aber auch von Erstautoren.
In den Kontexten von Beratung, Coaching und auch Supervision hat sich der systemische Ansatz inzwischen durchgesetzt. Drei Viertel der Weiterbildungen haben eine systemische Orientierung. Zum Dogma darf der Ansatz nicht werden. Die Reihe verfolgt deshalb eine systemisch-integrative Profilierung von Beratung, Coaching und Supervision: Humanistische Grundhaltungen (z. B. eine klare Werte-, Gefühls- und Beziehungsorientierung), analytisch-tiefenpsychologisches Verstehen (das z. B. der Bedeutung unserer Kindheit sowie der Bewusstheit von Übertragungen und Gegenübertragungen im Hier und Jetzt Rechnung trägt) wie auch die »dritte Welle« des verhaltenstherapeutischen Konzeptes (mit Stichworten wie Achtsamkeit, Akzeptanz, Metakognition und Schemata) sollen in den systemischen Ansatz integriert werden.
Wenn Counselling in der Gesellschaft etabliert werden soll, bedarf es dreierlei: der Emanzipierung von Therapie(-Schulen), der Beschreibung von konkreten Kompetenzen der Profession und der Erarbeitung von Qualitätsstandards. Psychosoziale Beratung muss in das Gesundheits- und Bildungssystem integriert werden. Vom Arbeitgeber finanziertes Coaching muss ebenso wie Team- und Fallsupervisionen zum Arbeitnehmerrecht werden (wie Urlaub und Krankengeld). Das ist die Vision – und die politische Seite dieser Reihe.
Wie Counselling die Zufriedenheit vergrößern kann, das steht in diesen Büchern; das heißt, die Bücher werden praxistauglich und praxisrelevant sein. Im Sinne der systemischen Grundhaltung des Nicht-Wissens bzw. des Nicht-Besserwissens sind sie nur zum Teil »Beratungsratgeber«. Sie sind hilfreich für die Selbstreflexion, und sie helfen Beratern, Coachs und Supervisoren dabei, hilfreich zu sein. Und nicht zuletzt laden sie alle Counsellors zum Dialog und zum Experimentieren ein.
Dr. Dirk Rohr
Herausgeber der Reihe »Beratung, Coaching, Supervision«
In Erinnerung an Stephan Baerwolff und Hans Schindler
»Wie gerne würde ich mir als Fremder einmal zuhören, ohne mich zu erkennen, und später erst erfahren, dass ich es war.« Elias Canetti
Uwe Michalak
Christiane Lüschen-Heimer
Supervision reflektieren
2021

Mitglieder des wissenschaftlichen Beirats des Carl-Auer Verlags:
Prof. Dr. Rolf Arnold (Kaiserslautern)
Prof. Dr. Dirk Baecker (Witten/Herdecke)
Prof. Dr. Ulrich Clement (Heidelberg)
Prof. Dr. Jörg Fengler (Köln)
Dr. Barbara Heitger (Wien)
Prof. Dr. Johannes Herwig-Lempp (Merseburg)
Prof. Dr. Bruno Hildenbrand (Jena)
Prof. Dr. Karl L. Holtz (Heidelberg)
Prof. Dr. Heiko Kleve (Witten/Herdecke)
Dr. Roswita Königswieser (Wien)
Prof. Dr. Jürgen Kriz (Osnabrück)
Prof. Dr. Friedebert Kröger (Heidelberg)
Tom Levold (Köln)
Dr. Kurt Ludewig (Münster)
Dr. Burkhard Peter (München)
Prof. Dr. Bernhard Pörksen (Tübingen)
Prof. Dr. Kersten Reich (Köln)
Dr. Rüdiger Retzlaff (Heidelberg)
Prof. Dr. Wolf Ritscher (Esslingen)
Dr. Wilhelm Rotthaus (Bergheim bei Köln)
Prof. Dr. Arist von Schlippe (Witten/Herdecke)
Dr. Gunther Schmidt (Heidelberg)
Prof. Dr. Siegfried J. Schmidt (Münster)
Jakob R. Schneider (München)
Prof. Dr. Jochen Schweitzer (Heidelberg)
Prof. Dr. Fritz B. Simon (Berlin)
Dr. Therese Steiner (Embrach)
Prof. Dr. Dr. Helm Stierlin (Heidelberg)
Karsten Trebesch (Berlin)
Bernhard Trenkle (Rottweil)
Prof. Dr. Sigrid Tschöpe-Scheffler (Köln)
Prof. Dr. Reinhard Voß (Koblenz)
Dr. Gunthard Weber (Wiesloch)
Prof. Dr. Rudolf Wimmer (Wien)
Prof. Dr. Michael Wirsching (Freiburg)
Prof. Dr. Jan V. Wirth (Meerbusch)
Themenreihe »Beratung, Coaching, Supervision«
hrsg. von Dirk Rohr
Reihengestaltung: Uwe Göbel
Umschlaggestaltung: Heinrich Eiermann
Umschlagfoto: © Richard Fischer, www.richardfischer.org
Satz: Drißner-Design u. DTP, Meßstetten
Illustrationen: Hannah Eller
Printed in Germany
Druck und Bindung: CPI books GmbH, Leck
Erste Auflage, 2021
ISBN 978-3-8497-0355-4 (Printausgabe)
ISBN 978-3-8497-8247-4 (ePUB)
© 2021 Carl-Auer-Systeme Verlag
und Verlagsbuchhandlung GmbH, Heidelberg
Alle Rechte vorbehalten
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Informationen zu unserem gesamten Programm, unseren Autoren und zum Verlag finden Sie unter: https://www.carl-auer.de/
Wenn Sie Interesse an unseren monatlichen Nachrichten haben, können Sie dort auch den Newsletter abonnieren.
Carl-Auer Verlag GmbH
Vangerowstraße 14 • 69115 Heidelberg
Tel. +49 6221 6438-0 • Fax + 49 6221 6438-22
Inhalt
Vorwort
1Einleitung
1.1Vorüberlegungen zu Reflexivität und Reflexion
Reflexivität
Reflexion
Reflexionsebenen
1.2Weshalb sich Reflexion und Reflexivität lohnen
Reflexivität fördert die eigene Professionalisierung
Weitere nützliche Effekte von Reflexion und Reflexivität
21 plus 5 Aspekte für eine konstruktive (Selbst-)Reflexion
2.1Selbstreflexion
Realisierung des Fokus Selbstreflexion
Grundsätze der Reflexion im Hinblick auf Selbstreflexion
Durchführung einer Selbstreflexion
2.2Haltung und Rolle
Realisierung des Fokus Haltung
Realisierung des Fokus Rolle
Grundsätze der Reflexion im Hinblick auf Haltung
Grundsätze der Reflexion im Hinblick auf Rolle
Durchführung einer Reflexion zu Haltung und Rolle
2.3Supervisionskonzept
Realisierung des Fokus Supervisionskonzept
Grundsätze der Reflexion im Hinblick auf das Supervisionskonzept
Durchführung einer Reflexion zum Supervisionskonzept
2.4Arbeitsbeziehung
Realisierung des Fokus Arbeitsbeziehung
Grundsätze der Reflexion im Hinblick auf die Arbeitsbeziehung
Durchführung einer Reflexion zur Arbeitsbeziehung
2.5Supervisanden-System
Realisierung des Fokus Supervisandin
Grundsätze der Reflexion im Hinblick auf Supervisanden
Durchführung einer Reflexion zu Supervisanden
2.6Prozessführung
Realisierung des Fokus Prozessführung
Grundsätze der Reflexion im Hinblick auf Prozessführung
Durchführung einer Reflexion zur Prozessführung
3Methoden der Selbstreflexion
3.1Methoden zur Selbstreflexion des Aspekts Selbstreflexion
1) Echte Schatzkiste (verändert nach Friebe 2016, S. 101)
2) Inneres Team als Reflecting Team
3) Bilanzieren
3.2 Methoden zur Selbstreflexion des Aspekts Haltung und Rolle
1) Der Beobachterstuhl
2) Memory der Glaubenssätze
3.3Methoden zur Selbstreflexion des Aspekts Supervisionskonzept
1) Konzeptentwicklung mithilfe der Plausibilitätsbrücke
2) Stellenanzeige
3.4Methoden zur Selbstreflexion des Aspekts Arbeitsbeziehung
1) fünf Mündern sprechen – mit fünf Ohren hören (verändert nach J. Friebe 2016, S. 201)
2) Schicksalsnarration
3.5Methoden zur Selbstreflexion des Aspekts Supervisandin
1) Anliegenorientierung im Supervisionsdreieck
2) Kontextorientierung im Supervisionsdreieck (Teamsupervisionen)
3) Visualisierte Aufstellung
4) Selbst-Tetralemma
3.6Methoden zur Selbstreflexion des Aspekts Prozessführung
1) Dimensionen der Supervision
2) Prozesse malen
4Selbstreflexion in der Praxis
Literatur
Über die Autoren
Vorwort
Zu jeder Profession gehören Instrumente der Professionalisierung. Im Hinblick auf die Qualität der geleisteten Arbeit sind sie unverzichtbar. Nicht alle dieser Instrumente sind jedoch der Beobachtung direkt zugänglich, wie zum Beispiel die Selbstreflexion.
Die Kernkompetenz der Beratung liegt darin, das Medium der Kommunikation zu pflegen – in diesem Falle also das Selbst der Supervisoren.
Für beraterische Kontexte stellt die Supervision die organisierte Selbstreflexion der Beruflichkeit dar. Unter Beruflichkeit verstehen wir die Zusammenführung folgender Aspekte: berufliche Biografie, berufliche Themen, Kontexte und Emotionen sowie Strukturen und Strategien, die mit den Arbeitsbereichen des Menschen und seiner Beschäftigung zusammenhängen. Supervisoren durchlaufen selbst eine stetige professionelle Entwicklung. Sie fungieren als Dienstleister für ihre Klienten und sollten, vergleichbar mit einem Handwerksbetrieb, auf dem aktuellen Stand der Zunft sein. Was gilt in der Supervision als State of the Art der Profession? Methoden und Fragetechniken für das Beratungshandeln lassen sich in Weiterbildungen erlernen und durch Workshops ergänzen. Die Reflexion des Selbst wird allerdings immer eine intime Angelegenheit bleiben.
Im systemischen Verständnis steht die eigene professionelle Haltung im Zentrum. Sie schöpft aus der tiefen Überzeugung, die Autonomie der Supervisanden unbedingt zu respektieren. Die entscheidende Fähigkeit für die supervisorische Tätigkeit besteht darin, eine Metaposition einzunehmen. Sie ermöglicht einen respektvollen, allparteilichen Blick auf die Lebenswelt des Supervisanden und die Kontexte seiner professionellen Welt. Diese Haltung modelliert das Denken und jegliches Handeln. Sie obliegt einer stetigen Veränderung und sollte kontinuierlich überprüft werden. Hierzu dient die Reflexion des Selbst und der supervisorischen Professionalität.
Selbstreflexion als Kompetenz ist nur in der Praxis erfahrbar. Weder das Lernen am Modell noch kognitive Überzeugungen reichen aus, um ihr Potenzial entfalten zu können. Um sich der Anstrengung der Selbstreflexion auszusetzen, braucht es eine tiefe innere Überzeugung und einen sinngebenden Attraktor. Erst die nicht instruierbare Entscheidung, sich mit sich, seinen Bedürfnissen und seinen geliebten wie ungeliebten Anteilen auseinanderzusetzen, eröffnet die Möglichkeit zur Selbstreflexion. In Weiterbildungen und Workshops kann man lediglich die Rahmenbedingungen für eine solche Entscheidung zur Reflexion schaffen. Treffen muss sie jeder Mensch selbst und immer wieder neu, ohne dass es hierfür einer Rechtfertigung bedarf. Unser Buch will zu einer Gestaltung der Rahmenbedingungen einladen und überzeugende Motive für eine Selbstreflexion vorstellen.
Ein professionelles Selbstverständnis auszubilden verstehen wir als fortlaufenden Prozess. Es gehört zum Handwerk der systemischen Supervision, die Selbstreflexion des eigenen Wertesystems, der ethischen Begrenzungen und der praktischen Umsetzung stetig fortzuführen. Selbstreflexion gemahnt auch zur Selbstfürsorge, da der differente Blick Schuldzuschreibungen an sich selbst und andere prüft.
Selbstreflexion ist manchmal ein mühsamer Prozess, sicherlich! Aber welcher Beruf kann schon von sich behaupten, dass quasi als Nebenprodukt eine lebenslange Weiterentwicklung des eigenen Selbst gewonnen wird? Man kann es als impliziten Lohn der Arbeit betrachten, der Idee zu folgen: Erkenne dich selbst.
Reflexionen können auf verschiedenen Wegen stattfinden. Unser Vorgehen verstehen wir als einen möglichen und hilfreichen Weg, supervisorische Prozesse fruchtbar zu bedenken und zu gestalten.
Diese professionelle Reflexion kann beispielsweise im Austausch mit anderen Supervisoren stattfinden. Sie können aus verwandten oder anderen Denkrichtungen stammen. Diese erste Form der kollegialen Beratung wird als Intervision bezeichnet. Der Austausch findet auf einer gleichberechtigten Ebene statt. Die Teilnehmenden sind mit der Tätigkeit der Supervision vertraut und wissen, wovon und worüber sie sprechen.
Die Reflexion supervisorischer Prozesse kann zweitens aber auch als eigene Supervision durch die Begleitung eines Supervisors stattfinden. Der Supervisor ist dann Begleiter der zweiten Ordnung – seine Haltung des Nichtverstehens kann anregend und hilfreich sein.
Die dritte Möglichkeit der Reflexion ist die Selbst-Supervision. Selbstverständlich findet sie auch in den beiden oben genannten Settings ihren Platz. Denn das, was durch äußere Impulse angeregt wird, setzt sich in der eigenen Reflexivität fort und kann wiederum in den Austausch mit anderen einfließen. Selbstreflexion lässt sich auch als eine eigenständige Vorgehensweise verstehen. Wir möchten Sie als Leserin und Leser gerne dazu ermutigen, sie als solche aktiv zu nutzen – nicht zuletzt deshalb, weil sie permanent zur Verfügung steht. Eine Selbstreflexion des supervisorischen Arbeitens kann während, direkt nach oder mit Abstand zu den Beratungsprozessen stattfinden.
Sich selbst in einem eigenständigen Format in seinen eigenen Konstrukten kritisch zu hinterfragen kann vorteilhaft sein, weil man diese besonders gut kennt und sie sich leichter eingestehen kann, wenn sie nicht öffentlich gemacht werden müssen. Gleichzeitig braucht es Mut, genau diese Konfrontation zu leisten, die niemand kontrollieren kann. Wenn Menschen den Mut aufbringen, Konstrukte und Muster zu hinterfragen, um sie möglicherweise zu verändern, führt das zu einer neuen Stufe der Entwicklung, die großzügiger auf das Selbst und damit auch auf andere blicken lässt.
All solche Überlegungen haben uns motiviert, dieses Buch zu schreiben. Es ist aus der Mühe und der Freude geboren, uns der alltäglichen Konfrontation mit uns selbst durch den Blick in den Spiegel des eigenen professionellen Handelns zu stellen. Manchmal entsteht dabei die Frage, warum wir einen Beruf gewählt haben, in dem wir uns immer wieder mit uns selbst auseinandersetzen müssen. Eine Antwort ist die Freude an der Vielfältigkeit im Kontakt mit Menschen und Systemen.
So entstand der Wunsch, etwas zu entwerfen, das die Selbstreflexion etwas leichtgängiger macht. Dementsprechend haben wir Aspekte betrachtet, die für uns in supervisorischen Prozessen von zentraler Bedeutung sind. Auf der theoretischen Ebene setzen wir uns mit dem Inhalt von Reflexivität und Reflexion auseinander. Wir tun dies aus der Überzeugung heraus, dass es hilfreich ist, einen theoretischen Unterbau zu besitzen, bevor man sich in die Handlung begibt.
Die Reflexionsflächen, die wie die Geländer einer Handlung sind, bewegen sich im Metarahmen der Selbstreflexion. Dazu zählen wir die systemische Haltung und Rolle, das eigene Supervisionskonzept, die Arbeitsbeziehung, das Supervisanden-System und die Prozessführung in der Supervision. Wir orientieren uns an Zielen und Grundsätzen, in denen Leitgedanken der Reflexion entwickelt werden. Methodenvorschläge zur Selbstreflexion sollen eine Griffigkeit in der Anwendung erzeugen. Die Beschreibung einer durchgeführten Selbstreflexion rundet die Übertragung in die Praxis ab.
Wir hoffen, dass sich mit der Zeit eine Gender-Schreibweise finden wird, die die Lesbarkeit und den Lesefluss nicht beeinträchtigt. In diesem Buch haben wir uns dafür entschieden, die Kapitel von Uwe Michalak in der männlichen Form zu verfassen und die von Christiane Lüschen-Heimer in der weiblichen. Prinzipiell schließen wir uns dem bekannten Hinweis an, dass wir mit jeder Ausdrucksweise alle Geschlechter wertschätzend ansprechen.
Wir danken all den Menschen, die uns in unseren Selbstreflexionen unterstützen, anregen und stupsen: unseren Kolleginnen und Kollegen im Westfälischen Institut für Systemische Therapie und Beratung (WIST), unseren Familien und Freunden. Unser besonderer Dank gilt Hannah Eller, die dieses Buch mit ihren Zeichnungen bereichert, Margarita Engberding, Christoph Heidbreder, Almut Fuest-Bellendorf, Thomas Kamm und Mechthild Bischop für ihre vielfältige Unterstützung sowie dem Team des Carl-Auer Verlags für die konstruktive Zusammenarbeit. Manchmal braucht die Selbstreflexion die Kommunikation ins Außen …
Wir wünschen Ihnen Freude in Ihrer Arbeit und bei der Lektüre unseres Buches!
Uwe Michalak & Christiane Lüschen-Heimer

1Einleitung
1.1 Vorüberlegungen zu Reflexivität und Reflexion

Beim Beratungsformat Supervision handelt es sich um eine Reflexionskommunikation. Dieses Verständnis erfordert, dass wir uns zunächst mit den Begriffen Reflexivität und Reflexion sowie ihrer sprachlichen Herkunft beschäftigen. Das Wort »reflektieren« stammt vom lateinischen Verb »reflectere« für »hinwenden« ab und bedeutet »widerspiegeln«. Schaue ich in einen Spiegel, so erhalte ich einen Außenblick auf mich, der mir ohne die Zuhilfenahme der Reflexionsfläche nicht möglich wäre. Aus dieser Außenperspektive gewinne ich neue Erkenntnisse über mich. Der Blick in den Spiegel liefert gleichzeitig eine Idee darüber, wie Selbstreflexion funktioniert. Auch besteht eine thematische Verwandtschaft mit dem Wort »Reflex«. Das Einüben von Angriffs- und Abwehrtechniken im Karate wird gelegentlich als Konditionierung von Bewegungsabläufen konzipiert. Ein kontinuierliches Training erlaubt dann, Angriffe des Gegenübers reflexhaft zu parieren.
Im Allgemeinen kann man Reflexivität als Kompetenz auffassen, Prozesse in der Supervision bewusst zu steuern. Denn Reflexivität ermöglicht gleichsam ein flexibles Einnehmen von Selbst- und Fremdbeobachtungspositionen. Nach intensiver Übung kann der Supervisor während der Supervision quasi automatisiert auf diese Perspektiven zurückgreifen. Mit Reflexion ist der Vorgang gemeint, Anliegen konstruktiv sowie kritisch zu untersuchen.
Was bedeuten diese Begriffsbestimmungen für die Praxis? Versteht sich der Supervisor als Reflexionsfläche für den Supervisanden, dann wird er dem Supervisanden seine Beobachtungen widerspiegeln. Allerdings müsste man dann im Hinblick auf seine Spiegelbilder von Bildern mit Unschärfen sprechen – und zwar deshalb, weil wir den Supervisor als einen Beobachter betrachten, der das wahrnimmt, was er wahrnimmt. Ein anderer Supervisor hätte in derselben Situation andere Beobachtungen; seine Prozess-Steuerung würde anders verlaufen. In jedem Fall entsprechen diese »Bilder« des Supervisors einer Art »Feedback«, das beim Supervisanden Prozesse der Beschäftigung mit sich selbst anregt.
Der Begriff Reflexion schließt Selbstreflexion ein. Selbstreflexion bezieht sich auf ein Nachdenken über das eigene Selbst. Sie findet in der Regel sowohl beim Supervisor als auch bei seinem Supervisanden statt und ermöglicht beiden eine Professionalisierung. Der Fokus liegt jedoch auf der Selbstreflexion des Supervisanden. Der Supervisand profitiert bei der Bearbeitung seiner Anliegen von der Reflexivität des Supervisors. Denn die Interventionen des Supervisors laden den Supervisanden zur Selbstreflexion ein. Zudem dient der Supervisor dem Supervisanden als Modell dafür, wie sich Szenen analysieren lassen.
»Nachdenken ist die Freiheit, die man im Verhältnis zu dem, was man tut, besitzt; es ist die Bewegung, durch welche man Abstand von sich gewinnt, sich selbst als Objekt konstituiert und über das Ganze dieser Bewegung als Problem nachdenkt« (Foucault, zitiert nach Forster 2014, S. 596).
Das Ereignis, in dem Reflexivität vollzogen wird, ist das der Reflexion. Reflexion beginnt, wenn man den Raum der Innenschau betritt. Hierin kann sich der Supervisand intensiv mit eigenen Handlungsweisen aus seiner Vergangenheit, Gegenwart oder im Hinblick auf seine Zukunft auseinandersetzen. Supervision bedarf der Reflexion im gleichen Maße, wie wir Menschen der Luft zum Atmen bedürfen. Die Reflexion kann sich auf verschiedenen Ebenen abspielen, die oft parallel existieren oder bewusst wie unbewusst im Hintergrund arbeiten. Unter Ebenen verstehen wir beispielsweise die Psychodynamik des Supervisanden, sein Rollenverständnis sowie Strukturen und Prozesse in Organisationen, mit denen er konfrontiert ist. Die Frage, welche Ebene ein Supervisor für die Reflexion fokussiert, hängt u. a. von seinem Handlungskonzept, seiner Praxiserfahrung, seiner psychischen Ausstattung als Person und von der aktuellen Interaktion in der Supervision ab.