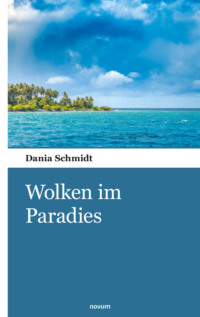Loe raamatut: «Wolken im Paradies»
Inhalt
Impressum 6
Widmung 7
I 8
1 8
2 15
3 22
4 25
5 27
6 40
7 47
8 57
9 60
10 65
11 69
12 71
13 78
14 83
15 87
16 90
17 93
18 100
19 104
20 109
21 114
22 120
23 123
24 127
25 130
26 137
27 140
28 142
29 146
II 149
1 149
2 160
3 165
4 169
5 173
6 181
7 183
8 187
9 192
10 195
11 197
12 200
13 204
14 206
15 209
16 214
17 217
18 220
19 224
20 234
21 238
22 246
23 250
24 254
25 257
26 262
27 275
28 280
29 285
30 290
31 292
32 294
33 296
34 301
35 303
36 306
37 314
38 320
39 323
40 326
41 328
42 331
43 334
44 338
45 340
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie.
Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://www.d-nb.de abrufbar.
Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Funk und Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger, elektronische Datenträger und auszugsweisen Nachdruck, sind vorbehalten.
© 2022 novum publishing
ISBN Printausgabe: 978-3-99010-991-5
ISBN e-book: 978-3-903382-52-7
Umschlagfoto: Flowersofsunny | Dreamstime.com
Umschlaggestaltung, Layout & Satz: novum publishing gmbh
Widmung
Für Flynn und Keyla
I
1
Der Wecker klingelt. Im Dunkeln ertaste ich ihn und blicke mit halb geöffneten Augen auf die Zeiger. Halb vier. Alles ist still. Nur der Ventilator an der Decke summt leise vor sich hin. Carlos schläft tief und fest. Leise schleiche ich mich aus dem Bett. Es ist warm, aber die Müdigkeit lässt mich frösteln und ich stelle mich unter die Dusche. Lasse lauwarmes Wasser an meinem müden Körper herunterprasseln.
Ich ziehe meinen pinkfarbenen Bikini an, darüber einen kurzen schwarzen Rock. Streife ein hellblaues Polohemd über, auf dem das Firmenlogo der Agentur abgebildet ist, für die ich arbeite: ein Walhai.
In der Küche beiße ich in eine Banane. Für unterwegs schmiere ich mir ein Brot.
Leise schließe ich die Wohnungstür hinter mir und gehe hinaus in die Dunkelheit. Schwach schimmern die Laternen und tauchen die Straße in ein gelbliches Licht. Auf der anderen Straßenseite stehen keine Häuser, nur das dunkle dichtbewachsene Grün des Urwaldes.
Mit meinem Rucksack auf dem Rücken und der Schnorchelausrüstung, die ich mir in einer großen Tasche um die Schulter hänge, gehe ich den kleinen gepflasterten Weg am Haus entlang bis zum schwarzen Gartentor.
Vor dem Tor am Straßenrand wartet schon ein glänzend weißer Toyota-Kleinbus auf mich. Alles ist ruhig. Der Fahrer hat es sich auf dem Sitz bequem gemacht und sich mit geschlossenen Augen leicht zurückgelehnt. Er wartet sicher schon seit einigen Minuten.
Ich steige auf den Beifahrersitz und begrüße ihn, wir haben schon viele Male zusammen gearbeitet. Er heißt Victor. Victor ist Mexikaner und kommt aus Veracruz, einer Hafenstadt am Golf von Mexiko. Der Tourismus-Boom hat ihn vor zehn Jahren in die mexikanische Karibik getrieben. Seither hat er sich ein anständiges Transportunternehmen mit inzwischen sieben Kleinbussen aufgebaut. Einen fährt er selber, für die anderen hat er Fahrer angestellt. Er bietet Transfers vom Hotel zum Flughafen an und vermietet seine Busse an Agenturen für Tagesausflüge. Essen ist seine Leidenschaft, und das sieht man ihm auch an. Kaum Platz bleibt zwischen seinem Bauch und dem Steuer.
Victor dreht den Schlüssel im Zündschloss herum und der Motor springt an. Der typische Geruch eines Neuwagens dringt in meine Nase. Mit dem laufenden Motor beginnt auch sofort die Klimaanlage auf Hochtouren zu arbeiten und lässt mich frösteln. Ich drehe das Gebläse von mir weg. Langsam fährt Victor die ruhige Straße entlang und biegt ab auf die Hauptstraße. Dann geht es auf der Autobahn Richtung Süden. Die einzige Straße, die den Norden mit dem Süden verbindet. Immer parallel zur Küste, mitten durch den fast undurchdringlichen Dschungel. Hier wachsen viele Edelhölzer wie die Mahagonibäume und der berühmte Chicozapote, der schon vor mehr als hundertfünfzig Jahren den Gummisaft für die Herstellung des Kaugummis lieferte. Damals wurde das geschmacklose Chicle, wie es auch noch heute in Mexiko genannt wird, von den Ureinwohnern des Urwaldes gekaut. Ein Amerikaner hat es beobachtet, ihm Geschmack gegeben, und das Kaugummi ging um die Welt. Uralte Legenden des Urvolkes dieser Region, der Mayas, machen den Urwald zu einem mystischen Ort. So wird erzählt, dass es vor Tausenden von Jahren zwei Krieger gab, die in die gleiche Frau verliebt waren. Der eine repräsentierte das Licht, der andere die Dunkelheit. Sie bekriegten sich, bis sie letztendlich beide starben, ohne jedoch mit der Geliebten zusammen gewesen zu sein. Um zurückkehren zu können auf die Erde, baten sie die Götter im Jenseits um Vergebung und wurden als Chechén und Chacá, Bäumen dieser Region, wiedergeboren. Der schwarze dickflüssige Saft des Chechén, der sich unter der Baumrinde befindet, ist giftig und ätzend. Bei Hautkontakt entstehen innerhalb weniger Stunden Verbrennungen zweiten Grades. Der Nektar des Chacá dagegen neutralisiert das Gift und wird auf die verbrannte Haut als Heilmittel aufgetragen. Beide Bäume befinden sich in unmittelbarer Nähe zueinander, meistens beträgt der Abstand zwischen ihnen nicht einmal einen Meter. Da der Chacá eine rötliche Baumrinde besitzt, die sich ständig pellt, nennen wir Reiseleiter ihn auch den Touristenbaum. Die krebsroten, von der Sonne verbrannten Urlauber amüsieren sich jedes Mal köstlich über den Vergleich.
Ich entspanne mich mit geschlossenen Augen und genieße die Ruhe. Aus dem Radio ertönt mexikanischer Pop. Sehr schnulzig, aber so mag es Victor halt. So wie wir sind in den frühen Morgenstunden viele Kleinbusse unterwegs auf dem Weg zu den Hotelanlagen, um die Urlauber zu ihren Ausflügen abzuholen oder Abreisende zum Flughafen zu bringen. Der Tourismus boomt. Fast alle Menschen die hier leben, haben direkt oder indirekt mit dem Tourismus zu tun. Nicht ohne Grund zählt diese Region zu den wohlhabendsten Mexikos. Was natürlich nicht bedeutet, dass es hier keine Armut gibt. Die gibt es. Obwohl sie den Touristen meist verborgen bleibt.
Auf der Seite des karibischen Meeres wird der dichte Dschungel immer wieder unterbrochen und monströse, palastähnliche Einfahrten kommen zum Vorschein. Sie führen in die luxuriösen, teils gigantisch großen, Hotelanlagen.
Nach fast dreißig Minuten Fahrt erscheint auf einem großen grünen Autobahnschild über der Fahrbahn der Name des Hotels, in dem wir heute Gäste abholen. Victor verlangsamt den Bus und setzt den Blinker. Am Hoteleingang hält er vor einer großen Schranke, und ein Wachmann tritt aus seinem kleinen Häuschen heraus. Wir zeigen ihm unsere Liste mit den Gästenamen. Nach einem kurzen Blick darauf lässt er uns passieren. Die Schranke geht hoch.
Diese Hotelanlage ist eine der größten in der Gegend. Insgesamt fünf Lobbys verteilen sich auf einer gigantisch großen Fläche, die durch Straßen miteinander verbunden sind. Sobald Victor Gas gibt, erscheint ein Tope auf der Straße und er wird gezwungen zu bremsen. Langsam fährt er über ihn rüber bis schon kurz darauf der nächste folgt. Der Grund für die Beschleunigungsbremsen sind neben den Fußgänger auch die Tiere, die hier leben, wie Leguane und Nasenbären. Die Coatis sehen aus wie eine Mischung zwischen Hund und Affe, habe eine spitze, lange Nase, einen langen Schwanz und kurze Beine. Da sie so gut wie alles fressen und kaum Angst vor Menschen haben, fühlen sie sich in den Hotelanlagen pudelwohl. Zu dieser frühen Stunde habe ich auch schon Mazamas im Dunkeln am Straßenrand entdeckt. Das Wort kommt aus dem Nahuatl, der meistgesprochenen indigenen Sprache Nord- und Mittelamerikas. Es bedeutet Hirsch.
Alles in der großen Hotelanlage ist unglaublich schön hergerichtet. Hohe Kokospalmen und duftende Orchideen schmücken den Straßenrand. Am Wegrand ein englischer Rasen. Nirgends auch nur eine Spur von Abfall, Dreck oder Armut. An der Hotellobby werden wir erneut von einem Wachmann kontrolliert. Victor fährt die breite pompöse Auffahrt hoch und hält direkt vor der offenen Eingangshalle an.
Wir sind früh dran. Über den hellen, glänzenden Marmorboden schlendere ich durch den stillen Eingangsbereich. Ein herrlicher Blumenduft umhüllt mich. Er kommt von dem großen, bunten Blumenstrauß aus exotischen Blumen, der in einer gläsernen Vase auf einem runden Tisch mitten in der Halle steht. Selbst auf den Toiletten duftet es herrlich nach Jasmin. Alles ist penibel sauber und glänzt im hellen Licht. Im Spiegel blicke ich auf mein sonnengebräuntes Gesicht und meine von Salzwasser und Sonne ausgeblichenen blonden Haare. Ich befeuchte mein Gesicht mit kaltem Wasser aus dem Wasserhahn um die Müdigkeit zu vertreiben und gehe langsam zurück zum Bus, wo sich inzwischen auch schon meine ersten Gäste eingefunden haben.
Es ist nun kurz nach Sechs und der Himmel färbt sich rosarot. Die Sonne steigt schnell empor, und schon nach kurzer Zeit brennt sie gnadenlos vom wolkenlosen Himmel. In unserem klimatisierten Bus ist von der tropischen Hitze jedoch nichts zu spüren. Der Verkehr auf der Autobahn wird dichter, je weiter wir Richtung Norden fahren. Ein großes Windrad erscheint am Straßenrand und kurz dahinter die Abfahrt zum Flughafen. Wir fahren weiter geradeaus, und plötzlich staut sich der Verkehr bis er komplett zum stehen kommt. Der Grund ist ein Kontrollpunkt des mexikanischen Militärs. Langsam fährt Victor wieder an und im Schritttempo geht es an schwerbewaffneten Soldaten vorbei, die mit einschüchternden Gesichtsausdrücken jeden Autofahrer ganz genau anschauen, bevor sie ihn mit einer Handbewegung zum Weiterfahren auffordern. Nach Waffen und Drogen suchen sie. Touristenbusse sind nicht interessant und Victor darf weiterfahren.
Der dichte immergrüne Dschungel verschwindet nach und nach. Riesige moderne Einkaufszentren und private Universitäten mit ihren grünen Fußballplätzen davor machen sich am Straßenrad breit. Hinter großen, verschlossenen Eisentoren lassen sich teure Wohnanlagen erahnen. Ein mehrspuriger Kreisverkehr erscheint vor uns. Als Victor kurz abbremst, beginnt sofort ein nervtötendes Hupkonzert. Wer schneller ist, hat Vorfahrt. Es ist kurz nach Sieben, die Zeit, in der die meisten Schulen beginnen. Hier ist es üblich, die Kinder mit dem Auto zur Schule zu bringen, bis sie erwachsen sind und selber fahren können. Dementsprechend viele Autos sind daher schon in diesen frühen Morgenstunden unterwegs. Ein öffentliches Verkehrsnetz mit Bussen gibt es schon. Sie sind billig und fahren durch so gut wie alle Stadtteile. Doch einen Fahrplan gibt es nicht. Kein System. Hier und da eine Bushaltestelle, an der man warten und auf der Windschutzscheibe des Combis die Endhaltestelle ablesen kann. Irgendwann kommt dann ein überfüllter, dreckiger und lauter Kleinbus vorbei. Oft hinterlässt er eine schwarze, stinkende Rauchwolke. Die Fahrer fahren ohne Rücksicht auf die Fahrgäste wild durch die Stadt. Raubüberfälle und Entführungen sind keine Seltenheit. Wer sogar das Fahrrad nimmt, ist entweder verrückt oder lebensmüde. Oder beides. Selbst Moped zu fahren ist hier in der Stadt eine gefährliche Angelegenheit, da unter den Verkehrsteilnehmern kaum Rücksicht genommen wird. Ständig scheppert es.
Langsam bahnen wir uns unseren Weg quer durch die Stadt. Von Süden nach Norden. Nachdem wir an einem großen eleganten Einkaufszentrum vorbeifahren, verändert sich das Stadtbild. An den Hausfassaden bröckelt die Farbe ab, und am Straßenrand sammelt sich weggeschmissener Plastikmüll. Ich drehe mich um und blicke in zwölf müde Gesichter. Auf englisch erkläre ich den Urlaubern, was sie heute erwarten. Sie hören mir aufmerksam zu und ich sehe, wie langsam wieder Leben in ihre müden Körper kommt. Einige von ihnen werden nervös.
Seit mehreren Jahren arbeite ich nun schon als Reiseleiterin für Tagesausflüge in der mexikanischen Riviera Maya. Als Tour-Guide für Abenteuerausflüge durchquerte ich mit meinen Gästen, in einem schweißtreibenden Fußmarsch, den dichten Dschungel und ließ sie die Pyramiden besteigen. Wir seilten uns an steilen Kalksteinabhängen ab, bis wir in ein Wasserloch gelangten und glitten an einem Drahtseil über eine Lagune, während uns Krokodile dabei von unten interessiert zuschauten. Doch heute ist alles anders. Kein Dschungel wird durchquert und keine Pyramide erklommen.
2
Das Meer. Das Festland haben wir schon seit über einer Stunde nicht mehr erblicken können. Das zunächst leuchtende Türkis des karibischen Meeres schimmert nun in einem einheitlichen dunklen Blau. Grelle Sonnenstrahlen glitzern auf der Oberfläche. Und dann entdecken wir sie. Haifischflossen. Es müssen Hunderte sein. Friedlich ziehen sie behutsam durch das Wasser. Walhaie. Die größten Fische der Welt. Mit Walen haben sie trotz des Namens nichts zu tun. Außer vielleicht, dass sie sich ebenfalls von Plankton ernähren, untypisch für einen Hai. Im karibischen Sommer wird das Meer so warm, dass es viel Plankton gibt und die Walhaie in die Region zieht. Ein Festmahl.
Leicht schwankt unser modernes Schnellboot hin und her. Heute ist ein relativ ruhiger Tag und die Wellen sind klein. Trotzdem muss ich mich gut festhalten, um nicht umzufallen. Meine Gäste sitzen gespannt auf den Bänken im hinteren Bereich des Bootes. Überwältigt vom majestätischen Anblick der friedlichen Riesen machen sie Foto nach Foto.
Und dann kann es endlich losgehen. Zehn Gäste habe ich bei mir im kleinen Boot, und pärchenweise dürfen sie nun ins Wasser, um neben den Walhaien zu schwimmen. Damit sie dabei auch gut vorankommen, bekommt jeder Flossen von mir. Durch die Taucherbrille und den Schnorchel können sie während des Schwimmens den Walhai unter Wasser beobachten.
Ich springe ins Wasser. Meine Gäste folgen mir. Das Meer ist erfrischend und gleichzeitig erstaunlich warm. Über meinen Bikini trage ich lediglich ein langärmliges Schwimmshirt als Schutz vor der starken Tropensonne. Irgendetwas pikt an meiner Haut unter der Wasseroberfläche. Vielleicht ist es das Plankton, die pelagischen Minitiere. Es ist zwar etwas unangenehm, jedoch nur von kurzer Dauer.
Nachdem ich mich kurz im Wasser orientiere, setze ich mir die Taucherbrille auf und tauche in die faszinierende blaue Welt ein. Bis auf ein knisterndes Geräusch herrscht komplette Stille. Das Wasser ist erstaunlich klar und ich kann viele Meter weit schauen. Den Meeresgrund erkenne ich dennoch nicht. Ein Schwarm grauer Stachelrochen gleitet tief unter mir vorbei. Dann erscheint ein langsam schwimmender Walhai vor meiner Taucherbrille. Noch ist er einige Meter von mir entfernt, und doch kann ich gut seinen grauen Rücken mit den vielen weißen Flecken und Streifen erkennen. Jeder Walhai hat dabei ein ganz individuelles Muster. Seine winzigen Augen sind kaum zu erkennen. Das Tier ist langsam und bewegt kraftvoll seine große Schwanzflosse hin und her. Wir müssen Abstand halten, um nicht verletzt zu werden, schwimmen daher im vorderen Bereich der Tiere an der Seite mit. Dem friedlichen Riesen scheint unsere Anwesenheit nichts auszumachen. Er zeigt weder Scheu noch Neugier. Nach einer Weile halte ich mit meinen Gästen an und das schöne Tier verschwindet langsam aus unserem Blickfeld.
Plötzlich taucht ein riesiger schwarzer Teufelsrochen vor mir auf. Ich schätze die Spannweite der Manta auf sieben Meter. Zügig schwimmt sie auf mich zu. Der Teufelsrochen ist jedoch, wie der Walhai, ein friedlicher Planktonfresser. Dann dreht er ab. Tief beeindruckt schaue ich ihm hinterher bis er in den blauen Tiefen verschwindet.
Erschöpft und glücklich klettern die Urlauber über die wackelige Leiter zurück ins Boot. Überwältigt von dem besonderen Erlebnis haben die meisten ein großes Lächeln im Gesicht. Zwei Gäste können es jedoch kaum erwarten, wieder festen Boden unter den Füßen zu spüren, und schauen gequält drein. Haifischfütterung nennen wir das, unter Kollegen. Sie opfern ihr Frühstück den Meeresbewohnern. Andere nennen es einfach Seekrankheit. Es vergeht kein Tag, an dem nicht zumindest einer von meinen Gästen darunter leidet. Vor zwei Wochen haben sie besonders gelitten.
An diesem Morgen konnte noch keiner ahnen, welchen Verlauf der Tag nehmen würde. Ich hatte ein sympathisches, junges deutsches Pärchen dabei, Lisa und Martin. Frisch verheiratet. Viele Pärchen verbringen ihr Honeymoon in der Karibik, so auch die beiden. Morgens im Bus erklärte ich ihnen und den anderen Gästen den Tagesablauf. Gespannt und aufgeregt hörten sie mir zu. Man fährt nun mal nicht jeden Tag auf das offene Meer hinaus, um mit dem größten Fisch der Welt zu schwimmen. Das ist natürlich etwas ganz Besonderes. Viele Urlauber buchen diesen Ausflug, weil er ihnen als ein unbedingtes Muss verkauft wird. Wenn es dann allerdings wirklich losgeht und die Touristen in meinem Bus sitzen, wird vielen erst bewusst, worauf sie sich da eingelassen haben. Sie werden nervös. Auch an diesem Morgen spürte ich die Anspannung meiner Gäste.
Als wir am Anleger ankamen schien es, ein wunderbarer Tag zu werden. Neben der strahlenden Sonne zogen nur ganz vereinzelt graue Wölkchen vorbei. Lisa und Martin folgten mir mit den anderen acht Gästen auf das weiße Schnellboot. Meine Anwesenheit gab ihnen Sicherheit. Ich sprach ihre Sprache, verstand ihre Sorgen und konnte sie beruhigen. Als wir bei den Walhaien ankamen, erklärte ich ihnen die Regeln und die Benutzung der Ausrüstung. So wie ich es jeden Tag mache. Während Lisa schon einmal auf den Malediven tauchte, und ein Profi im Umgang mit Schnorchel, Taucherbrille und Flossen zu sein schien, hatte Martin dagegen keine Ahnung. Wasser war nicht sein Element. Planschen im seichten Meer, wenige Meter vor dem Strand alles, für das er bisher zu haben war. Doch jetzt befanden wir uns auf dem offenen Meer. Vom seichten Wasser waren wir knapp dreißig Kilometer entfernt. Wo man auch hinschaute, der Horizont blieb blau. Durch den Wellengang schwankte das Boot leicht hin und her und Martin wirkte sichtlich ängstlich. An seinem Gesichtsausdruck war zu erkennen, dass er sich gerade fragte, was zur Hölle ihn dazu gebracht hatte, diesen Ausflug zu buchen. Um unser Boot herum ragten inzwischen große Haifischflossen aus dem dunkelblauen Wasser. Drehten ihre Runden. Dass es sich dabei um friedliche Haie handelte, schien Martin nicht zu beruhigen. Sicher, irgendwo da unten waren auch andere Lebewesen unterwegs. Wie zum Beispiel die gefürchteten Bullen- und Tigerhaie. Das wusste auch Martin.
Ich setzte mich schließlich neben ihn. Erklärte ihm ruhig, wie er die Brille anlegen und durch den Schnorchel atmen muss. Dann setzten wir uns beide auf den Rand des Bootes. Die Flossen an unseren Füßen baumelten außen am Boot herunter. Fast berührten sie die Wasseroberfläche. Nervös schaute mich Martin an. Da sollte er jetzt reinspringen? Aber es gab da etwas, was ihn antrieb. Er hatte für den Ausflug gezahlt. Und zwar viel. Über zweihundert Euro pro Person kostet dieser Tagesausflug. Und würde er den Sprung jetzt nicht wagen, sein Geld bekäme er nicht zurück. Und er würde es mit Sicherheit bereuen.
„Die Möglichkeit, mit dem größten Fisch der Welt zu schwimmen, wirst du wahrscheinlich nur einmal in deinem Leben haben.“ Meine Worte überzeugten schon viele meiner Gäste. Und auch ihn. Er sprang. Und ich hinterher. Sobald Martin auftauchte prustete er erschrocken und verängstigt. Ich nahm seine Hand und er beruhigte sich sofort. Da Martin wie alle Gäste, egal ob Nichtschwimmer oder professionelle Taucher, eine Schwimmweste tragen musste, blieb er, ohne sich zu bewegen, an der Wasseroberfläche.
„Leg dich auf die Wasseroberfläche und wirf mal einen Blick unter das Wasser.“ Martin folgte zögerlich meiner Anweisung, wobei er weiterhin krampfhaft meine Hand hielt. Dann fing er an, langsam neben mir zu schnorcheln. Seine Angst verschwand nach und nach. Fasziniert beobachtete er die wunderschönen Walhaie unter der Wasseroberfläche und vergaß vollkommen seine anfängliche Angst. Zurück an Bord des Bootes erzählte er den anderen Gästen euphorisch von diesem einzigartigen Erlebnis. Die Gäste stecken sich gegenseitig an. Hat einer Angst, haben sie auf einmal alle Angst. Die Euphorie von Martin gab den anderen Gästen Mut. Letztendlich schnorchelten an diesem Tag alle mit den Walhaien. Und alle waren sie euphorisch und glücklich.
Als Reiseleiterin habe ich nicht nur die Aufgabe, meine Gäste über den Ausflug zu informieren und auf sie aufzupassen. Ihnen Wissen zu vermitteln über Geschichte, Flora und Fauna. Meine Arbeit ist viel umfangreicher. Agiere ich zudem als Seelsorgerin. Ich mache meinen Gästen Mut, gebe ihnen Halt und Sicherheit. Nehme ihnen Ängste. Jeder Gast ist auf seiner Art besonders. An viele erinnere ich mich immer mal wieder gerne zurück. Bei einigen wenigen bin ich froh, sie nicht wiedersehen zu müssen. Es sind diese Art von Gästen, die sich schon morgens darüber beschweren, dass ihnen die Sonne zu hell, der Regen zu nass und die Klimaanlage zu laut ist. Man kann es ihnen einfach nicht recht machen. Zu ein paar wenigen Gästen habe ich noch immer Kontakt, eine Freundschaft ist entstanden. Die meisten jedoch sieht man nie wieder. Vielleicht denken sie ja manchmal an mich zurück. An die Reiseleiterin, die ihnen Mut gemacht hat, damals, beim Walhaischwimmen.
Auf der Rückfahrt zum Festland zogen plötzlich schwarze Wolken auf. In der Karibik verändert sich das Wetter manchmal rasant schnell. Ehe wir uns versehen konnten, war der Himmel pechschwarz. Ein rauer Wind begann uns um die Ohren zu pfeifen, und der Wellengang nahm stetig zu. Dann fing es an zu regnen. Wie aus Kübeln begann es zu schütten. Die Schnellboote sind offen, und wir waren dem Regen gnadenlos ausgesetzt. An sich nicht schlimm bei tropisch warmen Temperaturen. Zudem hatten alle noch Badesachen vom Schnorcheln an. Ich selber war im Bikini. Langsam navigierte uns unser junger mexikanische Kapitän über das raue Meer. Wohin er fuhr war mir schleierhaft. Man konnte kaum noch die eigene Hand vor den Augen erkennen. Natürlich gab es ein GPS an Bord und unser Kapitän hatte viel Erfahrung. Doch wäre ein schnelles Boot auf uns zugerast, wir hätten ihm nicht rechtzeitig ausweichen können. Da bin ich mir ganz sicher. Die Sichtweite lag unter einem Meter. Ich stellte mich auf den hinteren Rand des Bootes, hielt mich am Gerüst des Sonnensegels fest und jauchzte vor Vergnügen. Nur ein kleiner Schauer, dachte ich. Dann fing sich jedoch das Wasser im Boot langsam an zu stauen, das bei jeder hohen Welle ins Innere des Bootes katapultiert wurde. Immer weiter stieg die Wasserhöhe an. Und zur Küste waren es sicher noch über zehn Kilometer. Von der euphorischen und glücklichen Stimmung unter den Gästen war nichts mehr zu merken. Zunächst trat eine Totenstille ein. Dann fingen einige an zu weinen und hielten sich krampfhaft irgendwo fest. Martins Gesicht war bleich vor Angst. Eng umschlungen saßen er und Lisa auf der nassen Bank. Schnell schnappte ich mir den schwarzen Eimer, der zur Aufbewahrung der Tauchermasken diente und fing an, das Wasser nach und nach aus dem Boot zu schöpfen.
„Was für ein Abenteuer! Alles inklusive heute“, witzelte ich.
Meine Gäste fanden das natürlich weniger lustig. Anspannung und Angst standen ihnen ins Gesicht geschrieben. Meine lustige Art beruhigte sie jedoch ein wenig. Nach dem Motto: wenn die Reiseleiterin darüber noch Späße macht, kann es so schlimm doch nicht sein. Aber es war schlimm. Auch wenn ich meinen Gästen Gelassenheit vorspielte. Unser Boot war kurz davor unterzugehen. Und bei diesem Sturm hätte man uns so schnell nicht gefunden. Wenn überhaupt. Doch wollte ich unter allen Umständen Panik vermeiden. Egal was passiert, Panik würde alles nur noch schlimmer machen. Das war mir bewusst.
Nach einer halben Stunde legte sich der Sturm langsam und wir erreichten das Festland. Alle Gäste atmeten erleichtert auf. Der Schrecken stand ihnen jedoch ins Gesicht geschrieben. Ob Lisa und Martin jemals wieder mit einem Schnellboot auf das offene Meer hinausfahren werden, bleibt fraglich.
3
Es ist mein erster Sommer bei den Walhai-Ausflügen. Seit vielen Wochen bin ich nun fast täglich auf dem offenen Meer unterwegs, um Menschen aus der ganzen Welt bei diesem einzigartigen Erlebnis zu begleiten. Doch das Gefühl einer langweiligen Routine will sich noch immer nicht einstellen. Jeder Tag ist etwas Besonderes. Auch heute.
Luis wirft die Motoren an und steuert das Boot langsam und vorsichtig aus dem Gebiet, in dem sich inzwischen sehr viele Schnellboote eingefunden haben. In einer sicheren Entfernung von den Walhaien gibt er Gas. Der vordere Teil des Bootes hebt sich aus dem Wasser, und wir rauschen bei wolkenlosem Himmel über das Meer Richtung Festland. Luis ist unser Bootskapitän. Neben diesem Schnellboot hat er noch drei andere, die auch zum Walhai-Schwimmen eingesetzt werden. Davon lebt er. Und gut. Obwohl es diesen Ausflug nur vier Monate im Jahr gibt, reicht es fast das ganze Jahr zum Leben. Heute ist Ricardo, sein Sohn, mit an Bord. Er ist gerade siebzehn Jahre alt geworden und bessert sich in den Sommerferien mit dieser Arbeit sein Taschengeld auf. So kümmert er sich mit mir zusammen um die Urlauber an Bord. Er ist ein netter Junge. Die Arbeit mit den beiden macht großen Spaß. Sein Vater ist ein lockerer Spaßvogel. Er hat immer einen Witz parat, ist aber trotzdem professionell bei der Arbeit.
Nach und nach lässt sich am Horizont wieder das Festland ausmachen. Zu allererst Isla Mujeres. Eine Karibikinsel ungefähr acht Kilometer vor dem mexikanischen Festland. Die pompösen Hotelhochhäuser von Cancún zieren den Horizont.
Luis drosselt die Geschwindigkeit und steuert das Boot zur Insel, wo er etwa einhundert Meter vor dem weißen Sandstrand im kristallklaren Wasser den Anker wirft. Trotz der Entfernung zum Strand ist das seichte Meer hier nur knietief. Meterhohe Kokospalmen, kleine idyllische Hotels und farbenfrohe Fischrestaurants zieren die Silhouette der Insel.
Ich genieße das warme Wasser und unterhalte mich mit Luis. Er bringt mich zum Lachen. Immer ist er gut gelaunt. Ein fröhlicher Mensch. Ich beneide seine Frau, mit einem so tollen Mann verheiratet zu sein. Sicher führen sie eine schöne Ehe. Zwei Kinder haben sie, Ricardo und Lily. Beide schon fast erwachsen. Dabei ist Luis noch gar nicht so alt, gerade einmal Anfang vierzig. In meinem Kopf male ich mir aus, was für eine glückliche Familie sie wohl sind. Dann denke ich an Carlos und mich. Unsere Ehe. Wie verliebt ich anfangs war. Im ersten Jahr waren wir auch glücklich. Im Zweiten nicht mehr.
In etwas Abstand zum Boot hocke ich mich ins knietiefe Wasser und spüre den weichen Sand unter meinen Knien. Meine Augen verschwinden hinter der verdunkelten Sonnenbrille. Dabei beobachte ich Luis und denke an heute Morgen.
Eigentlich war es ein Morgen wie jeder andere in diesem Sommer. In aller Frühe, während alles um mich herum noch schlief, bin ich aufgestanden. Doch irgendetwas war anders als sonst. Fühlte sich anders an. Ich war irgendwie nervös. Konnte es mir jedoch nicht erklären. Arbeite ich doch nun schon seit mehreren Jahren als Reiseleiterin. Auch die Walhai-Tour mache ich nun schon seit fast drei Monaten. Warum also war ich plötzlich nervös?
Als ich mein braun gebranntes Gesicht im Spiegel meines Badezimmers begutachtete, traf es mich wie einen Schlag ins Gesicht. Es war, als hätte mir jemand in genau diesem Moment die Augen geöffnet. Ich hatte mich verliebt.
Als ich mit allen meinen Gästen zurück im Bus den Rückweg antrete, macht sich schnell Müdigkeit breit. Die Klimaanlage des Busses ist kalt und die Urlauber sind so erschöpft, dass die meisten nach wenigen Kilometern einschlafen. Auch ich mache die Augen zu und falle in einen entspannten Halbschlaf, aus dem mich Victor bei der Einfahrt ins Hotel wieder herausholt. Nachdem wir alle Gäste verabschieden, fährt er mich nach Hause.
Ich schließe die Wohnungstür auf. Stille. Niemand ist da. Es ist später Nachmittag, Carlos ist noch auf einem Ausflug unterwegs. Reiseleiter ist er, wie ich. Wir lernten uns kennen, als ich gerade einige Wochen in der Riviera Maya war und noch zur Reiseleiterin ausgebildet wurde. Das ist nun drei Jahre her. Wir verliebten uns schnell, und nach einem Jahr heirateten wir. Alles schien perfekt. Wir teilten nicht nur unsere Liebe zueinander, sondern auch unsere Arbeit und einen gemeinsamen Freundeskreis, unsere Kollegen. Carlos ist ein lieber Mensch, sehr freundlich und gutmütig. Mit der Zeit zog er sich jedoch immer mehr zurück. Inzwischen verbringt er fast jede freie Minute vor seinem Computer um Nachforschungen über Außerirdische und den Sinn des Lebens zu tätigen. Verfangen im Netz des Internets. Zum Lachen bringt er mich schon lange nicht mehr.