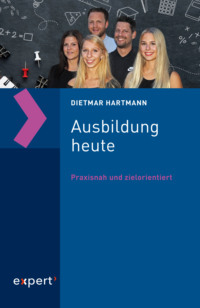Loe raamatut: «Ausbildung heute»
Dietmar Hartmann
Ausbildung heute
Praxisnah und zielorientiert
expert verlag

© 2020 · expert verlag
Dischingerweg 5 · D-72070 Tübingen
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Internet: www.expertverlag.de
eMail: info@expert.verlag
ISBN 978-3-8169-3435-6 (Print)
ISBN 978-3-8169-0002-3 (ePub)
Inhalt
Vorwort
Aus Gründen der besseren ...
Einführung in dieses BuchBetriebliches BildungspersonalRollenwandel vom Ausbilder zum LernprozessbegleiterBerufspädagogische ProfessionalisierungWie geht Lernen?Was ist ein Lernprozess?Formales LernenInformelles LernenBegleiter vs. Unterweiser?Meine zukünftige Rolle als AusbilderGeneration X/Y/ZÜbersichtTraditionalisten (1922 – 1955)Babyboomer (1955 – 1969)Generation X (1965 – 1980)Generation Y (1980 – 2000)Generation Z (1995 – 2010)Wertewandel als Chance begreifenGenerationenkompetenzModern ausbilden! Aber wie?Handlungs- und Prozessorientierte AusbildungPädagogik und DidaktikLernprozessbegleitungLernprozessbegleitung teilt sich in sechs Phasen; sie sind nachfolgend im Einzelnen beschrieben.Trends in der AusbildungLernen und seine HindernisseLernblockaden überwindenWie machen sich Lernblockaden bemerkbar?Wie können Blockaden überwunden werden?Lernklippen erkennen und überwindenWas hindert uns am Lernen?Lernmotivation
Selbstlernkompetenz fördern und nutzenWas ist Selbstlernkompetenz?Was ist Selbstlernkompetenz?Berufliches Handeln lernenWas heißt dies für den Auszubildenden?Wie ist der Anfang?Acht-Prinzipien selbstorganisierten LernensZielformulierungen: „Ich kann…“Zielbeschreibung: SMART„Diese Ziele sind SMART“
Medieneinsatz in der AusbildungNeue MethodenEinsatz neuer TechnologienEingesetzte HilfsmittelEinsatz des InternetsYOUTUBEInteraktive LernprogrammeVirtual RealityDigitales LernenBlended LearningZusammenfassendKommunikation in der AusbildungFeedbackKonfliktmanagementModerationLerngespräche führen und auswerten
Softskills für AusbilderEin Beitrag von Joachim WeffersDefinition des KompetenzbegriffsGeschichtliche HerleitungBedeutung von HandlungskompetenzDefinition von Kompetenz (nach dem Modell von Erpenbeck)Selbstreflexion der AusbilderBedeutung für die Ausbildung
Ausbildung von MigrantenDie besonderen Herausforderungen bei der Ausbildung von MigrantenSprachkompetenzSprachkompetenz in der dualen AusbildungKulturelle KompetenzKulturelle Kompetenz für AusbilderKompetenzermittlungDas Valikom ProjektChancen, Risiken und NutzenChancen, Nutzen und Risiken für die Ausbildung von MigrantenDanksagungSchlusswortBegriffserklärung
Abbildungsverzeichnis
Literatur- und Quellenverzeichnis Weitere interessante Links:
Anhang Berufsbildungsgesetz (BBiG): Handwerksordnung (HWO): Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG)
Vorwort
Dieses Buch richtet sich an alle Ausbilder im operativen Ausbildungsgeschäft, innerhalb des dualen Bildungssystems.
Außerdem an alle Beteiligten, die sich mit Berufsausbildung beschäftigen.
Neue Trends, Herausforderungen und Perspektiven werden beleuchtet, vor dem Hintergrund von Industrie 4.0, Digitalisierung 2.0 und Ausbildung 4.0.
Das vorliegende Buch basiert auf den praktischen Erfahrungen des Autors und seiner Mitautoren aus mehreren Jahren Ausbilder- und Prüfertätigkeit.
Mit Francisco Rivera Campos, Stefan Eckardt und Joachim Weffers konnte ich hochkarätige Experten für das vorliegende Werk gewinnen. An dieser Stelle schon einmal ein großes Dankeschön an meine Mitautoren und an Volker Freudenberger, den ich für die Einführung des vorliegenden Buchs mit ins „Boot“ holen konnte, um hier noch einmal die Wichtigkeit dieser Materie zu betonen.
Weiterhin rundet dieses Buch die Expert-Reihe „Ausbildung“ ab und setzt sich mit der Frage der Nachhaltigkeit und Weiterentwicklung von zukünftigen und modernen Ausbildungen, auch im Hinblick auf den latent vorhandenen Fachkräftemangel, intensiv und zielführend auseinander.
Dietmar Hartmann
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichwohl für beiderlei Geschlecht.
Einführung in dieses Buch
Ein Beitrag von Volker Freudenberger
Betriebliches Bildungspersonal
Dem betrieblichen Ausbildungspersonal wird ein wesentlicher Einfluss auf die Qualität der beruflichen Ausbildung zugeschrieben. Seit Mitte der 1980er-Jahre steht die Professionalisierung des Bildungspersonals auf der Agenda der europäischen Berufsbildungszusammenarbeit. In den gemeinsamen Programmen „Petra“ und dem darauffolgenden „Leonardo da Vinci“ wurde sie Schwerpunkt. Diese wurde als Teilziel der europäischen Zusammenarbeit im beruflichen Bildungssektor verankert; einmal durch den sogenannten „Kopenhagen-Prozess“ und zum anderen im Rahmen des bildungspolitischen Programms für die Entwicklung der europäischen Bildungssysteme der „Lissabon-Agenda“ zur „Verbesserung der allgemeinen und beruflichen Bildung von Lehrkräften und Ausbildern“1.
Im deutschen dualen System ist die berufs- und arbeitspädagogische Eignung für betriebliches Ausbildungspersonal in der AEVO gesetzlich geregelt. Seit der Novellierung 2009 umfasst die Eignung „die Kompetenz zum selbständigen Planen, Durchführen und Kontrollieren der Berufsausbildung“ (AEVO, 2009, § 2) vier Handlungsfelder. Die Prüfung der Ausbildungsvoraussetzungen und die Planung der Ausbildung wird im ersten Handlungsfeld beschrieben. Im zweiten Handlungsfeld geht es um die Vorbereitung der Ausbildung und die Einstellung von Auszubildenden. Im dritten Handlungsfeld wird die Durchführung der Ausbildung und im vierten der Ausbildungsabschluss behandelt. Durch eine schriftliche und praktische Prüfung wird die Eignung festgestellt. Aber nicht alle an der Ausbildung beteiligten Akteure müssen diese Prüfungen nachweisen.
Im Jahre 2017 waren als Ausbilder 636.078 Personen offiziell bei den zuständigen Stellen gemeldet.2 Diese Zahl spiegelt aber nur einen Teil der betrieblichen Akteure im Bereich der beruflichen Ausbildung wider. Die große Anzahl von nebenberuflichen Ausbildern und vor allem die unüberschaubare Vielzahl an ausbildenden Fachkräften wird dadurch nicht erfasst. Hieraus wird ersichtlich, dass das betriebliche Ausbildungspersonal eine schwer einzugrenzende und heterogene Gruppe darstellt.3 Der mit der betrieblichen Ausbildung beauftragte Personenkreis ist keinem Berufsstand zuzuordnen, denn die betriebliche Ausbildung ist gerade dadurch gekennzeichnet, dass sie auf viele Akteure verteilt ist.
Die BIBB-Hauptausschuss-Empfehlung zur Eignung der Ausbildungsstätte unterteilt das Ausbildungspersonal in drei Gruppen: die nebenberuflichen und hauptberuflichen Ausbilder und die ausbildenden Fachkräfte4. An diese stellt die Empfehlung unterschiedliche Qualifikationsanforderungen. Als obligatorisch wird bei den nebenberuflichen und hauptberuflichen Ausbildern ein Eignungsnachweis in Gestalt einer erfolgreichen Prüfung nach AEVO gefordert. Optional wird die Weiterbildung zum geprüften Aus- und Weiterbildungspädagogen empfohlen. Die ausbildenden Fachkräfte werden auf den § 28 Absatz 3 BBiG bzw. § 22 Absatz 3 HwO verwiesen. Hiernach darf eine Fachkraft unter Verantwortung eines Ausbilders ausbilden, wenn sie „die für die Vermittlung von Ausbildungsinhalten erforderlichen beruflichen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten besitzt und persönlich geeignet ist“5.
Diese begriffliche Differenzierung des ausbildenden Personals findet in der betrieblichen Praxis eher keine Anwendung. Je nach Betriebsgröße und Branche unterscheiden sich die betrieblichen Ausbildungsstrukturen sehr stark. So ist z.B. „in kleinen Handwerksbetrieben, in denen Ausbildungs- und Arbeitsprozesse nahezu deckungsgleich sind […] die schrittweise Einarbeitung von Auszubildenden ein selbstverständlicher Teil der Arbeit“6. Die gesetzlich geforderten Kompetenzen sind meist nicht auf eine Person beziehbar, sondern auf mehrere an der Ausbildung beteiligte Beschäftigte verteilt. In größeren Betrieben gibt es zwar häufig hauptberufliche Ausbilder, aber auch diese Personengruppe ist durch unterschiedliche Gestaltungsspielräume nur schwer einheitlich zu charakterisieren. Dies ist ein weiteres Indiz für „die Komplexität der Situation des ausbildenden Personals in den Betrieben“7.
Trotz der unbestrittenen Wichtigkeit des betrieblichen Ausbildungspersonals, „als Garant für die Sicherung des beruflich-betrieblichen Nachwuchses“8, sind ihre Handlungsbedingungen sehr unterschiedlich. Bahl formuliert dazu die These: „Die Situation des ausbildenden Personals ist eng verbunden mit dem Stellenwert der Ausbildung in den jeweiligen Unternehmen. Ausbildung war in den untersuchten Fällen überwiegend tradierter, selbstverständlicher – und entsprechend wenig reflektierter und aktiv gestalteter – Bestandteil der Unternehmenskultur“9.
Rollenwandel vom Ausbilder zum Lernprozessbegleiter
Seit einigen Jahren wird auf den Rollenwandel des betrieblichen Bildungspersonals hingewiesen. Dieser wird im Wesentlichen durch veränderte Anforderungen im pädagogischen Handeln – einer Abkehr von reiner Wissensvermittlung – hin zum Lernprozessbegleiter, zum Coach oder Moderator gekennzeichnet.1 Die Veränderungen im Aufgabenfeld des betrieblichen Ausbildungspersonals werden mit der technischen (digitalen), wirtschaftlichen und strukturellen Entwicklung in den Betrieben und der damit einhergehenden nachhaltigen Änderung der Arbeitsabläufe begründet. Dieser „beschleunigte Wandel der Arbeitswelt“2 kann dazu führen, dass das vermittelte Fachwissen schon während der Ausbildungszeit veraltet ist. Es muss also in der modernen Berufsausbildung darum gehen, die Jugendlichen auf den stetigen Wandlungsprozess in der Arbeit vorzubereiten. Die Herausforderung für das betriebliche Bildungspersonal besteht deshalb darin, die „resultierenden Qualifikations- und Kompetenzanforderungen zu erkennen und die Beschäftigten entsprechend der jeweils vorhandenen Kompetenzen zu fördern und auf veränderte Aufgaben vorzubereiten“3.
In diesem Kontext wird gerne von der sogenannten „kompetenzorientierten Wende“ gesprochen. Das Bildungspersonal muss „die Herausbildung berufsbiografischer Gestaltungskompetenz“4 der Auszubildenden fördern, um sie in die Lage zu versetzen, „ihre eigene (Berufs-)Biografie […] gestalten zu können“5. Kompetenzen lassen sich aber nicht lehren, sondern sie müssen in Handlungssituationen erlernt werden. In vielen kleinen und mittleren Unternehmen ebenso wie im Sektor „Dienstleistung“ verlagert sich das berufliche Lernen wieder näher zum Arbeitsplatz hin. Der Lernort „Arbeit“ erfährt dadurch eine Renaissance6 und die Hauptlast der Ausbildung muss deshalb von den ausbildenden Fachkräften getragen werden, „die bislang keinerlei berufspädagogische Bildung genossen haben […] und auf ihre Ausbildungsaufgabe nur in wenigen Betrieben inhaltlich vorbereitet werden“7.
Die Anforderungen an die ausbildenden Fachkräfte – wie auch an hauptberufliche Ausbilder – sind heute deutlich höher und komplexer. Mangelnde „Ausbildungsreife“, schlechte schulische Voraussetzungen, der Wertewandel, mangelnde Motivation und andere konstatierte Schwierigkeiten der Auszubildenden machen das Ausbilden schwieriger. Hinzu kommt eine größere Heterogenität durch unterschiedliche Bildungsvoraussetzungen, kulturelle Herkunft, und vor allem aufgrund des unterschiedlichen Alters der Auszubildenden. Auch durch die Integration von Absolventen dualer Studiengänge in die duale Ausbildung werden die Anforderungen höher. Die Ausbilder müssen sich ständig auf individuelle Bedingungen der Auszubildenden neu einstellen. Dazu kommt die Anforderung, kompetenz- und handlungsorientiert auszubilden. Dies „verlangt zweifelsfrei mehr pädagogische Fantasie und pädagogisches Engagement vom Ausbildenden als die traditionellen Ausbildungsziele“8.
Berufspädagogische Professionalisierung
Die beschriebenen Veränderungen und Herausforderungen an das betriebliche Bildungspersonal führen zu einer notwendigen Veränderung des berufspädagogischen Handelns. Um diese bewältigen zu können, sind „weiterführende Qualifikationen und Kompetenzen erforderlich“1. In erster Linie haben, neben den fachlichen, besonders die berufspädagogischen und auch sozialpädagogischen Qualifikationen an Bedeutung gewonnen.2 Waren in den 1990er-Jahren die pädagogischen Qualifikationen nach dem Selbstverständnis der Berufsausbilder noch von nachgeordneter Bedeutung, „so wird heute zumindest für das hauptberufliche Bildungspersonal von der Notwendigkeit einer Doppelqualifikation in fachlicher und pädagogischer Hinsicht gesprochen“3.
Beim notwendigen Qualifikationsbedarf ist eine Differenzierung zwischen den betrieblichen Ausbildungsakteuren notwendig. Durch die zunehmende Verlagerung des Lernens in die Echtarbeit, und dem damit einhergehenden Bedeutungszuwachs, rückt die ausbildende Tätigkeit der Fachkräfte in den Vordergrund. Diese sind nicht nur zahlenmäßig die größte Gruppe innerhalb der beruflichen Ausbildung, sondern sie sind auch „immer mehr diejenigen, die die jungen Menschen tatsächlich ausbilden“4. Im Widerspruch zu ihrer Bedeutung steht ihr oft geringer berufspädagogischer Qualifikationsgrad. Sie verfügen im Wesentlichen über ihre Fachkompetenz, ihre berufspädagogischen Erfahrungen beziehen sie jedoch meist nur aus ihrer eigenen Ausbildungszeit. Dies kann zur „Tradierung von veralteten, modernen kompetenzorientierten Ausbildungen nicht angemessenen Ausbildungsformen“5 führen.
Hier wird der notwendige Qualifizierungsbedarf deutlich. Brater und Wagner fassen diesen in folgende Kompetenzbereiche zusammen.
Eine berufspädagogische Methodik wäre: „Wie schließe ich die Realaufgaben meines Arbeitsplatzes (bzw. die Inhalte meiner Fachtheorie) so auf, dass der Auszubildende möglichst selbstständig und handelnd das lernen kann, was er lernen soll?“
„Wie bilde ich möglichst kompetenzorientiert aus und wie unterstütze ich das Lernen?“6
Eine Kompetenz zur persönlichen Begleitung der Auszubildenden: „Wie kann ich meine Auszubildenden motivieren bzw. wie kann ich eine Demotivierung vermeiden?“
„Welches Kommunikationsverhalten ist angemessen?“
„Wie begleite ich sie bei Lernschwierigkeiten und Verhaltensproblemen?“7
Sicherheit bei der Beurteilung der Auszubildenden, ihrer Leistung und ihres Verhaltens: „Wie kann ich richtig beobachten?“
„Wie kann ich das Beobachtete angemessen verbalisieren und bewerten?“8
Die beschriebene zunehmende Verlagerung der Ausbildung an den Lernort „Arbeit“ stellt die ausbildenden Fachkräfte vor eine berufspädagogische Herausforderung. Erstens können sie „nur solche Lernprozesse ermöglichen, die sich auf die Anforderungen“9 ihres Arbeitsplatzes beziehen, und zweitens sind sie, bedingt durch die kurze Verweildauer der Auszubildenden an ihrem Arbeitsplatz, nicht in der Lage, einen Gesamtzusammenhang der Ausbildung herzustellen. Ausbildende Fachkräfte stehen diesen „gewachsenen berufspädagogischen Aufgaben“10 allein gegenüber. Hieraus ergibt sich eine neue Aufgabe für die hauptberuflichen Ausbilder, denn „die ausbildenden Fachkräfte können ohne Begleitung, Unterstützung und Koordination durch hauptamtliche Ausbilder ihre Ausbildungsaufgabe nicht erfüllen“11.
Weitere Aspekte, wie etwa die „ausbildungsbiografische“ Betreuung der Auszubildenden, die den inneren Zusammenhang der betrieblichen Lernstationen wahrt, kommen hinzu. Ebenso resultieren aus der Unterstützung und Betreuung der ausbildenden Fachkräfte neue Aufgaben, vor allem die Qualifizierung zugunsten einer optimalen Gestaltung von Lernarrangements in der Echtarbeit, der Umgang mit Jugendlichen in schwierigen Lernsituationen und die berufliche Sozialisation. Aber auch neue, sogenannte „Managementaufgaben“ kommen auf das hauptberufliche Ausbildungspersonal zu: die Modernisierung der Ausbildung, die Erhebung des betrieblichen Qualifikationsbedarfs, die Rekrutierung neuer Auszubildender – hier ist vor allem das Ausbildungsmarketing zu erwähnen –, aber auch Bildungscontrolling und Fragen der Weiterbildung der Belegschaft im Kontext der demografischen Entwicklung. Brater erkennt an dieser Stelle einen markanten Rollenwandel beim betrieblichen Ausbildungspersonal.
Bahl stellt hier die Frage, ob es sich tatsächlich um eine neue Rolle, und damit verbunden, einen Paradigmenwechsel für das Ausbildungspersonal handelt, oder ob nicht vielmehr eine „kontinuierliche Weiterentwicklung vor dem Hintergrund bestehender und seit langem bekannter Entwicklungen, die zwar zu Differenzierungen und z. T. zu kontroversen Anforderungen […] führen“12, dahintersteht, weshalb eben nicht von einer „grundsätzlich neuen Rolle“13 gesprochen werden kann.
Bei der großen Anzahl ausbildender Fachkräfte kann diesem Qualifikationsbedarf in zeitlicher und finanzieller Hinsicht gewiss nicht in seminaristischer Form entsprochen werden. Arbeitsintegrierte und auf informelles Lernen konzentrierte Qualifikationsformen sowie Multiplikatorensysteme sind hierfür nötig.14
In Betrieben mit hauptberuflichem Ausbildungspersonal wird die professionelle Begleitung und Unterstützung der ausbildenden Fachkräfte zukünftig eine wichtige Aufgabe werden. Hierfür ist aber eine berufspädagogische Professionalisierung notwendig, die sich weniger der „klassischen Ausbildungstätigkeit selbst“15 widmet, „sondern viel mehr das Planen, Initiieren und Begleiten von handlungsbezogenen Lernprozessen“16 beinhaltet. Die neu geschaffenen, aufeinander aufbauenden, Abschlüsse „Gepr. Aus- und Weiterbildungspädagoge/-in“ und „Gepr. Berufspädagoge/-in“ bieten einen entsprechenden Rahmen.
Weitaus schwieriger gestaltet sich die Qualifizierung der ausbildenden Fachkräfte in Kleinbetrieben ohne hauptberufliches Bildungspersonal. Hier wird es darauf ankommen, den innerbetrieblichen Erfahrungsaustausch sowie die Unterstützung durch Ausbildungsberater der Kammern und Innungen zu verstärken, wohlwissend, dass es zu wenige von ihnen gibt. Der dritte Lernort wird ebenso an Bedeutung zunehmen. Das dortige hauptberufliche Ausbildungspersonal deckt bereits einen Teil der Ausbildungsinhalte ab und könnte eine weitere Unterstützung übernehmen, im Rahmen der Begleitung von Auszubildenden am Arbeitsplatz und der berufspädagogischen Beratung der ausbildenden Fachkräfte.17 Diese neuen Aufgaben könnten durch die oben genannten Abschlüsse eine Professionalisierung erfahren.
Die Veränderungen durch die sogenannte kompetenzorientierte Wende in den Berufsbildern, die zunehmenden fachlichen Anforderungen, der sich weiterentwickelnde Bedarf an Schlüssel-Qualifikationen, die Heterogenität der Auszubildenden und die zunehmende Verzahnung von Aus- und Weiterbildung erweitern die Berufsausbildung zu einer deutlich anspruchsvolleren Aufgabe, „die eine breite berufspädagogische Qualifizierung rechtfertigt“18. Bahl konstatiert in diesem Kontext: „[…] vor diesem Hintergrund ist die pädagogische Arbeit des Ausbildungspersonals aufzuwerten, in aktuellen Rollenbildern aufzugreifen und durch umfassende Qualifizierungs- und Professionalisierungsansätze sicherzustellen“19.
Die Qualifizierungsangebote und die dadurch bedingte Professionalisierung könnten der Herausbildung eines eigenständigen Ausbilderberufs dienen“20 und somit die Möglichkeit der Identifikation eröffnen.
Das beschriebene Anforderungspaket an das betriebliche Ausbildungspersonal zeigt ein gefragtes und erwünschtes Kompetenzprofil, das ohne eine berufspädagogische Professionalisierung nicht zu realisieren ist. Soll es gelingen, alle Jugendlichen, wie vom BMBF gefordert, zu einer erfolgreichen Ausbildung zu führen, müssen die beteiligten Bildungsakteure mehr in ihre eigene Qualifizierung investieren. Hierbei muss zwischen den hauptberuflichen Ausbildern und den ausbildenden Fachkräften deutlich differenziert werden, da sich ihre Möglichkeiten der Professionalisierung stark voneinander unterscheiden.
Dieses Buch will hierzu einen Beitrag leisten. Es finden sich in sehr unterschiedlichen Kapiteln für alle Leser ansprechende Anregungen und pädagogische Hintergrundinformationen. Alle Autoren sind erfahrene Bildungsakteure, die aus der Praxis der Aus- und Weiterbildung kommen.
Dadurch konnte ein Buch von der Praxis für die Praxis geschaffen werden. Ich wünsche allen Lesern bei der Lektüre viele neue Erkenntnisse, die die eigene Praxis unterstützen.