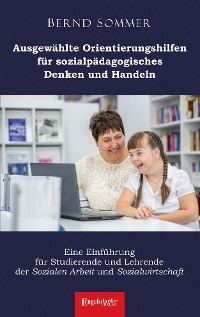Loe raamatut: «Ausgewählte Orientierungshilfen für sozialpädagogisches Denken und Handeln»
Bernd Sommer
Ausgewählte Orientierungshilfen für sozialpädagogisches Denken und Handeln
Eine Einführung für Studierende und Lehrende der
Sozialen Arbeit und Sozialwirtschaft
Engelsdorfer Verlag
Leipzig
2021
Bibliografische Information durch die Deutsche Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.de abrufbar.
Copyright (2021) Engelsdorfer Verlag Leipzig
Alle Rechte beim Autor
Titelbild © Ermolaev Alexandr [Adobe Stock]
Hergestellt in Leipzig, Germany (EU)
Vorwort
Seit mehr als 20 Jahren lehre ich, von 1997-2004 nebenamtlich auf Honorar-Basis, seit dem Jahr 2004 als hauptamtlich tätiger Professor an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg am Standort Villingen-Schwenningen in der Fakultät für Sozialwesen in dem Studiengang Sozialwirtschaft.
Im Studiengang Sozialwirtschaft, der im Jahre 1998 an der damaligen Berufsakademie Villingen-Schwenningen als erster grundständiger Studiengang im Bereich Sozialwirtschaft/Sozialmanagement in Deutschland seinen Betrieb aufnahm, unternahmen wir im Jahre 2002 den Versuch, die Philosophie des neuen dualen Ausbildungsganges in einem Buch zu begründen.
Der erste Leiter dieses Studiengangs, Herr Prof. Helmut E. BECKER, bat uns neben- und hauptamtlich Lehrende, zu ausgewählten Orientierungen des von ihm entwickelten Sozialwirtschaftlichen Sechsecks grundständige Beiträge zu verfassen1.
Mein Auftrag bestand damals darin, unter dem Titel Das sozialpädagogische Denken und Handeln zwischen Sachzielorientierung, ethischer Orientierung und Kundenorientierung die zentrale Fragestellung zu beantworten: Wie denkt und handelt ein Sozialpädagoge? 2
Von der akademischen Ausbildung bin ich Diplom-Pädagoge mit dem Schwerpunkt Heil- und Sonderpädagogik, hatte aber meine Studienzeit in den 1980er und beginnenden 1990er Jahren in ausgiebiger Weise dafür eingesetzt, die engen Grenzen einzeldisziplinärer Sichtweisen zu überwinden. Zunächst im Lehramtsstudium für Gymnasien in den Fächern Sport, Latein und Englisch eingeschrieben, weitete ich meine Interessen aus, so dass ich neben dem Diplom-Pädagogik-Studium auch in Veranstaltungsangebote anderer Fachbereiche hineinschnuppern konnte: Alte Geschichte, Archäologie, Altgriechisch, Theologie, Philosophie, Germanistik, Politik, dies neben den verbindlich zu belegenden Nebenfächern Soziologie und Psychologie.
Das Doppelstudium Lehramt und Diplom-Pädagogik, aus Sorge vor der drohenden Lehrerarbeitslosigkeit Mitte der 1980er Jahren eher intuitiv eingerichtet, sollte sich in Hinblick auf meine spätere Berufstätigkeit als ein Glücksgriff erweisen.
Mit Antritt meiner ersten beruflichen Tätigkeit im sogenannten Sozialpädagogischen Dienst eines Neurologischen Rehabilitationszentrums für hirngeschädigte Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im April 1992 begab ich mich auf die zunächst als unsystematisch zu bezeichnende Suche nach möglichen Orientierungshilfen, an denen ich mein im Werden befindendes professionelles Handeln ausrichten konnte.
Im Studium an der Philipps-Universität Marburg standen vor allem theoretische Aspekte von Erziehungswissenschaft und Pädagogik im Mittelpunkt, auf die praktischen Anforderungen einer außerschulischen pädagogischen Tätigkeit wurde lediglich im Rahmen zweier sechswöchiger Praktika vorbereitet.
Die nachfolgenden mehr als zehn Jahre sozialpädagogischer Tätigkeit an der Basis der Sozialen Arbeit haben in mir ein Grundverständnis angelegt, wie Lern-, Hilfe- und Entwicklungsprozesse von Menschen geplant, durchgeführt und gemeinsam ausgewertet werden können.
Aus dieser Zeit meiner ersten Schritte der Professionalisierung stammen einzelne Veröffentlichungen aus dem Bereich sozialpädagogischer Aufgaben in der Neurologischen Rehabilitation, deren Aussagen später nach Bekleiden der Professur für Soziale Arbeit weiterentwickelt wurden.
Ende der 1990er Jahre stieß ich auf den Themenbereich Didaktik, der mir aus meinem Lehramtsstudium über Veranstaltungen zur Allgemeinen Didaktik und Fachdidaktik sehr wohl bekannt war, dem ich aber bis zu diesem Zeitpunkt kein besonderes Interesse im Denkzusammenhang meiner praktischen Tätigkeiten geschenkt hatte.
So sollte das Thema Didaktik in der außerschulischen pädagogischen Arbeit ab diesem Zeitpunkt einer meiner zentralen Lehr-, Forschungs- und Veröffentlichungsschwerpunkte werden.
Auf die methodische Ausbildung wird im Rahmen des Studiums der Sozialen Arbeit sehr viel Gewicht gelegt. Dies lässt sich u.a. an der Vielzahl und Vielfalt von Veröffentlichungen zum Themenbereich Methodisches Handeln in der Sozialen Arbeit ablesen, Veröffentlichungen, die mittlerweile mehrere Meter von Regalen in wissenschaftlichen Bibliotheken einnehmen.
Ich gehe in meinem Denken davon aus, dass Fragen der Methode, also Fragen des Weges, der eingeschlagen wird, um ein Thema zu bearbeiten oder ein Ziel zu erreichen, lediglich einen Baustein aus dem übergeordneten Konzept der Didaktik darstellen. Diesen Denkansatz, der in der wissenschaftlichen Diskussion durchaus als umstritten gilt, versuche ich seit Jahren die ihm aus meiner Sicht zustehende Bedeutung zu verleihen.
Aus den Erstsemester-Lehrveranstaltungen zum Thema Einführung in das sozialpädagogische Denken und Handeln, die ich in den vergangenen mehr als zehn Jahren regelmäßig im Bachelor-Studiengang Sozialwirtschaft angeboten habe, werden grundlegende Einsichten und Erkenntnisse angesprochen, auf deren Grundlage dann Orientierungshilfen für sozialpädagogischen Handeln abgeleitet werden können.
Diese Gedanken werden fortlaufend weiterentwickelt und sollen der interessierten Fachöffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden, um damit eine aus meiner Sicht notwendig werdende Diskussion anzustoßen.
Zu danken ist an dieser Stelle den Studierenden, die über interessiertes Rückfragen und kritisch-konstruktives Hinweisen zur Weiterentwicklung vieler Gedankengänge beigetragen haben. Ohne sie hätte ein Buch wie das vorliegende nicht entstehen können.
Widmen möchte ich den vorliegenden Band meiner im Juni 2020 verstorbenen Ehefrau Silvana Maier-Sommer, die ebenfalls vom Fach war. Als ausgebildete Diplom-Sozialpädagogin an der Katholischen Fachhochschule Freiburg arbeitete sie 28 Jahre in dem Neurologischen Rehabilitationszentrum, in dem auch ich in den ersten zehn Jahren meines Berufslebens tätig war.
Auch außerhalb der Arbeitszeit entstanden so interessante Gespräche über Grundfragen und Grundlagen sozialpädagogischen Denkens und Handelns. Da wir uns von Charakter und Wesenszügen als sehr unterschiedlich erwiesen, waren folgerichtig auch die Arbeitsstile und Herangehensweisen, auch die Art und Intensität zwischenmenschlicher Kommunikation unterschiedlich, was zu manch fruchtbaren Diskussionen um inhaltliche, didaktische und methodische Aspekte unseres Arbeitens führte.
Ich erinnere mich gut an manche Situationen, in denen sie mich fragte, was ich eigentlich an der Hochschule lehrte, ob die differenzierte Diskussion von Begrifflichkeiten wie Ganzheitlichkeit, Didaktik, Konzept und Methode nicht ein rein akademischer Diskurs im Elfenbeinturm sei.
Es war interessant und sehr bereichernd, dass sie aus der Sicht einer in der praktischen Sozialen Arbeit an der Basis Tätigen mich in meiner Lehrtätigkeit an der Hochschule in kritischer Weise hinterfragte. So wirkte sie hinsichtlich mancher Fragen als eine Art Korrektiv, das immer wieder aufs Neue die Sinnhaftigkeit meiner Lehrveranstaltungen an der Hochschule anzweifelte.
So danke ich Dir, Silvana, hiermit nicht nur für 28 Jahre gemeinsamen Lebens, das Du mit mir geteilt hast, nicht nur für die drei wunderbaren Kinder, die wir zusammen haben, sondern auch für manch spannende Gespräche über fachliche und menschliche Herausforderungen im Kontext sozialpädagogischer Arbeit.
Für kritische Rückfragen und konstruktive Anregungen stehe ich den Leserinnen und Lesern gern zur Verfügung.
Bernd Sommer Singen, im Mai 2021
Inhaltsverzeichnis
Cover
Titel
Impressum
Vorwort
1. Einleitung
1.1. Einführung
1.2. Problemhintergrund
1.3. Fragestellungen und Zielsetzungen
2. Ausgewählte Orientierungshilfen für sozialpädagogisches Handeln
2.1. Einführung
2.2. Grundlogik zielorientierten Vorgehens
2.3. Die Zehn Gebote der Sozialarbeit nach LATTKE
2.4. Die Allgemeinen Prinzipien der Sozialen Einzelfallhilfe nach MAAS
2.5. Der Methodische Vier-Schritt
2.6. Das Modell der Kooperativen Prozessgestaltung
2.7. Das Konzept des Pädagogen als Lernhelfer nach GIESECKE
2.8. Grundgedanken einer Didaktik (in) der sozialpädagogischen Arbeit
3. Sozialpädagogisches Handeln in der Neurologischen Rehabilitation - Ein Praxisbeispiel
3.1. Ausgangsbeobachtung
3.2. Sozialpädagogische Aufgabenbereiche in der Neurologischen Rehabilitation
3.3. Beispiele von sozialpädagogischen Interventionen/Angeboten
3.4. Zwischenfazit
3.5. Didaktische Überlegungen am Beispiel Orientierungs- und Zugtraining
3.5.1. Einführung
3.5.2. Analyse der Ausgangssituation/ Situationsbeschreibung
3.5.3. Inhaltliche Schwerpunkte, Begründungen und Vorgehensweisen
3.5.4. Zum Planen, praktischen Umsetzen und Reflektieren des Lernprozesses
3.5.5. Zusammenfassung und Einschätzung aus didaktischer Perspektive
4. Grundsätze als Orientierungshilfen für sozialpädagogisches Handeln
4.1. Zusammenfassung
4.2. Von didaktischen Überlegungen zu Grundsätzen sozialpädagogischen Handelns
4.3. Ausblick
5. Literaturverzeichnis
Angaben zu dem Verfasser
Endnoten
1. Einleitung
1.1. Einführung
Wir wollen planvoll und zielgerichtet, also methodisch und professionell arbeiten. Dies ist keinesfalls eine Forderung, die ausschließlich von außen an uns gestellt wird, sondern die wir selbst auch als Anspruch an uns als Berufsgruppe der Sozialpädagogen/innen formulieren.
Wir wollen im Kanon allgemein anerkannter Wissenschaftsdisziplinen um unsere begründete Meinung gefragt werden. Unsere Sichtweise soll Einfluss haben auf Entscheidungen übergeordneter Ebene.
Wo und wie lernen wir jedoch professionelles Denken und Handeln in sozialpädagogischen Arbeitsbereichen?
In der Regel durchlaufen in der Sozialen Arbeit professionell Tätige unterschiedliche Ausbildungs- und Studiengänge. Dies reicht von der Ausbildung zum/r Erzieher/in, über Heil- und Erziehungspfleger/in, über Jugend- und Heimerzieher/in bis hin zu Sozialpädagogen/innen und Diplom-Pädagogen/innen mit unterschiedlichen Schwerpunkten, neuerdings im Zuge der sogenannten Bologna-Reform auch zu den Abschlüssen Bachelor und Master of Arts in Studiengängen der Sozialen Arbeit und Sozialwirtschaft.
Das Besuchen von Fort- und Weiterbildungen schließt sich in der Regel insbesondere dann an, wenn spezielle Erfordernisse und Kenntnisse in einem spezifischen Arbeitsgebiet als Voraussetzungen für professionell gestaltetes Arbeiten offensichtlich werden.
Der Studiengang Sozialwirtschaft an der Dualen Hochschulen Baden-Württemberg in Villingen-Schwenningen bildet nicht Sozialpädagogen/innen aus, sondern ermöglicht einen Abschluss als Bachelor of Arts im Studiengang Sozialwirtschaft.
Der Studiengang Sozialwirtschaft fußt auf drei Säulen: der Sozialen Arbeit bzw. Sozialpädagogik, der Betriebs- und Volkswirtschaftslehre und der Rechtswissenschaft.
Weitere sogenannte Bezugswissenschaften für Studiengänge aus dem Sozialwesen stellen die Pädagogik bzw. Erziehungswissenschaft, die Psychologie, die Soziologie, Geschichts- und Politikwissenschaften, Philosophie und Theologie, Medizin, die Gesundheits- und Pflegewissenschaften sowie die Ethik dar3.
Am Ende ihres Studiums sollen die Studierenden in der Lage sein, die engen Grenzen einer disziplinären Betrachtung zugunsten einer zumindest in Ansätzen deutlich werdenden interdisziplinären bzw. sozialwirtschaftlichen Perspektive4 überwinden zu können und zu einem neuen, nicht über Einzeldisziplinen bzw. einzelne Orientierungen des Sozialwirtschaftlichen Sechsecks abzudeckenden Blickwinkel auf einen Menschen, eine Situation, eine Notlage zu gelangen.
Dazu ist es u.a. notwendig, nicht nur fachlich-inhaltliche Aspekte der jeweiligen Wissenschaftsdisziplin zu kennen, sondern auch die jeweilige Vorgehens- und Herangehensweisen, die sich z.T. von anderen unterscheiden, die z.T. jedoch auch mit anderen Disziplinen Gemeinsamkeiten aufweisen.
Im Rahmen der Erstsemester-Einführungsveranstaltungen wird im Rahmen von Modul 1 das sozialpädagogische Denken und Handeln thematisiert. Sinnhafte Antworten ausfindig zu machen und mögliche Orientierungshilfen auf die zentrale Fragestellung zu entwickeln, wie ein Sozialpädagoge denkt und handelt, ist der explizit formulierte Auftrag an diese grundlegende Lehrveranstaltung im 1. Semester.
1.2. Problemhintergrund
Die Angebote für Möglichkeiten der Orientierung aus der einschlägigen Literatur sind hinsichtlich professionellsozialpädagogischen Vorgehens vielfältig und in ihrer Zahl kaum mehr überschaubar. Von daher wird eine Auswahl nötig sein. Ich gehe im Rahmen dieses Bandes von der Grundvorstellung eines pädagogischen Verständnisses von Sozialer Arbeit aus.
Viele Tätigkeiten in diesem Bereich, zumindest diejenigen, die im unmittelbaren Kontakt mit Klienten/innen stattfinden, stellen die eines Lernhelfers5 dar, eines professionell Tätigen, der Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten für Menschen schafft, also pädagogisch tätig wird. Im erweiterten Sinne sind wir also in Arbeitsbereichen tätig, bei denen es um das Planen, Durchführen und Auswerten zielgerichteter Lern-, Hilfe- und Entwicklungsprozesse geht.
Im Folgenden werden Überlegungen angestellt, mit denen es möglich wird, einen sozialpädagogischen Blick auf einen Menschen, auf ein Thema oder Problem zu werfen.
Mit den Handlungsformen von Helfen, Beraten und Fürandere-Dasein werden die beruflichen Tätigkeiten sozialpädagogischer Mitarbeiter/innen beschrieben, wobei jedoch, so die kritische Anmerkung von LENZEN in diesem Zusammenhang, die Aufgabenfelder von professionell in der Sozialen Arbeit Tätigen so vielfältig seien wie die Probleme, Nöte und Anliegen ihrer Klienten/innen6.
So falle es den in der Sozialen Arbeit professionell Tätigen oftmals schwer, „Außenstehenden und anderen Berufen ihre speziellen Stärken und Kompetenzen zu erläutern. Sie können anderen kaum erklären, was sie eigentlich tun und warum man für die Ausübung dieser Tätigkeit ein akademisches Hochschulstudium“7 benötige.
In der einschlägigen Literatur lassen sich einige ernstzunehmende Modelle ausmachen, nach denen die Vielfalt und Vielschichtigkeit anstehender Aufgaben in der Sozialen Arbeit das Erwerben und Ausprägen von Kompetenzen auf unterschiedlichen Ebenen erforderlich mache. Dabei seien pädagogische Kompetenzen im engeren Sinne ebenso gefragt wie politische, juristische, administrative, medizinische und ökonomische Kompetenzen8.
Andere Autoren wie beispielsweise MILLER sprechen von Fähigkeiten beruflichen Handelns, wobei seiner Typologie nach folgend zwischen kognitiven, personalen, sozialen, psychomotorischen und instrumentellen Fähigkeiten unterschieden werden könne9.
MAUS, NODES und RÖH nennen in diesem Zusammenhang folgende Schlüsselkompetenzen: strategische Kompetenz, Methodenkompetenz, sozialpädagogische Kompetenz, sozialrechtliche Kompetenz, sozialadministrative Kompetenz, personale und kommunikative Kompetenz sowie berufsethische Kompetenz10.
Von SPIEGEL wie auch WELLHÖFER prägen unabhängig voneinander den Fachterminus der vier Dimensionen von Kompetenz-Profilen der Sozialen Arbeit, unter die sie persönliche Grundvoraussetzungen, instrumentelle Kompetenzen, (selbst-)reflexive Kompetenzen sowie soziale Kompetenzen fassen11.
In unterschiedlichen Beiträgen habe ich darauf hingewiesen, dass der Lernhelfer12, also derjenige, der geplante, angeleitete, zielgerichtete Lern-, Hilfe- und Entwicklungsprozesse initiiert, durchführt und auswertet, Kompetenzen in folgenden Bereichen benötige, um anstehende Aufgaben „aktiv, verantwortungsvoll und in professioneller Weise“13 angehen zu können: personale, fachlich-inhaltliche, didaktische und methodische, soziale und kommunikative Kompetenzen, die Fähigkeit zur (selbst-)kritischen Reflexion sowie wissenschaftliche Kompetenzen14.
Diese Kompetenzen sind dabei nicht hierarchisch, d.h. nach steigender bzw. fallender Bedeutung geordnet, sondern stellen in ihrer Gesamtheit das Instrumentarium dar, auf dessen Grundlage die oder der sozialpädagogisch Tätige in professioneller Weise arbeiten kann.
Während der Begriff Didaktisches Denken in der sozialpädagogischen Grundlagen-Literatur eher eine untergeordnete Bedeutung einnimmt, ist der des Methodischen Handelns in unterschiedlichen Zusammenhängen Sozialer Arbeit zu finden, in denen systematisches, schrittweise erfolgendes, aufeinander aufbauendes, planmäßiges Vorgehen zur Erreichung eines Zieles vorausgesetzt wird.
Trotz der Vielfalt von kontrovers diskutierten Begriffsdefinitionen kann von der Grunderkenntnis ausgegangen werden, dass Methodischem Handeln in der Sozialen Arbeit im genannten Sinne in der Regel unterschiedliche Phasen bzw. Denk- und Arbeitsschritte zugeordnet werden können.
Dies reicht von der Problem- bzw. Situationsanalyse, über das Entwickeln und Formulieren von Zielen, das Feststellen und Analysieren von vorhandenen Ressourcen, das begründete Auswählen von Methoden, Arbeitsformen, Arbeitstechniken und -verfahren, von dem Planen und Durchführen sozialpädagogischer Interventionen und Angebote bis hin zu der Phase des Aus- und Bewertens, fachterminologisch ausgedrückt des Evaluierens15.
Während Methodik demnach als Wissenschaft vom zielgerichteten Handeln bezeichnet werden kann, stellt Didaktik den Teilbereich von Pädagogik dar, der sich mit dem Planen, Durchführen und Auswerten von angeleiteten, zielgerichteten Lern-, Hilfe- und Entwicklungsprozessen beschäftigt16.
Unmittelbar mit dem Didaktik-Begriff verbunden ist der zentrale Ausdruck Lernen.
In Anlehnung an WINTELER könne unter Lernen Folgendes verstanden werden: Wissen vermehren, Auswendiglernen und Reproduzieren, Anwenden, Verstehen, etwas auf eine andere Weise sehen, sich als Person verändern.
Während die ersten drei Lern-Konzeptionen vor allem als etwas verstanden werden könnten, was außerhalb der Person als gegeben gesehen, das von den Menschen aufgenommen, abgelegt und später reproduziert werden könne, komme in den letzten drei Konzeptionen „Sinn und Bedeutung des Wissens eine zentrale Rolle“17 zu.
1.3. Fragestellungen und Zielsetzungen
Lernen in außerschulischen sozialpädagogischen Feldern kann nach Aussagen von MARTIN mit den Aspekten Orientierung an Alltagsproblemen, mit einer relativen Offenheit in seinen institutionellen und organisatorischen Rahmenbedingungen, mit seiner methodischen Vielfalt, mit den Möglichkeiten einer ganzheitlichen Herangehensweise und mit denen der Umsetzung eines aneignenden, erfahrungsbezogenen Vorgehens charakterisiert werden18.
Zudem, so GORGES, werden mit außerschulischem Lernen die Kennzeichen Freiwilligkeit, gemeinsames Erarbeiten von Zielvorstellungen, Inhalten und Vorgehensweisen, Alltags- und Erfahrungsorientiertheit, die gemeinsame Bewertung der Ergebnisse und der Lernprozesse sowie die Tatsache eines als lebenslanges, d.h. nicht auf bestimmte Altersgruppen oder -stufen einzuschränkenden Lernens verbunden19.
In dem vorliegenden Band wird von einem ausgesprochen pädagogischen Verständnis von Sozialer Arbeit ausgegangen. Lernen stellt in diesem Denkzusammenhang das übergeordnete Ziel sozialpädagogischen Handelns im Unterschied zu anderen Formen sozialen Handelns dar20. Folgerichtig kann die oder der professionell sozialpädagogisch Tätige, die oder der Lernen ermöglicht, als Lernhelfer/in bezeichnet werden21.
Das Anregen bzw. Befähigen, Eigenkräfte der Hilfesuchenden zu entwickeln und konstruktiv einzusetzen, Menschen zu befähigen, für sich und ihre Mitmenschen verantwortlich zu handeln, Menschen während bestimmter Phasen ihres Leben professionell zu begleiten und zu betreuen, Menschen für die Hilfe für Mitmenschen zu sensibilisieren22, auf einen Nenner gebracht, Menschen in ihren individuellen Lern- und Entwicklungsprozessen zu betreuen und zu begleiten, also als Lernhelfer zu fungieren, stellen klassisch sozialpädagogische Handlungsformen dar.
Welche möglichen Orientierungshilfen professionell sozialpädagogisch Tätigen in ihren unterschiedlichen Arbeitsfeldern grundsätzlich zur Verfügung stehen, wird als die zentrale Fragestellung im vorliegenden Band zu beantworten sein.
Die in der Literatur auffindbaren Ansätze, Modelle und Konzepte sozialpädagogischen Denkens und Handelns sind jedoch als so vielfältig zu bezeichnen, dass hier nicht der Anspruch auf Vollständigkeit der Darstellung erhoben werden kann und soll.
Als einer derjenigen, der nicht nur in der Theorie, sondern auch mehr als zehn Jahre an der Basis der Sozialen Arbeit tätig war, nehme ich mir an dieser Stelle das Recht, eine Auswahl zu treffen, die aus meiner Sicht mit der Grundvorstellung des Pädagogen als Lernhelfer kompatibel scheint23. Am Ende der jeweils dargestellten Orientierungshilfen werden didaktische Hinweise abgegeben, wie diese im Rahmen von Lehrveranstaltungen an der Hochschule eingeführt werden können. D.h. es sollen nicht ausschließlich fachlich-inhaltliche Aspekte angesprochen werden, nicht nur Ergebnisse und Erkenntnisse aus der Diskussion und Reflexion von Arbeitspapieren, sondern auch Fragen didaktischer Natur sollen thematisiert werden.
Es sollen also gleichermaßen zwei unterschiedliche Zielgruppen erreicht werden: die Studierenden der Sozialen Arbeit und Sozialwirtschaft auf der einen Seite, die neben- und hauptamtlich Lehrenden auf der anderen Seite.
Zudem werden aus den Erfahrungen mit Lehrveranstaltungen an der Hochschule und deren Reflexion kritische Aspekte der jeweiligen Orientierungshilfen herausgearbeitet, auf deren Grundlage letztlich eine qualitativ-inhaltliche Weiterentwicklung möglich wird.
Als ein erstes Hilfsmittel für ein professionelles Vorgehen zur Entwicklung möglicher Lösungsstrategien der vielfältigen und komplexen Aufgaben Sozialer Arbeit steht den sozialpädagogisch ausgebildeten Lernhelfern als Instrumentarium, als praktisches Handwerkszeug und grundlegende Orientierungshilfe die sogenannte Grundlogik zielorientierten Vorgehens zur Verfügung24.
Darauf folgt ein Rückgriff auf eine der klassischen Methoden der Sozialen Arbeit, die Soziale Einzelfallhilfe, in deren Rahmen zum einen die Zehn Gebote der Sozialarbeit nach LATTKE25, zum anderen die Allgemeinen Prinzipien der Sozialen Einzelfallhilfe nach MAAS26 und nicht zuletzt der sogenannte Methodische-Vier-Schritt 27 als mögliche Orientierungshilfen herangezogen werden können, mit deren Hilfe den sozialpädagogisch Tätigen eine Struktur für ihr professionelles Handeln vorgeschlagen wird.
Der Methodische Vier-Schritt, ursprünglich aus dem Konzept der Sozialen Einzelfallhilfe entwickelt, wird in der Literatur in zwei unterschiedlichen Varianten beschrieben, in dem sogenannten Medizinischen Modell, auch Modell professioneller Expertenschaft genannt, und dem sogenannten Sozialwissenschaftlichen Modell, dem Modell klienteler Kompetenz 28.
Kritisch anzumerken ist im Rahmen der Betrachtung beider Varianten des traditionellen Methodischen Vier-Schrittes die Beobachtung, dass die Aspekte Kompetenz- und Ressourcenorientierung sowie das explizite Formulieren von Zielfragen nicht aufgenommen werden. Dies findet zum Teil erst in dem im Jahre 2011 entwickelten, aus sieben Phasen bestehenden Modell der Kooperativen Prozessgestaltung in der Sozialen Arbeit in Ansätzen statt29.
Des Weiteren wird in aller erforderlichen Kürze in das Konzept des Pädagogen als Lernhelfer nach GIESECKE eingeführt, ein Konzept, das er bereits im Jahre 1987 ausarbeitete und der interessierten Fachöffentlichkeit in Erstauflage vorstellte30.
Da didaktische Überlegungen in Ansätzen immer wieder angebracht werden, lohnt ein einführender Blick auf die Entwicklung einer Didaktik (in) der sozialpädagogischen Arbeit 31.
Die Grundlogik zielorientierten Vorgehens wird in diesem Zusammenhang in pädagogische bzw. didaktische Fachterminologie übersetzt und liegt in deren Anlehnung als Didaktische Analyse nach MARTIN, als Verlaufsmodell der didaktischen Arbeit nach GORGES und als grundlegendes Modell professionellen Handelns mit den Schritten Analysieren, Planen, Handeln und Auswerten/Reflektieren der angebahnten Lern-, Hilfe- und Entwicklungsprozesse vor.
Die Sinnhaftigkeit und Praktikabilität des aus diesen Ansätzen entwickelten Modells der didaktischen W-Fragen wird in Kapitel 3 anhand eines realen Praxisbeispiels aus der sozialpädagogischen Arbeit in einem Neurologischen Rehabilitationszentrum für hirngeschädigte Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene veranschaulicht.
Pädagogische, hier im engeren Sinne didaktische Überlegungen können dazu beitragen, weitreichende Lern-, Hilfe- und Entwicklungsprozesse in professioneller Weise planen, durchführen und auswerten zu können.
In Kap. 3 fließen die bislang lediglich auf theoretischer Ebene angestellten Überlegungen ein und werden mit praktischen Erfordernissen in Verbindung gebracht. Anhand eines konkreten Beispiels aus der sozialpädagogischen Arbeit werden die zuvor erläuterten Orientierungshilfen auf ihre Sinnhaftigkeit und praktische Anwendbarkeit hin überprüft32.
Im Rahmen von Kap. 4 werden die wesentlichen Erkenntnisse zusammengetragen und einer kritischen Reflexion unterzogen. Als Erkenntnis werden schließlich sozialpädagogische Grundsätze formuliert, die den außerschulisch tätigen Kolleginnen und Kollegen als Orientierungshilfe für ihr professionell sozialpädagogisches Handeln dienen können. Sie sollen ein Angebot darstellen, über die Grundlagen des eigenen professionellen Handelns (selbst-) kritisch nachzudenken und u.U. neue Perspektiven zu entwickeln.
Tasuta katkend on lõppenud.