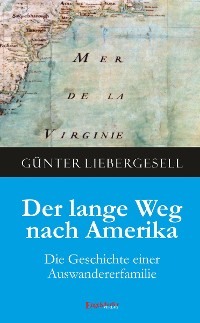Loe raamatut: «Der lange Weg nach Amerika»
Günter Liebergesell
Der lange Weg nach Amerika
Die Geschichte einer Auswandererfamilie
Engelsdorfer Verlag
Leipzig
2015
Bibliografische Information durch die Deutsche Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Copyright (2015) Engelsdorfer Verlag Leipzig
Alle Rechte beim Autor
Zeichnungen:
Karl Heinz Gaebel (S. 12, 14, 35, 47, 52, 60, 71, 84)
Günter Liebergesell (S. 30)
Fotobearbeitung Günter Liebergesell (S. 76, 77)
Hergestellt in Leipzig, Germany (EU)
Für meine Kinder Daniel, Susan, Johannes, Anna und Robert
Inhaltsverzeichnis
Cover
Titel
Impressum
Anmerkung
Der lange Weg nach Amerika
Stammbaum der Familie Conrad
Glossar
Anmerkung
Zu dieser Erzählung wurde ich inspiriert durch Artikel in der „Allgemeinen Auswanderungs-Zeitung“ Rudolstadt, vom 16. und 20. Januar und vom 27. Februar 1868 sowie durch Funde in meiner Ahnenforschung. Die Grundlage und den Rahmen für die Handlung, bilden die Ereignisse auf dem Auswandererschiff Leibnitz.
Die in der Erzählung vorkommenden und handelnden Personen die mit einem * versehen sind, wurden von mir nicht erfunden. Sie lebten zu der Zeit, greifen aber nicht in die Handlung ein. Ebenso sind auch alle Schiffe, Reedereien und Einrichtungen erfunden die nicht mit diesem * gekennzeichnet wurden.
Aus diesem Grund scheint es mir angebracht, darauf hinzuweisen das diese Geschichte vollkommen meiner Phantasie entsprungen ist. Jede Übereinstimmung mit lebenden oder verstorbenen Personen ist daher rein zufällig.
Günter Liebergesell
Mein Haar ist grau geworden, die Augen sehen nicht mehr so gut, die Zähne schmerzen und mein Gang ist nicht mehr sicher. Ich glaube das Ende meiner Tage ist nicht mehr fern. So wird es Zeit meinen Nachfahren aufzuschreiben, wie ich mit meiner Familie in die „Neue Welt“ gekommen bin und in Amerika, unserer neuen Heimat, Fuß fasste.
Mein Name ist Henry Conrad. Geboren wurde ich am 13. Mai des Jahres 1833, als Heinrich Christian Conrad, Sohn des Christian Gottfried Conrad und seiner Frau Eva Wilhelmine, einer geborenen Schmidt, in dem kleinen Ort Menteroda im Herzogtum Sachsen-Coburg und Gotha*.
Unser Herzogtum war erst 1826 durch einen Schiedsspruch König Friedrich August II. von Sachsen entstanden, der so eine umfassende Neugliederung der Ernestinischen Herzogtümer regelte. Sachsen-Coburg erweiterte auf diese Weise seine Regentschaft auf das sächsische Herzogtum Gotha und seitdem führt die Familie auch den Namen Sachsen-Coburg und Gotha. Zu dieser Neuaufteilung war es nach dem Aussterben der Linie Sachsen-Gotha-Altenburg gekommen. Der Herzog von Sachsen-Hildburghausen tauschte sein Herzogtum mit Sachsen-Altenburg, die Linie Sachsen-Meiningen bekam Sachsen-Hildburghausen und von Sachsen-Coburg-Saalfeld den Saalfelder Landesteil sowie das Amt Themar und einige Orte. Das Herzogtum Sachsen-Coburg-Saalfeld erhielt dafür das Herzogtum Sachsen-Gotha, von Sachsen-Hildburghausen die Ämter Königsberg und Sennefeld und von Sachsen-Meiningen die Güter Callenberg und Gauerstadt. Ein neuer Flickenteppich war entstanden und Menteroda lag ganz im Norden, als kleiner Zipfel oder schmale Flicke.
Die Gemeinde Menteroda kaufte kurz vor meiner Geburt die Schafhaltungsgerechtigkeit vom Gut in unserem Dorf, das dem Herrn von Fischborn gehörte und mein Vater wurde als Schäfer beschäftigt. Sehr oft begleitete ich ihn auf die Weide, wir schliefen im Freien unter dem Sternenhimmel und wenn es mal regnete, suchten wir unter einem Baum Schutz.
Er erklärte mir die Welt und lehrte mich alles, von dem er glaubte, dass es für mein späteres Leben einmal wichtig sein könnte. So lehrte er mich, dass in allem was sich bewegt, auch Leben sein muss, dass es zu achten und zu bewahren gilt. Aber er sagte auch: Stock und Stein können dir deine Knochen brechen, mein Sohn, aber niemals deinen Willen.“
Vater war ein sehr gottesfürchtiger Mann, doch legte er die Bibel oft ganz anders aus, als der Pastor in unserer Gemeinde. Ich hielt mich natürlich an die Auslegungen meines Vaters, was mir sehr häufig Strafen einbrachte.
Am liebsten hätte ich die Schule geschwänzt, denn dort konnte ich nicht mehr lernen, als mir mein Vater vermittelte. Und wir Kinder waren ja auch eine notwendige Arbeitskraft, auf die in einer armen Familie kaum verzichtet werden konnte. Doch Vater sagte immer: Wir haben in Sachsen-Gotha schon seit 1642 eine Schulpflicht, weil es ganz wichtig ist, das ihr was lernt und euer Leben einmal selbst in die Hand nehmen könnt. So lernte ich was ich lernen konnte und nach der Schule half ich meinen Eltern bei der Arbeit. Als ich 13 Jahre alt war, kam es im ganzen Land zu Wetterunbilden, Naturkatastrophen und Missernten. Hungersnöte waren die Folge und selbst bei uns auf dem Land wurde das tägliche Brot knapp, weil das Korn auf den Halmen verfaulte, oder Mäuse und Ratten die Speicher plünderten.
Die schlechte Wirtschaftslage konnte vielen Menschen keinen Arbeitsplatz mehr bieten und massenhafte Hungerunruhen breiteten sich aus und entluden sich in Plünderungsaktionen, die zum Großteil nicht durch Hunger sondern in erster Linie durch die Teuerung des Getreides ausgelöst wurden.
In Preußen verhängte König Friedrich Wilhelm IV.* im Mai 1847 sogar den Notstand, um staatliche Zwangsmaßnahmen gegen Eigentümer größerer Getreidebestände anwenden zu können. Die Lebensmittelpreise stiegen in astronomische Höhen und eine große Familie zu ernähren, war kaum mehr möglich. Besonders das Brotgetreide erreichte Preise von noch nicht gekannter Höhe. So kostete ein Scheffel1 Roggen 5 Taler. Das Getreide war so knapp, das man es mit Kleie und anderen Samen streckte und einige Bäcker versuchten sogar Brot aus Queckenwurzelmehl herzustellen. Ich habe es einmal gegessen und sagte danach zu meiner Mutter: ‚Lieber esse ich Gras!’ so gut hatte es mir gemundet. Meine Eltern schafften es aber immer auf wunderbare Weise, uns Kinder satt zu bekommen, obwohl auch ich Tage kennen lernte, in denen mir der Magen bis zu den Fußsohlen hing. Nun sollte es sich zutragen, dass noch bevor ich das Mannesalter erreichte, mein Vater, wenig über 41 Jahre alt, an der Schwindsucht starb und ich als sein einziger Sohn, ihm in dem ehrlos geltenden Gewerbe2 als Schäfer folgte. Ich trat gern in seine Fußstapfen, denn ich liebte diese Arbeit, auch wenn sie von vielen nicht geachtet wurde, nur wenig einbrachte und so nur ein bescheidenes Dasein sicherte.
Ein Jahr nach dem Tod meines Vaters verließ uns meine Mutter im 43. Lebensjahr. Sie lag einfach eines Morgens tot im Bett, auf ihren Lippen ein feines Lächeln, als wenn sie froh war, wieder mit ihrem Liebsten vereint zu sein. Wir bestatteten sie neben ihrem Mann auf dem Gottesacker hinter unserer Kirche.
Meine beiden älteren Schwestern Anna Sophie und Maria Theresia, hatten schon das Haus verlassen. Sie waren beide verheiratet und wohnten in Nachbarorten. Wir sahen uns kaum noch, hatten doch beide ihre Familien und ihr Haus, um die es sich zu kümmern galt. Und ich konnte auch kaum von meiner Arbeit fort. Es war in diesen harten Zeiten immer damit zu rechnen das ein ‚Wolf’ in meine Herde einfiel, um so für viele Tage den eigenen und die Bäuche der seinen zu füllen.

Mit 23 Jahren nahm ich die wunderschöne Maria Dorothea Therese Fendt zu meinem Weibe. Wir kannten uns schon viele Jahre und trafen uns wann immer und wo immer es möglich war. Sie liebte wie ich die saftigen Wiesen und unsere lichtdurchfluteten Buchenwälder, den ruhigen versteckten kleinen See mitten im Wald, an dem sich Fuchs und Hase gute Nacht wünschten.
Wir sammelten Beeren und Pilze, kümmerten uns um das Wohl der uns anvertrauten Schafe und sonnten uns in unserm Glück. Wenn ich heute zurück schaue, so war dies wohl die sorgloseste und glücklichste Zeit in meinem Leben. Und so geschah was immer geschieht, wenn zwei Menschen sich verlieben. Es kommt der Tag, wo man ohne diesen lieben Menschen nicht mehr sein möchte.
An unserem Lieblingsbaum schwor ich ihr meine Liebe und Treue und bat sie, meine Frau zu werden. Ohne eine Sekunde zu zögern sagte sie „Ja“ und gab mir einen Kuss, den ich wohl nie vergessen werde. Ein Jahr nach unserer Eheschließung gebar mir meine Maria unsere erste Tochter, der wir den wohlklingenden Namen Ernestine Christiane Henriette gaben. Es sollte aber nicht bei dieser einen Schönheit bleiben. 1860 erblickte Christiane Frederike das Licht der Welt und vier Jahre später Johanne Wilhelmine Karoline.

Ich fühlte mich als der glücklichste Mann auf Gottes Erde. Doch dieses Glück hörte plötzlich auf.
Säbelrasseln war überall zu hören. Aus heutiger Sicht muss ich sagen, es war eine sehr unruhige Zeit, in die ich hinein geboren worden waren. Ganz Europa begann sich zu verändern. Jeder Landesherr stellte Truppen auf und griff dabei auf uns junge Männer zurück. Ich musste, wie es Pflicht war, meinen Militärdienst leisten und wurde in die 3. Kompanie des Herzoglich Sachsen-Coburg-Gothaschen Infanterieregiments als Musketier eingezogen.
Und das zu einer Zeit, als Otto von Bismarck*, der preußische Ministerpräsident, eine Bundesreform forderte, die aber von Österreich abgelehnt wurde. Die Streitfrage um Schleswig-Holstein beantwortet Preußen nach dem Bruch des Gasteiner Vertrags mit dem Einmarsch in Holstein und dem Austritt aus dem Deutschen Bund. Preußen versuchte nun alle Länder nördlich des Main unter seine Hoheit zu bekommen und Österreich gewann die süddeutschen Staaten sowie Sachsen, Hannover und Hessen zum Krieg gegen Preußen.
Das Königreich Hannover, an der Seite Österreichs stehend, versuchte sich mit seiner Armee durch Thüringen, Richtung Bayern durchzukämpfen. Doch die Preußen verstanden es, mit ihren Verbündeten, also uns, diesen Durchbruchsversuch rechtzeitig zu verhindern. Am 27. Juni 1866 kam es bei Langensalza zu einem blutigen Gefecht. Das Heer aus Hannover kämpfte gegen das 11. und 25. Preußische Regiment* und die 3. Kompanie des Herzoglich Sachsen-Coburg-Gothaschen Infanterieregiments*, in der ich meinen Dienst tat.
Wir hatten uns hinter einem Erdwall, der mit Hecken bewachsen war, gut verschanzt und warteten auf das Heer aus Hannover. Immer wieder streckte ich meinen Kopf über den Wall, um zu schauen und fragte mich, ‚wirst du wirklich auf einen schießen? Ja, aber nur wenn er mich bedroht. Aber sind das nicht unsere hannoverschen Brüder? Vielleicht haben die ja auch Frau und Kinder, nein das kann ich nicht, ich schieße vorbei, die hannoverschen werden bestimmt auch über uns hinweg schießen?’
Ein dumpfer Ton erklang neben mir und mein Nachbar sank von einer Kugel getroffen, tot zu Boden. „Das war sicher nur eine verirrte Kugel, die sollte ihn nicht treffen, vielleicht mich...“ Ich zitterte am ganzen Körper, so sehr hatte mich die Angst in ihren Krallen. Verstärkt wurde das alles noch, wenn die Erde durch einschlagende Geschosse der Kanonen erschüttert wurde. Erst am Nachmittag wurden die Kampfhandlungen eingestellt und ich blickte mich um. Der Tod stand an diesem Tag des Öfteren an meiner Seite, hielt blutige Ernte, übersah mich aber zum Glück immer. Viele meiner Freunde beendeten an diesem Tag oder Tage später, wegen ihrer Verwundungen ihr Leben.
Am 29. Juni 1866 musste die Hannoversche Armee wegen der technischen Überlegenheit Preußens kapitulieren. Da waren zum einen die modernen Zündnadelgewehre, die in der Königlichen Gewehrfabrik Erfurt seit 1862 produziert wurden. Doch noch wichtiger war die Nutzung der jungen Eisenbahn. Mit dessen Hilfe konnte in kürzester Frist nach anfänglicher, zahlenmäßiger Unterlegenheit ein Ring von 40.000 Soldaten um die 20.000 Hannoveraner samt ihrem König Georg V. gezogen werden. Die Preußen, so erzählte mir unser Hauptmann Martin Beer, hatten sogar im Jahr 1864 Beobachter nach Amerika geschickt, um in Erfahrung zu bringen, wie sich die Eisenbahn für Truppentransporte und für den Nachschub einsetzen lässt.
Preußen besetzte nun Hannover und errang bei Königgrätz in Böhmen ein paar Wochen später einen entscheidenden Sieg gegen Österreich.
Ich hatte die Nase voll. Das Land war verwüstet, es gab keine Arbeit und meine Familie hatte kaum etwas zu essen. Überall verarmten die Menschen und eine Missernte folgte der anderen.
Halt, eins muss ich noch erwähnen, über die Zeit beim Militär. Während der Schlacht von Langensalza sah ich immer wieder Männer mit weißen Fahnen, auf denen sich ein rotes Kreuz befand. Etwa 30 junge Männer, durch den Hilfsgedanken des Roten Kreuzes entfacht, der durch einen preußischen Diplomaten mit nach Gotha gebracht wurde, entschlossen sich spontan den vielen Verletzten auf dem Schlachtfeld zur Hilfe zu eilen. Das war, so weit ich mich erinnere, der weltweit erste Einsatz des Roten Kreuzes* und er wurde ein großer Erfolg. Ich sagte mir, wenn man meint, einen Konflikt nur noch kriegerisch lösen zu können, muss man sich dessen bewusst sein, dass es viele Unschuldige trifft. Ich wollte nicht einer von diesen sein, denn es brodelte an allen Ecken und Enden des Landes und Pulvergeruch überzog Städte und Dörfer.
Was ich mir früher habe gefallen lassen, das ertrug ich jetzt nur noch mit Murren und lautem Widerspruch und dies wurde zu einer drückenden Last, die ich mir nicht weiter aufbürden lassen wollte. Der Schmerz über Ungleichheit, über Rechtlosigkeit, über Zurücksetzung, über Nichtbeachtung steigerte sich in dem Maße, in welchem die Empfänglichkeit für Recht und Gleichheit, für Wahrheit und Menschenwürde zunahm. Und bei mir und vielen Menschen wurde der Gedanke immer lebendiger: So sollte es nicht sein!
Doch was sollte man machen? Das magere Land konnte seinen Kindern keine Arbeit bietet und ihre harte Mühe wurde nur spärlich entlohnt. Was sollte man tun, wenn selbst in der Fremde der fleißigste Mann nicht ausreichend Brot für seine Familie verdienen konnte. Was blieb schließlich übrig, als dem heimatlichen Boden Lebwohl zu sagen und sein Glück in der neuen Welt zu versuchen!
Eines Tages brachte ich eine Zeitung mit nach Hause, in der sich ein kleiner Artikel befand:
„Es gibt viele nicht hinreichend bemittelte Leute, um zu gesteigerten Preisen pro Schiff nach Nordamerika übersiedeln zu können. Billigere Gelegenheit war bisher nur selten geboten. Ende des Jahres und Anfang des Kommenden aber ist der Überfahrpreis im Zwischendeck, sowohl in Bremen, als auch in Hamburg, auf 45 Preußischen Taler, Kinder 20 Preußischen Taler ermäßigt – eine Konjunktur, die von mehreren Interessenten gerne benutzt werden dürfte.“
Natürlich war uns bewusst, das, als eine gute Zeit für eine Einschiffung, die Monate Mai bis September empfohlen wurde, denn in dieser Zeit war das Wetter weniger stürmisch, als in den Wintermonaten. Doch 100 Preußische Taler für einen Erwachsenen für die Überfahrt hatten wir einfach nicht.
In Amerika wollte ich mich als Landwirt niederlassen und da war es wichtig, wie mir ein alter Freund aus Menteroda sagte, möglichst früh im Februar einzutreffen, um dann noch Zeit für die erste Bestellung der Felder und eine erste Ernte im Herbst zu haben.
Um an das nötige Geld zu kommen, mussten wir alles Hab und Gut verkaufen.
Doch zuerst galt es sich die Auswanderungspapiere zu besorgen. Diese mussten bei der Gemeinde beantragt werden. Für die Auswanderung nach Amerika gab es folgende Bestimmungen:
Tasuta katkend on lõppenud.