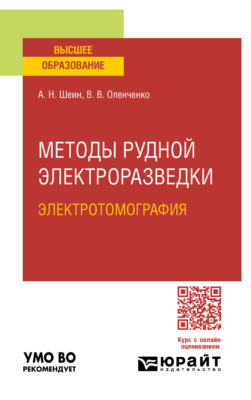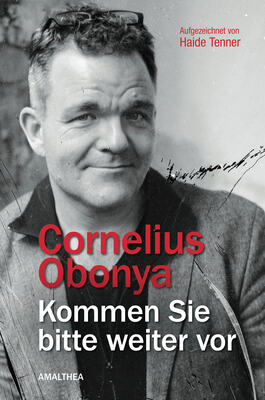Loe raamatut: «Der Klang der Stille»
Philippe Jordan
Der Klang der Stille
Aufgezeichnet von Haide Tenner

Fotonachweis: Heimo Binder: Erste symphonische Erfahrungen: Proben zu Beethovens Eroica in Graz, 2002; Bertrand Rindoff Petroff: Nach einer Ballettaufführung von Daphnis und Chloe mit der damaligen Ballettdirektorin Brigitte Lefèvre (rechts): Paris, 2014, Gruppenfoto nach einer Vorstellung von Daphnis und Chloe: Paris, 2014; Keiko Tachikawa: Schlussapplaus zu Capriccio von Richard Strauss: Wiener Staatsoper; 2008.
Alle weiteren Abbildungen stammen aus dem Privatarchiv von Philippe Jordan.
Der Verlag hat sich um die Einholung der Abbildungsrechte bemüht. Da in einigen Fällen die Inhaber der Rechte nicht zu ermitteln waren, werden rechtmäßige Ansprüche nach Geltendmachung abgegolten.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
© 2020 Residenz Verlag GmbH
Salzburg – Wien
Alle Rechte, insbesondere das des auszugsweisen Abdrucks und das der fotomechanischen Wiedergabe, vorbehalten.
Umschlaggestaltung: www.boutiquebrutal.com
Umschlagfoto: Jean-François Leclercq
Typografische Gestaltung, Satz: Lanz, Wien
Lektorat: Christine Dobretsberger
Gesamtherstellung: GGP Media, Pößneck
ISBN 978 3 7017 3463 4
eISBN 978 3 7017 4649 1
Inhalt
Vorwort
Der Blick in eine andere Dimension
Die frühen Jahre
Die Galeerenjahre
Die Aufbaujahre
Die Pionierjahre
Oper, die größte Form der Kunst
Pariser Leben
Mozart
Verdi und Puccini
Berlioz
Strauss
Debussy
Moses und Aron mit Easy Rider
Bérénice – Eine Uraufführung
Wagner & Bayreuth
Aus dem Graben auf das Podium
Die Wiener Symphoniker – Gemeinsames Erleben
Schubert – Der Romantiker
Bach – Alles wird gut
Beethoven – Das Alpha und das Omega der Symphonik
Bruckner – Das innere Singen
Berlioz – Das Abenteuer
Brahms – Es gibt kein Zurück mehr
Schumann – Zwei Seelen in einer Brust
Strauss – Immer klingt es
Britten – Krieg und Frieden
Mahler – Nichts ist so gemeint, wie es zunächst klingt
Solisten – Ein Geben und Nehmen
Resümee
Wien – Und wieder schließt sich ein Kreis
Das Handwerk des Dirigierens
Realisation oder Interpretation?
Was ist Erfolg?
Musik in unserer Zeit
Stille
Personenregister
Vorwort
Viele Gespräche für dieses Buch fanden im achten Stock der Opéra Bastille in Paris statt. Dort hatte Philippe Jordan elf Jahre lang sein Büro als musikalischer Direktor der Opéra National de Paris, eine Position, die er bereits mit 35 Jahren angetreten hatte. Das von François Mitterrand initiierte und 1989 eröffnete Opernhaus, als Ergänzung zum berühmten historischen Palais Garnier entstanden, bietet enorme technische Möglichkeiten und hat das Opernleben von Paris grundlegend verändert.
Ein Steinway-Flügel, eine Sitzgarnitur für Besprechungen, unzählige Bücher und Noten, eine Hi-Fi-Anlage, eine Kaffeemaschine und ein großartiger Blick über Paris prägen die Atmosphäre des großen, hellen Büros von Philippe Jordan. Klarheit, Weitblick und Stilgefühl zeichnen auch den Künstler aus, aber in den vielen Monaten, in denen ich ihn bei seiner Arbeit begleiten konnte, erlebte ich ihn auch nachdenklich, empfindsam, philosophierend, offen für Spiritualität, leidenschaftlich brennend für die Musik und fern jeder Selbstzufriedenheit. Und so wurde aus diesem Buch, das Musikliebhabern, gegenwärtigen und zukünftigen Konzert- und Opernbesuchern Einblicke in die Welt der Musik geben soll, ein sehr persönliches Dokument über die Entwicklung des Menschen und Musikers Philippe Jordan, seine Sicht auf Komponisten und die Realisierung ihrer Werke.
Die Karriere des Schweizer Dirigenten, der auch Pianist, Kammermusiker und Liedbegleiter ist, verlief für unsere Zeit ungewöhnlich geradlinig, aber auch unglaublich schnell: Beginn der Laufbahn als Korrepetitor, mit 20 Jahren bereits die erste Festanstellung am Stadttheater Ulm, wo auch Herbert von Karajan begonnen hatte, es folgt ein Engagement als Kapellmeister und Assistent von Daniel Barenboim an der Staatsoper Unter den Linden in Berlin. Bereits mit 27 Jahren wird er Chefdirigent des Grazer Opernhauses und des Grazer Philharmonischen Orchesters, die internationale Opernkarriere beginnt: Gastdirigate am Royal Opera House, Covent Garden, in London, an der Metropolitan Opera in New York, bei den Salzburger Festspielen, am Teatro alla Scala in Mailand, an der Wiener Staatsoper, an der Bayerischen Staatsoper in München etc.
Philippe Jordan erzählt diesen Weg ganz anders: Er erzählt von »Fettnäpfchen«, in die er immer wieder getreten ist, von Lernprozessen, Erfahrungen, Enttäuschungen, wichtigen Begegnungen und auch von seiner Kindheit, in der die Wurzeln für alles Spätere liegen. Er erzählt von seinem 2006 verstorbenen Vater, dem Schweizer Dirigenten Armin Jordan, der unter anderem gleichzeitig mit Carlos Kleiber Kapellmeister am Opernhaus Zürich, Chefdirigent der Oper in Basel und vor allem – als Nachfolger von Horst Stein – zwölf Jahre lang Chefdirigent des Orchestre de la Suisse Romande (OSR) war. Armin Jordan galt, neben seiner Vorliebe für französisches Repertoire und die Wiener Klassik, als einer der wesentlichen Wagner-Dirigenten seiner Zeit. 1982 hatte er die musikalische Leitung des Parsifal-Films von Hans-Jürgen Syberberg inne, in dem er selbst auch den Amfortas spielte, 30 Jahre später debütiert sein Sohn Philippe mit Parsifal in Bayreuth.
2009 wird Philippe Jordan musikalischer Direktor der Opéra National de Paris und macht nicht nur durch seinen Ring Paris unter anderem wieder zu einer Wagner-Stadt. Fünf Jahre später fällt die Lebensentscheidung, die Konzerttätigkeit, die er bereits beim Pariser Orchester sehr forciert hatte, zu einem »zweiten künstlerischen Standbein« zu machen. Jordan wird ab der Saison 2014/15 Chefdirigent der Wiener Symphoniker, ein renommiertes Spitzenorchester, das ein wesentlicher Teil des künstlerischen Lebens und auch der musikalischen Entwicklung des Dirigenten wird. Philippe Jordan wirft einen sehr persönlichen Blick auf jene Komponisten, denen er mit diesem Orchester Schwerpunkte gewidmet hat, erzählt vom Spannungsfeld zwischen Konzertpodium und Orchestergraben und von der Doppelfunktion als musikalischer Leiter einer Oper und eines Symphonieorchesters. Wenn dann zu dieser intensiven Tätigkeit noch die Einladung der Metropolitan Opera kommt, in New York eine Wiederaufnahme des kompletten Ring des Nibelungen von Wagner zu leiten, und daher drei Monate der Spielzeit für die »normalen« Verpflichtungen wegfallen und kompensiert werden müssen, wird die Belastung massiv. In dieser Saison fanden die vielen Gespräche für das vorliegende Buch statt. Eine echte Herausforderung! Doch dann kam die Corona-Krise, Opernvorstellungen und Konzerte wurden abgesagt und die Zeit konnte für vertiefende Arbeiten an diesem Buch genutzt werden.
Wenn Philippe Jordan in der Saison 2020/21 sein Amt als Musikdirektor der Wiener Staatsoper antritt, hat er bereits viele Jahre Erfahrung in führenden Positionen hinter sich und bis zu siebzig verschiedene Opern dirigiert. Konsequente Arbeit an Klang und Stil war ihm immer wichtig, ebenso wie die geistige Durchdringung eines Werkes gemeinsam mit den Ausführenden. Was davon ist erlernbar, wie entsteht eine Klangvorstellung im Kopf, wie vermittelt er das, was ist die Rolle des Publikums, wie entsteht Klarheit oder Farbenreichtum, warum muss jedes Stück immer wieder neu gedacht werden? – Fragen, die jeden Konzert- oder Opernbesucher beschäftigen, und die Philippe Jordan hier betrachten will.
Als der Künstler in einer für Schulklassen geöffneten Probe im Wiener Musikvereinssaal ein paar Takte eines Werkes immer wieder spielen ließ und an allen Details arbeitete, hörte man die Kinder murren. Der Dirigent drehte sich um und sagte lächelnd: »Ich bin nicht gemein, nur genau!« Wie aus diesem Handwerk und dieser Arbeit Musizierfreude entsteht, wie er es erreicht, die Musik sprechen zu lassen, auch davon handelt dieses Buch.
Ein wesentliches Thema für Philippe Jordan ist immer wieder die Stille, der Raum, aus dem die Musik kommt. Fragen rund um den Zusammenhang zwischen Klängen, den Schwingungen der Stille und bewusst erlebter Gegenwart beschäftigen ihn schon seit seiner Jugend, Philosophie und Spiritualität sind ein wichtiger Grundton seines Lebens.
Der Blick in eine andere Dimension
Musik erinnert uns daran, dass es etwas gibt, das man mit dem Verstand nicht begreifen und auch nicht erklären kann. Etwas, das wir nicht greifen, nicht sehen können. Man kann Musik zwar analysieren, sie beschreiben, sie folgt auch bestimmten Regeln, aber in ihrem Wesen ist sie etwas Immaterielles. Musik wird physisch auf Instrumenten oder mit Stimmbändern hergestellt, vielleicht auf Papier notiert, trotzdem bringen uns die Frequenzen, die dabei übertragen werden, auf eine andere Schwingungsebene und verbinden uns mit einer anderen Dimension. Ich möchte Menschen den Blick in diese Dimension ermöglichen, sei es durch ein rauschhaftes Erleben oder durch die Einkehr in Stille. Musik ist in der Lage, uns den Klang der Stille und die Intensität des Augenblicks bewusst zu machen. Die Energie und die Emotion, die Musik in mir auslöst, möchte ich weitergeben. Wenn ich Musik mache, fühle ich mich am stärksten bei mir. Ich habe das Bedürfnis, mich durch Musik auszudrücken, mich durch Musik mitzuteilen. Mit Musik bin ich am authentischsten, mehr als mit Sprache oder anderen Mitteln der Kommunikation. Alles, was Musik mit mir macht, möchte ich mit Kammermusikpartnern, mit einem Orchester und natürlich mit dem Publikum teilen. Musik führt unterschiedliche Menschen, verschiedene Persönlichkeiten aus allen Kulturen zusammen, weil sie sich gemeinsam auf etwas einlassen wollen. Gemeinsam singen, gemeinsam spielen, gemeinsam tanzen – das alles verbindet Menschen. Diese Synchronisation ist intensive emotionale Kommunikation. Das Publikum ist ein ganz wichtiger Teil davon, denn die Aufmerksamkeit eines Publikums in einem stillen Saal zu erleben, ist eine Voraussetzung dafür, dass wir Musik machen können. Ich saß einmal in Bayreuth bei der Liebesszene von Tristan und Isolde hinter der Bühne, hörte diese unglaubliche Musik fantastisch gesungen, dirigiert und musiziert. Da verstand ich plötzlich, dass die Musik auch deshalb besonders spannend war, weil die Aufmerksamkeit drum herum so groß war. Die Stille des Publikums, die Konzentration aller Mitwirkenden, der Raum an Bewusstsein, der dabei entsteht, sind das eigentlich Spannende, das Magische. Wagner oder Mozart schaffen die Musik, um diesen Raum, diese Stille erlebbar zu machen. Auch wenn die Musik sehr laut ist, hat man 2000 Menschen in einem Saal, die durch ihre Stille und Aufmerksamkeit für ein Konzert oder eine Opernaufführung zu wichtigen Mitspielern werden.
Jeder im Publikum nimmt etwas anderes wahr. Man erlebt sich dabei in einem Spiegel, hat die Möglichkeit, bewegt zu werden und darüber nachzudenken, was die Musik in einem auslöst. Menschen kommen dabei in verschiedene emotionale Zustände, in andere Dimensionen, um letztendlich näher zu sich zu kommen. Dabei wird man mit den schönen – aber auch den weniger schönen – Seiten in sich konfrontiert. Wenn ich zum Beispiel Musik von Johann Sebastian Bach höre, sortieren sich meine Gedanken und Gefühle, der Körper ist still und die verschiedensten Parameter können sich verknüpfen.
Jeder, der selbst Musik macht, weiß, dass dabei die emotionale Intelligenz gefördert wird. Deshalb halte ich es für eine Katastrophe, dass der Musikunterricht in den Schulen zunehmend verschwindet. Er wird als musisches Fach abgetan, in dem man ein wenig Spaß haben soll oder Fingerfertigkeit übt. Für die linke Gehirnhälfte, für das rationale Denken, haben wir Mathematik, Physik, Biologie und vieles andere. Auch den Sport halte ich in der Schule für wichtig. Obwohl ich selbst als Kind den Sport hasste, denke ich, dass sich Kinder körperlich ausdrücken müssen. Was im Unterricht jedoch vernachlässigt wird, ist die Kunst, vor allem die Musik, denn man muss denken können, rechnen, lesen und schreiben können, man muss analysieren können, aber man muss auch fühlen und mitfühlen können, aufeinander hören und auf den anderen zugehen können, auch sich öffnen können, um sich auszudrücken. Die Gesellschaft verkümmert, wenn sie darauf keinen Wert mehr legt.
Wenn ich die Musik nicht hätte, wäre ich vielleicht nicht verloren, aber ich hätte keinen Boden unter den Füßen und müsste sehr mühsam andere Wege gehen, um meinen Platz zu finden. Ein Leben ohne Musik kann ich mir nicht vorstellen.
Die frühen Jahre
Eine meiner frühesten Kindheitserinnerungen ist mein Gefühl der Entthronung mit zweieinhalb Jahren durch die Geburt meiner Schwester. Meine Eltern hatten mich nicht gerade ideal darauf vorbereitet. Plötzlich war ich nicht mehr der Einzige – was damals ein einschneidendes Erlebnis für mich war. Ab diesem Zeitpunkt wurde ich schwierig, wollte Aufmerksamkeit, tat die unmöglichsten Dinge, um mich bemerkbar zu machen und hielt die Stille, die später eine elementare Kraftquelle für mich wurde, zu Hause nicht aus. Ich war ein neugieriges, lebhaftes Kind mit einem starken Willen – aber sicher kein einfaches Kind. Trotzdem hatte ich immer ein sehr gutes Verhältnis zu meiner Schwester und wir mögen uns sehr. Mit ungefähr sechs Jahren entdeckte ich die Musik für mich. Ich begann Klavier zu spielen und sah an der Reaktion meiner Eltern, dass sie Freude daran hatten, dass ich etwas »Sinnvolles« tat. Ich merkte, dass Musik ein gutes Ventil war, um die Zustimmung, Anerkennung und Liebe zu bekommen, die ich dringend gebraucht hatte. Mein Vater war selten zu Hause, was auch für meine Mutter nicht leicht war; ich musste funktionieren, irgendwie alleine zurechtkommen. Wenn mein Vater zu Hause war, empfanden wir das wie ein Fest. Ich erinnere mich gut daran, wie schwer es für mich und natürlich auch für meine Schwester war, wenn er wieder wegfuhr. Ich glaube, von ganz klein auf habe ich immer meinen Vater gesucht. Ziemlich sicher war das der erste Impuls für meine intensive Beschäftigung mit Musik. Wenn ich ihn in den Ferien besuchte, sah ich, wie er mit Orchestern arbeitete, Opern und Konzerte dirigierte. Als ich noch kleiner war, gingen wir in Zürich am Sonntag in die Kantine des alten Opernhauses, wo mein Vater Kollegen von früher traf. Er war in den Sechzigerjahren dort Kapellmeister gewesen. Ich kann mich gut daran erinnern, wie er mir den Orchestergraben zeigte und die Bühne, was mich natürlich faszinierte. Meine Mutter war Tänzerin an diesem Opernhaus gewesen und meine Eltern hatten sich dort auch kennengelernt. Manchmal ging auch sie mit mir ehemalige Kolleginnen oder Maskenbildnerinnen besuchen. Die ganze Theaterwelt mit Perücken, Masken und Kostümen fand ich faszinierend. Auch ins Balletttraining, das sie bis zum heutigen Tag macht, nahm sie mich oft mit. Ich saß dann neben der Pianistin und durfte ihr umblättern.
Die erste Oper, die ich mich erinnere gesehen zu haben, war die Zauberflöte unter der Leitung meines Vaters bei einer Generalprobe in Lausanne. Mit sieben oder acht Jahren beeindruckte mich das unglaublich: die Musik, die Dialoge, die Handlung, einfach alles. Ich spürte plötzlich, was Oper mit mir anzustellen in der Lage ist. Ich war so beeindruckt, dass ich spontan zu Hause die ganze Bühne aus Papier nachbaute.
Als mein Vater Chefdirigent in Basel war, nahm er mich dort zu einer Generalprobe von Der fliegende Holländer mit. Er brachte mich auf den obersten Rang, damit ich alles gut sehen konnte und niemanden störte. Als der Vorhang aufging, sah ich ein riesiges Schiff und einen großen Chor, was mich zunächst beeindruckte. Aber danach verstand ich die Handlung nicht und begann mich zu langweilen, denn mein Vater hatte mir zuvor nicht erzählt, worum es in dieser Oper geht. Ein großer Fehler, denn ich begann während der fast zweieinhalb Stunden im Foyer herumzulaufen, irgendwann landete ich auf der Bühne und in der letzten halben Stunde im Orchestergraben. Dort sah ich meinen Vater dirigieren, der mich kurz sehr erstaunt anschaute. Meine erste Wagner-Erfahrung war also nicht sehr erhellend, aber zumindest wusste ich von da an genau, wie ein Opernhaus von innen aussieht.
Mit neun Jahren fand ich dann zu Hause die Partitur und die Schallplatte von Das Rheingold, und da ich den Titel faszinierend fand, wurde ich neugierig. Es gab auch ein Buch mit Bildern von Ul de Rico, jenem Künstler, der die Illustrationen zum Film Die unendliche Geschichte gemacht hat, in dem er die Geschichte vom Ring des Nibelungen mit Fantasy-Bildern nacherzählte. Das animierte mich, mir Rheingold anzuhören, und ich war begeistert. Mein Vater nahm in dieser Zeit die Musik zum berühmten Parsifal-Film von Hans-Jürgen Syberberg auf, worauf er sehr stolz war. Er spielte in diesem Film auch die Rolle des Amfortas, und es beeindruckte mich, ihn im Kino zu sehen. Da ich die Playbacktechnik noch nicht kannte, war ich sehr überrascht, meinen Vater singen zu hören. Die Handlung von Parsifal verstand ich natürlich nicht und langweilte mich dementsprechend, vor allem, weil immer, wenn Freunde zu uns kamen, die Szenen meines Vaters vorgespielt wurden und ich sie immer wieder anschauen musste. Bald dachte ich: »Ich hasse Parsifal.«
Mit elf Jahren war ich zum ersten Mal in Amerika. Mein Vater dirigierte in Seattle die Walküre. Dieser dreiwöchige Aufenthalt war unser Sommerurlaub. Autobahnen, Hochhäuser, McDonald’s – all das war für mich ungewohnt, aber die Proben zu Walküre schlugen bei mir augenblicklich ein.
Den Beruf meines Vaters empfand ich als sehr spielerisch, schön und natürlich. Er hatte eine sehr gute Art, mit dem Orchester zu arbeiten, und gestaltete die Proben mit Humor und Intelligenz. Man merkte, dass er gern mit anderen Musik machte. Heute weiß ich, dass er mit seiner eher antiautoritären Art seiner Zeit weit voraus war.
In der Schule war ich nur »das Kind ohne Vater«. Die Schulkollegen wussten nichts von seiner Berühmtheit, denn als Chef des Orchestre de la Suisse Romande in Genf war er ja in der französischen Schweiz und die wurde in Zürich nicht wirklich zur Kenntnis genommen. Später wurde mir klar, dass die Lehrer oder mein Chorleiter natürlich sehr wohl wussten, wer er war.
Mein Vater war ein Lebemann mit allem, was dazugehört. Er lebte sein Leben und ließ es sich gut gehen. Doch bei der Arbeit war er sehr ernsthaft und diszipliniert. Mein Vater war eine typische »Schweizer Mischung«: Er erzählte mir, dass der Name Jordan angeblich mit den Kreuzzügen zu tun gehabt habe. Die Familie wanderte dann im Zuge der Gegenreformation in Spanien als Hugenotten, also als französische Protestanten, ins damals deutschsprachige Elsass aus. Bald darauf wurde Basel die neue Heimat. Mein Vater wurde in Luzern geboren und war somit Deutschschweizer, ebenso wie sein Vater. Meine Großmutter hingegen ist Französischschweizerin, in Fribourg geboren, wo mein Vater auch studierte. Deswegen verkörperte er beide Seiten: das Deutschschweizerische, Pragmatische, Rationale, aber vor allem auch das Westschweizerische, Französische und Entspannte. Da er auch beruflich viel Zeit in Lausanne, Genf und Frankreich zubrachte, war er eher frankophil, deshalb sind auch die Vornamen von meiner Schwester Pascale und mir französisch.
Während meiner Schulzeit entwickelte ich dann neben der Musik auch einen starken Bezug zur Literatur. Mein Schulweg zum Gymnasium führte am Schauspielhaus vorbei und die Fotos in den Schaukästen machten mich neugierig. Theater war etwas, das ich von zu Hause her kaum kannte: Es gibt zwar eine Bühne, auf der wie in der Oper Geschichten erzählt werden, aber es wird nicht gesungen. Das war neu für mich. Damals war eine gute Zeit des Zürcher Schauspielhauses. Achim Benning kam damals von Wien nach Zürich und brachte viele hervorragende Schauspieler mit. Die Klassiker, die wir in der Schule lasen, schaute ich mir dann mit meinen Schulkollegen im Schauspielhaus an. Vor allem liebte ich Tschechow. Ich war als Jugendlicher eher melancholisch, daher berührten mich die Figuren von Tschechow in ihrer Vielschichtigkeit. Heute gehe ich aus Zeitgründen viel zu wenig ins Theater bzw. meistens nur, um die Arbeit eines bestimmten Regisseurs zu sehen, der für ein Opernprojekt in Frage kommt. Auch tue ich mich schwer mit Inszenierungen, bei denen ich das Stück nicht mehr wiedererkenne. In der Oper bin ich das ja mittlerweile gewohnt, schließlich habe ich ja schon viele Versionen von den meisten Opern gesehen. Aber im Schauspiel werde ich Shakespeares Sommernachtstraum vielleicht nur zweimal in meinem Leben sehen und da würde ich es lieber doch so sehen, wie es vom Autor gedacht war. Trotzdem hatte ich später sowohl in Paris als auch in Wien wunderbare Theaterabende.
Ich mochte bereits als Kind und Jugendlicher ausschließlich klassische Musik, aber meine Schwester liebte auch das Musical. Ihr Initiationserlebnis war Evita in Zürich, als die Broadway-Kompanie im Opernhaus gastierte und sie im Kinderchor mitsang. Da wir zu Hause Englisch sprachen, konnte sie sich mit den New Yorker Sängern und Tänzern gut unterhalten. Dass übrigens unsere Mutter mit uns Englisch sprach, kommt von ihrer Familiengeschichte. Sie wurde ursprünglich in Aussig an der Elbe geboren, heute heißt diese Stadt Ústí nad Labem. Sie war also Sudetendeutsche und ihre Familie musste am Ende des Krieges das Land verlassen. Sie kamen als Flüchtlinge nach Wien, wo sie in der Vorderbrühl bei Mödling untergebracht wurden. Obwohl sie buchstäblich nichts hatten, erlebte meine Mutter dort wahrscheinlich ihre glücklichsten Kindheitsjahre. Angesichts der Flüchtlingssituation heute erinnerte sie uns immer daran: »Auch wir waren Flüchtlinge.«
Ihr Vater, Friedrich Herkner, hatte an der Kunstakademie in Wien Bildhauerei studiert und kam im Rahmen eines Austauschprogramms zwischen Österreich, Nazideutschland und Irland 1938 als Professor für Bildhauerei an das College of Art in Dublin. Dann wurde er eingezogen und kämpfte im Russlandfeldzug. Es gibt viele in Russland gemalte Bilder von ihm. Da es nach dem Krieg keine Arbeit gab, kehrte er, wie mir meine Mutter erzählte, als Professor nach Dublin zurück. Bald darauf wanderte die ganze Familie nach Irland aus und nahm die irische Staatsbürgerschaft an. Meine Mutter ging in Irland in die Schule, verbrachte dort ihre späteren Kindheitsund Jugendjahre und studierte Tanz. Deswegen habe auch ich einen irischen Pass und meine Mutter sprach mit uns zu Hause immer Englisch, denn sie wollte, dass wir Kinder zweisprachig aufwachsen. Meine Eltern sprachen Hochdeutsch miteinander; niemand von uns sprach Schweizerdeutsch.
Von meiner Mutter habe ich auch ganz sicher die Disziplin. Da mein Vater kaum da war, musste sie alles alleine schaffen. Er hatte damals noch nicht die großen Gagen, man musste also auch sehen, wie man zurechtkam.
Dass ich mit sechs Jahren begann Klavier zu spielen, war eine Idee meiner Mutter. Sie drang darauf, dass ich Unterricht nahm, und sie förderte auch mein Violinspiel, als ich da meiner Schwester nacheifern wollte. Das Klavier war mir wichtig, aber ich war manchmal auch etwas faul. Gott sei Dank hörte mir meine Mutter beim Üben nur aus der Ferne zu und drängte mich nie. Zum Unterschied von meinen Kameraden musste ich damals nur zehn Minuten täglich üben.
Auf der Geige war ich begabt und bekam einen sehr guten Lehrer, den ehemaligen Konzertmeister der Zürcher Oper und des Tonhalle-Orchesters, Elemér Glanz. Ich nahm acht Jahre Geigenunterricht, erreichte in technischer Hinsicht aber nie die erforderliche Präzision. In meinem letzten Studienjahr wechselte ich zur Bratsche. Aber all diese Erfahrungen nützen mir heute natürlich bei der Orchesterarbeit.
Obwohl ich mit meiner Schwester viel gemeinsam musizierte, war sie eher dem Tanz als der Musik zugewandt. Später widmete sie sich intensiv dem Schauspiel und leitet heute sehr erfolgreich ein Kindertheater, zumal ihr die Weitergabe der Kunst an junge Menschen sehr wichtig ist.
Ab dem Alter von acht war ich sechs Jahre lang bei den Zürcher Sängerknaben, wo der Chorleiter Alphons von Aarburg großartige Arbeit leistete. Auch diese wunderbare Idee geht auf meine Mutter zurück. Eines Nachmittags brachte sie mich nach der Schule zu einer Probe, man setzte mich zum Sopran und wir erarbeiteten die Krönungsmesse von Mozart. Sofort machte es mir große Freude, mit anderen gemeinsam Musik zu machen, und ab nun hatte ich auch nicht mehr das Gefühl, allein zu sein: Jede Woche gab es mehrere Proben, vor den Konzerten auch Abendproben. Gerne erinnere ich mich an die Singlager in den Schweizer Bergen mit Stimmbildung, Filmabenden, Fußball- und Pingpongspielen und täglichen Proben. Vieles, was ich dort lernte, kann ich heute gut brauchen, vor allem aber, dass man beim Miteinander-Musizieren viel Freude haben kann, was so wichtig ist, und ebenso die Grundvoraussetzungen des Chorsingens: das gemeinsame Denken, das miteinander zu singen und zu atmen, das Intonieren und den gemeinsamen Ausdruck. Auch die Bandbreite des Repertoires war weit gefasst. In Kirchen sangen wir Musik von Palestrina und Bach bis hin zu Britten – immer wieder auch mit Orchester. Mein erstes Erlebnis in der Tonhalle Zürich war das »Bim-Bam« des Knabenchores in der Dritten Mahler. Mit diesem »Bim-Bam« begann meine Liebe zur Musik Gustav Mahlers. Dirigent war der junge Christoph Eschenbach in seinem ersten großen Chefposten. Dort zu singen, wo ich meinen Vater hatte proben sehen, war etwas ganz Besonderes. Natürlich überforderten mich die ersten drei Sätze der Mahler-Symphonie etwas, aber der letzte Satz überwältigte mich schon damals. Wir sangen auch Brittens War Requiem und Schumanns Faust-Szenen. Später durfte ich auch solo singen und ich trainierte meine Stimme. Mein Vater fand das wunderbar – ich glaube, er war sogar stolz auf mich.
Stark in Erinnerung geblieben sind mir auch die Erlebnisse mit Nikolaus Harnoncourt und Jean-Pierre Ponnelle im Rahmen der Zauberflöte im Zürcher Opernhaus. Claus Helmut Drese war damals Intendant und offenbar hatte er einmal eine schlechte Erfahrung mit den Zürcher Sängerknaben gemacht und wollte daher für die Drei Knaben die Tölzer Sängerknaben engagieren. Viele Interventionen brachten ihn dann doch dazu, eine Arbeitsprobe mit Harnoncourt und den Zürchern zu organisieren. Ich war nicht dabei, aber es muss eine Katastrophe gewesen sein. Trotzdem einigte man sich schließlich darauf, dass die Tölzer die Premiere und die erste Serie singen sollten und wir die Wiederaufnahmen. Ich erinnere mich auch an eine Abendprobe in der Oper, bei der unglaublich dicke Luft war und bei der Ponnelle ständig herumschrie. Wir mussten funktionieren und es war knallhart, sonst war man draußen. Damals lernte ich, dass Qualität mit Arbeit verbunden ist, und dass manchmal auch harte Entscheidungen getroffen werden müssen, um die Qualität einer Aufführung nicht zu gefährden. Als ich in Paris 2014 die Zauberflöte dirigierte, sollte der Kinderchor der Pariser Oper zum Einsatz kommen. Das war jedoch leider aus Qualitätsgründen unmöglich, und ich musste auf den süddeutschen Aurelius Sängerknaben bestehen. Natürlich konnte ich die Enttäuschung des Pariser Kinderchors aus meiner eigenen Erfahrung gut nachvollziehen, aber letztlich sind die Dirigenten für die Qualität einer Aufführung verantwortlich.
In Ponnelles Zauberflöte-Inszenierung durfte ich dann in späteren Vorstellungen den Ersten Knaben singen. Als ich viele Jahre später Harnoncourt wieder traf, erinnerte er sich noch daran. In der Zürcher Oper aufzutreten, war für mich als Kind natürlich etwas ganz Besonderes, und dann plötzlich auf dieser großen Bühne zu stehen, ein ganz merkwürdiges Gefühl, denn sämtliche Proben fanden ausschließlich auf der Probebühne statt. Man wurde dann einfach in ein Kostüm gesteckt und auf die Bühne geschickt. Ich wusste zwar, was ich zu tun und zu singen hatte, trotzdem war es schwindelerregend. Adrenalin schoss durch den Körper und plötzlich stand ich draußen. Auch an das ungewohnte Gefühl, das Publikum nicht zu sehen, erinnere ich mich noch. Davor hatte ich in Kirchen oder in Vortragssälen gesungen, wo man die Menschen sieht, aber an der Oper schaute ich plötzlich in ein schwarzes Loch und musste aufpassen, wenn ich mich auf der Bühne bewegte, nicht in den Graben zu fallen. Alles wahnsinnig aufregend! Ich glaube, es ging ganz gut, denn ich durfte mehrere Vorstellungen singen. Meine Mutter kannte den Tonmeister der Zürcher Oper, der ein ehemaliger Tänzer war. Er machte für sie von einer Vorstellung einen Mitschnitt. Jahre später hörte ich mir das dann auch an und bin zwar nicht unbedingt stolz darauf, aber immerhin: Mozart gut intoniert zu singen, ist bekanntlich wirklich nicht so einfach.