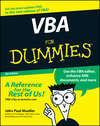Loe raamatut: «Tagebuch eines Überflüssigen»
Dorf Owetschi-Wodi, 20. März 18 . .
Der Arzt hat mich soeben verlassen. Nun bin ich aber endlich im Klaren! Wie er sich auch bemühte, es fortzuklügeln, er mußte es zuletzt doch aussprechen. Ja, ich werde bald, sehr bald sterben. Das Eis der Flüsse wird brechen, und mit dem letzten Schnee werde ich wegschwimmen – wohin? Gott weiß es! Auch ins Meer . . . Nun, was macht’s. Wenn einmal sterben, so doch am liebsten im Frühling sterben. Ist es aber nicht lächerlich, sein Tagebuch vielleicht zwei Wochen vor dem Tode zu beginnen? Uebrigens, es bleibt sich ja gleich! Und warum sollten vierzehn Tage weniger ausmachen, als vierzehn Jahre, vierzehn Jahrhunderte? Vor der Ewigkeit ist Alles Narretei, pflegt man zu sagen – ja! aber in diesem Falle wäre auch die Ewigkeit selbst – Narretei. – Doch, ich verfalle, wie es scheint, in Spekulationen: das ist ein schlechtes Zeichen. Wird mir etwa bange? – Lieber erzähle ich etwas. Draußen ist es feucht, windig – aus zugehen ist mir verboten. Was aber erzählen? Ein gesitteter Mensch spricht nicht von seinem physischen Leiden; eine Novelle oder sonst Etwas zu dichten, ist nicht meine Sache; Abhandlungen über erhabene Gegenstände zu schreiben, ist nicht für meine Kräfte; Beschreibungen aus dem mich umgebenden Leben – das könnte selbst mich nicht amüsiren. Nichts zu thun, ist aber langweilig. Zum Lesen – bin ich zu faul. Ei was! Es ist am besten, ich erzähle mir selbst meine Lebensgeschichte. Vor dem Tode ist das wohl erlaubt und am Ende auch Keinem zum Nachtheil. Ich beginne also.
Geboren wurde ich vor etwa dreißig Jahren in einer ziemlich wohlhabenden gutsherrlichen Familie. Mein Vater war ein leidenschaftlicher Spieler, meine Mutter eine Dame von Charakter – überhaupt eine sehr tugendhafte Frau. Aber ich konnte an keiner Frau eine Tugendhaftigkeit nachweisen, die noch weniger Freudigkeit gedeihen ließe, als die meiner Mutter. Sie ertrug kaum die Last ihrer Tugenden und quälte Alle, sich selbst am meisten. Während der fünfzig Jahre ihres Lebens hat sie sich kein einziges Mal überwunden, die Hände in den Schoß zu legen; sie war immer in Bewegung und wirthschaftete wie eine Ameise – aber ohne jeden Nutzen, was man von einer Ameise nicht grade sagen kann. Ein unruhiger Wurm nagte Tag und Nacht in ihr. Nur ein einziges Mal habe ich sie vollkommen ruhig gesehen: am ersten Tage nach ihrem Tode – im Sarge. Als ich sie betrachtete, schien es mir wahrlich, als ob ihr Gesicht eine schweigende Verwunderung ausdrücke. Es schien, als sprachen von den halbgeöffneten Lippen, den eingesunkenen Wangen und aus den sanften, unbeweglichen Augen die Worte: »Wie schön ist es, sich nicht zu rühren! Ja, schön – es ist schön, sich endlich frei zu machen von dem drückenden Bewußtsein des Lebens, von dem aufdringlichen und unruhigen Gefühle des Daseins! – Ader darum handelt es sich hier nicht.
Ich wuchs kümmerlich und ohne Heiterkeit heran. Der Vater und die Mutter liebten mich beide ; aber dadurch ist mir das Leben nicht leichter gewesen. Der Vater, als ein Mann, der sich offen einer schändlichen und ruinirenden Leidenschaft ergab, hatte in seinem Hause nicht die mindeste Macht. Er war sich seiner Gesunkenheit bewußt, und da er keine Kraft besaß, von dem geliebten Laster abzustehen, so suchte er wenigstens durch zustimmende Demuth und durch eine freundliche und bescheidene Miene die Nachsicht seiner musterhaften Gattin zu verdienen. Meine Mutter ertrug in Wirklichkeit ihr Unglück mit der kalten, würdevollen Langmuth, in der sich so viel Stolz und Egoismus verbirgt. Sie warf meinem Vater nie etwas vor; schweigend pflegte sie ihm ihr letztes Geld zu geben und seine Schulden zu bezahlen. Er lobte und pries sie in ihrer Gegenwart, wie in ihrer Abwesenheit; doch liebte er nicht zu Hause zu sein und küßte mich nur verstohlener Weise, als ob er sich fürchtete, mich mit seiner Gegenwart zu verpesten. Seine einstellten Züge athmeten alsdann eine solche Güte, das fieberhafte Zucken seiner Lippen verwandelte sich in ein so rührendes Lächeln, seine braunen von feinen Runzeln umgebenen Augen leuchteten in einer solchen Liebe, daß ich unwillkürlich meine Wange an die seine schmiegte, welche feucht und warm war von Thränen. Ich wischte ihm mit meinem Tuche die Thränen ab, und sie flossen von Neuem, ohne Anstrengung, wie Wasser aus einem übervollen Glase. Ich pflegte selbe in Weinen auszubrechen, und er tröstete mich, streichelte mich mit seiner Hand über den Rücken und küßte mir mit seinen zuckenden Lippen das ganze Gesicht. Wenn ich an meinen Vater denke, so schnüren mir sogar jetzt noch, mehr als zwanzig Jahre nach seinem Ableben, die ungeweinten Thränen die Gurgel zusammen, und das Herz schlägt, schlägt so heiß und bitter und quält sich in einem so beklemmenden Mitleiden, als ob ihm noch lange beschieden wäre zu schlagen, und als ob ihm wirklich noch ein Gegenstand zum Bedauern vorhanden wäre.
Meine Mutter im Gegentheil behandelte mich immer gleich freundlich, alles gleich – kalt. In den Kinderbüchern kommen oft solche Mütter vor, moralisirende und gerechte. Sie liebte mich, ich aber liebte sie nicht. Ja, ich scheute mich vor meiner tugendhaften Mutter und liebte leidenschaftlich meinen lasterhaften Vater.
Für den heutigen Tag ist es jedoch genug. der Anfang ist da, und um das Ende, wie es auch ausfallen möge, habe ich mich nicht zu bekümmern. Das hängt von meiner Krankheit ab.
21. März.
Heute ist ein merkwürdiges Wetter. Warm, klar. Die Sonne spielt lebhaft auf dem schmelzenden Schnee. Alles glänzt, dampft, tröpfelt. Die Sperlinge schreien wie Verrückte um die dunkeln Zäune umher. Die feuchte Luft reizt süß und unwiderstehlich meine Brust. Der Frühling – der Frühling kommt! Ich sitze am Fenster und schaue über das Feld hinaus. O Natur, Natur! Ich habe dich so lieb, und doch ging ich aus deinem Schoße hervor, untauglich für das Leben. Da hüpft ein Sperling mit ausgebreiteten Flügeln; er schreit, und jeder Ton seiner Stimme, und jedes zerzauste Federchen an seinem kleinen Körper athmet Gesundheit und Kraft.
Was folgt aus Alledem? – Nichts. Er ist gesund und hat das Recht zu schreien und rauflustig zu sein. Und ich – ich bin krank und muß sterben – das ist Alles. Mehr hiervon zu sprechen verlohnt sich nicht. Das weinerliche Appelliren an die Natur erscheint lächerlich bis in’s Komische – kehren wir zur Erzählung zurück.
Ich wuchs, wie schon gesagt, sehr kümmerlich und trübe heran. Geschwister besaß ich nicht. Erzogen wurde ich zu Hause. Was hätte denn sonst meine Mutter zu thun gehabt, wenn man mich in eine Pension oder eine Kroneanstalt abgegeben hätte? Dazu sind ja eben die Kinder da, daß die Eltern sich nicht langweilen – Wir lebten größtentheils im Dorfe; manchmal gingen wir nach Moskau. Ich hatte Hofmeister und Lehrer, wie es die Sitte erforderte. Besonders blieb mir ein kränklicher und sentimentaler Deutscher, Nickmann, in Erinnerung, ein überaus trauriger und vom Schicksale getroffener Mensch, der in einer vergeblichen, drückenden Sehnsucht nach seiner fernen Heimath brannte. Gewöhnlich am Ofen, inmitten der drückenden Schwüle des engen Vorzimmers, welches durch und durch vom saueren Geruch des gegorenen Kwaß1 getränkt war, da sitzt mein unrasirter, verwachsener Diener Wassily, mit dem Zunamen: die Muttergans, in seinem unverwüstlichen Halbrock aus grobem Gewebe – er sitzt und spielt Karten mit dem Kutscher Potap, der seinen neuen schaumweißen Schafpelz und seine unzerstörbaren Schmierstiefel zum ersten Male anhat – und Nickmann singt hinter dem Verschlage:
Herz, mein Herz, warum so traurig?
Was bekümmert dich so sehr?
’s ist ja schön im fremden Lande —
Herz, mein Herz, was willst du mehr? . . .
Nach dem Ableben meines Vaters siedelten wir ganz nach Moskau über. Ich zählte damals zwölf Jahre. Mein Vater starb des Nachts an einem Schlaganfall. Ich werde diese Nacht nicht vergessen. Ich schlief fest, wie Kinder gewöhnlich schlafen; aber ich erinnere mich, daß es mir sogar im Schlafe schien, als vernehme ich ein schweres und gleichmäßiges Schnarchen. Plötzlich spüre ich, daß mich Jemand an die Schulter faßt und rüttelt. Ich öffne die Augen: vor mir steht mein Diener. »Was ist los?« – »Kommen Sie nur, kommen Sie! Alexej Michajlowitsch liegt im Sterben.« Wie ein Wahnsinniger springe ich aus dem Bett – nach seinem Schlafzimmer – ich sehe . . . der Vater liegt da mit zurückgeworfenem Haupte, das Gesicht blutroth und athmet mit der größten Anstrengung. In die Thür drängen sich Leute mit erschrockenen Gesichtern. Im Vorzimmer fragt eine heisere Stimme: »Hat man nach dem Arzt geschickt?« Im Hofe wird das Pferd aus dem Stalle gezogen; das Thor knarrt – ein Talglicht brennt im Zimmer am Boden. Die Mutter, die auch anwesend ist, ergiebt sich dem Schmerze, ohne jedoch dabei den Anstand und das Bewußtsein ihrer Würde zu verlieren. Ich warf mich dem Vater an die Brust, umarmte ihn und stammelte: »Papa! Papa!« . . . Er lag unbeweglich und blinzelte eigenthümlich. Ich sah ihm in’s Gesicht – ein unerträgliches Grauen preßte meinen Athem zusammen. Ich schrie auf vor Schreck, wie ein rauh angepackter Vogel – man schleppte mich von ihm und führte mich weg. – Noch am Tage zuvor – als ob er seinen nahen Tod geahnt hätte – hatte er mich heiß und schwermuthsvoll geliebkost. – Man brachte einen verschlafenen und widerstrebenden Arzt, der stark nach Liebstöckelgeist koch. Mein Vater starb unter seiner Lanzette, und am andern Tage stand ich, vollständig stupid vor Gram, mit einer Kerze in der Hand vor dem Tische, auf welchem der Verblichene lag, und hörte sinnlos den dumpfen Gesang des Diakonus an, den von Zeit zu Zeit die schwache Stimme des Geistlichen unterbrach. Die Thränen hätten nicht auf über meine Wangen, über meine Lippen, den Kragen und das Vorhemd zu rieseln. Ich zerfloß in Weinen und schaute unverwandt und starr auf das unbewegliche Antlitz des Vaters, als ob ich von ihm Etwas erwartete. Meine Mutter machte inzwischen langsam ihre tiefen Kniebeugungen, erhob sich jedesmal wieder langsam und berührte, sich bekreuzend, mit Nachdruck Stirn, Schulter und Brust. In meinem Hirn lebte kein einziger Gedanke; ich war ganz in Lethargie verfallen, fühlte aber doch, daß in mir etwas Schreckliches vorging: der Tod blickte mir damals in’s Gesicht und zeichnete mich.
Wir siedelten also nach dem Ableben meines Vaters bald nach Moskau über, und zwar aus einem sehr einfachen Grunde. Unser Gut kam unter den Hammer und wurde vollständig verkauft, mit Ausnahme eines kleinen Dörfchens – dasselbe, in welchem ich eben jetzt die letzten Tage meines großartigen Daseins ablebe. Ich gestehe, daß ich trotz meines jugendlichen Alters den Verkauf unseres Restes sehr bedauerte – richtiger, es war mir blos um unsern Garten leid. An diesen Garten sind fast einzig meine lichten Erinnerungen geknüpft. Dort begrub ich an einem ruhigen Frühlingsabende meinen besten Freund, einen alten Hund mit abgestuztem Schwanze und krummen Pfoten – Trix hieß er. Dort pflegte ich, im hohen Grase verborgen, die geraubten Aepfel, rothe, süße Nowgorodische, zu verzehren. Dort endlich erblickte ich zum ersten Male zwischen den Sträuchern reifer Himbeeren das Stubenmädchen Klawdia, die trotz ihrer Stutznase und der Gewohnheit, in ihr Kopftuch hinein zu lachen, in mir eine so zärtliche Leidenschaft erweckte, daß ich in ihrer Gegenwart, kaum athmend, zu erstarren pflegte und verstummte, und einst, an einem Ostersonntage, als an sie die Reihe kam, mein Herrenhändchen zu küssen. auf dem Punkte war, auf ihre ausgetretenen bockledernen Schuhe – einen Kuß zu drücken. Du lieber Gott! Sind denn seitdem wirklich nur zwanzig Jahre verstrichen? Wie lange ist es denn her, daß ich auf meinem braunen, zottigen Pferdchen um den alten Zaun unseres Gartens herumritt und, in den Steigbügeln mich emporhebend, die doppelfarbigen Pappelblätter abriß? – Der Knabe, selbst der Jüngling fühlt nicht, daß er lebt: gleich einem Tone wird sein eigenes Leben dem Menschen nicht sogleich wahrnehmbar.
O mein Garten – o ihr überwachsenen Wege um den flachen Teich! O du sandiges Plätzchen unter dem baufälligen Damme, wo ich so oft Grundlinge und Schmerlen fischte! Und ihr, ihr hohen Birken mit den langen, herabhängenden Zweigen, wo von der Landstraße her das traurige Lied des Bauern sich vernehmen ließ, holperich unterbrochen durch die Stöße seines Fuhrwerks – ich sende euch Allen mein letztes Lebewohl! . . . Indem ich vom Leben scheide, strecke ich nur zu euch allein meine Arme aus. Ich möchte mich noch einmal satt athmen an der bitteren Frische des Wermuths, an dem süßen Duft des abgemähten Buchweizens auf den Feldern meiner Heimat. Ich möchte noch einmal aus der Ferne den bescheidenen gedehnten Klang der gesprungenen Glocke unserer Pfarrkirche hören; noch einmal eine Zeit lang im kühlen Schatten weilen, unter dem Eichenbusche, am Abhange der bekannten Schlucht; noch einmal mit den Augen begleiten die bewegte Spur des Windes, der mit dunklem Strome längs des goldglänzenden Grases unserer Wiese dahinläuft . . . Ach! wozu das Alles? – Doch ich kann heute nicht mehr weiter. – Morgen!
22. März.
Heute ist es wieder kalt und trübe. So ein Wetter ist für mich viel passender. Es entspricht vollkommen meiner Arbeit. Der gestrige Tag hat in mit zur unrechten Zeit manche unnützen Gefühle und Erinnerungen wachgerufen. Das soll sich nicht mehr wiederholen. Gefühlsergüsse sind gleich der Wurzel des Farnkrautes; man saugt sie anfangs gerne, und es scheint, als ob sie gar nicht schlecht schmecke; später aber wird sie unangenehm im Munde. Ich will lieber einfach und gelassen meine Lebensgeschichte erzählen.
Wir siedelten also nach Moskau . . .
Es fällt mir eben wieder ein, ob es wirklich der Mühe wert sei, von meinem Leben zu erzählen?
Nein, entschieden – es verlohnt sich nicht . . . Mein Leben zeichnete sich in keiner Weise von dem vieler anderen Menschen aus. Das elterliche Haus, die Universität der Dienst in untergeordneten Aemtern, der Austritt aus dem Dienste – ein kleiner Zirkel von Bekannten, eine saubere Armuth, bescheidene Wünsche – sagen Sie gütigst: Wem ist dies Alles nicht schon bekannt! Und deshalb werde ich meine Lebensgeschichte lieber nicht erzählen, um so mehr, da ich zu meinem eigenen Vergnügen schreibe. Und wenn ich selbst in meiner Vergangenheit weder etwas besonders Heiteres, noch etwas besonders Trauriges fände, so muß auch in Wahrheit Nichts in ihr vorhanden sein, was der Aufmerksamkeit werth wäre. Ich will lieber versuchen, mir meinen Charakter darzulegen.
Was bin ich für ein Mensch? . . . Man könnte mir bemerken, daß ich auch danach nicht befragt werde – nun gut! Aber ich stehe ja vor dem Tode – unbedingt muß ich bald sterben – und vor dem Tode ist wahrlich, wie mir scheint, der Wunsch verzeihlich, zu erfahren: was bin ich denn für ein Mensch gewesen?
Nachdem ich gehörig über diese Frage nachgedacht, und da ich im Uebrigen nicht nöthig habe, mich zu bitter über meine Person zu äußern, – wie es solche Leute zu thun pflegen, die zu sehr von ihren guten Eigenschaften überzeugt sind – so muß ich, ohne daß es mir schwer fiele, das Eine bekennen: daß ich ein durchaus überflüssiger Mensch in dieser Welt gewesen bin – oder anders gesagt – ein vollkommen überflüssiger Vogel. Und dies beabsichtige ich morgen zu beweisen; denn heute huste ich wie ein krankes Schaf, und meine Nianjuschka,2 Terentjewna, läßt mir keine Ruhe: »Gehen Sie doch zu Bette, mein Väterchen, und nehmen Sie etwas Thee zu sich!« . . . Ich weiß schon, weshalb sie mich quält: sie mochte selbst Thee trinken. Nun, mir ist’s recht! Weshalb denn einer alten Frau versagen, in den letzten Augenblicken ihres Herrn noch so viel als möglich Nutzen von ihm zu ziehen? . . . Vorläufig ist die Zeit noch nicht um.
23. März.
Wiederum Winter! Der Schnee fällt in dichten Flocken. – Ein Ueberflüssiger, ja – ein Ueberflüssiger . . . Ein ausgezeichnetes Wort habe ich da gefunden. Je tiefer ich in mich eindringe, je aufmerksamer ich meine ganze Vergangenheit betrachte, desto mehr überzeuge ich mich von der strengen Wahrheit dieses Ausdruckes. Ein Ueberflüssiger – ja, so ist es. Für andere Menschen als für mich könnte dieses Wort nicht gebraucht werden. Es giebt allerdings mancherlei Menschen, schlechte und gute, kluge und dumme, angenehme und unangenehme – aber Ueberflüssige . . . nein, die giebt es nicht. Daß heißt – ich möchte recht verstanden werden – auch ohne jene Menschen könnte ja das Weltall bestehen . . . das ist schon wahr; aber Ueberflüssigkeit ist doch nicht ihre Haupteigenschaft, nicht das sie auszeichnende Merkmal. Und wenn sie sich über solche Menschen äußern, so kommt ihnen gerade das Wort »Ueberflüssig« nicht zuerst auf die Zunge. Aber ich – von mir kann man sonst nichts Anderes aussagen: ein Ueberflüssiger – und damit abgemacht. Ein außeretatsmäßiger Mensch – das ist Alles. Auf mein Erscheinen hat die Natur, wie mich dünkt, nicht gerechnet, und deshalb hat sie mich auch wie einen unerwarteten, ungerufenen Gast behandelt. Nicht umsonst sagte von mit ein Spaßvogel, ein großer Liebhaber vom Préférence-Spiel, daß meine Mutter, indem sie mich geboren, labet geworden. Ich spreche jetzt von mir in aller Ruhe, ohne Galle . . . Es gilt ja die Vergangenheit! Während der ganzen Dauer meines Lebens habe ich immer meinen Platz besetzt gefunden – vielleicht eben deshalb, weil ich diesen Platz nicht dort gesucht, wo ich ihn hätte suchen sollen. Ich war zweifelsüchtig, schüchtern, empfindlich, wie überhaupt alle kranken Menschen. Dabei – und dies wahrscheinlich in Folge übermäßiger Eigenliebe, oder überhaupt in Folge der Fehlgeschlagenheit meiner Person – lag zwischen meinen Gefühlen und Gedanken und dem Ausdruck dieser Gefühle ein so zu sagen unsinniges, unerklärliches und unüberwindliches Hinderniß; und wenn ich mich je entschloß, mit Gewalt dieses Hinderniß zu bekämpfen, diese Schranke zu durchbrechen, so gewannen meine Geberden, der Ausdruck meines Geistes und mein ganzes Wesen das Aussehen einer qualvollen Spannung; nicht nur schien ich alsdann – nein! ich war in Wirklichkeit unnatürlich und gezwungen. Ich fühlte das selbst, und schnell bemühte ich mich, wieder in mich selbst zurückzukehren. Dann Pflegte sich in meinem Innern eine schreckliche Aufregung zu erheben. Ich analysirte mich selbst haarklein, stellte über mich die subitilsten Betrachtungen an, verglich mich mit Anderen, brachte mir die verschiedensten Blicke, das Lächeln, die Worte der Menschen, in deren Gegenwart ich mir hatte Luft machen wollen, in Erinnerung, deutete Alles von der schlechten Seite, lachte sarkastisch über meine Anmaßung: »zu sein, wie Alle sind«, und plötzlich mitten im Lachen, ließ ich den Muth sinken; ich verfiel in eine thörichte Niedergeschlagenheit – und dann ging das Alte von neuem los – mit einem Worte; ich drehte mich, wie ein Eichhörnchen im Rade. Ganze Tage pflegten in dieser peinlichen, unfruchtbaren Arbeit zu vergehen. Nach Alledem – sagen Sie gütigst – sagen Sie selbst: für Wen und wozu bedarf es eines solchen Menschen? Weshalb wickelte sich dies Alles in mir ab, welcher Grund war vorhanden für dieses grübelnde Umtreiben mit mir selbst? Wer wüßte es? Wer könnte es sagen!
Ich erinnere mich – eines Tags fuhr ich aus der Stadt – aus Moskau – in der Diligence. War der Weg schon gut, so spannte der Fuhrmann neben den vier Pferden noch ein fünftes an. So ein unglückliches fünftes Pferd, so ein unnützes Pferd, das schlechterdings mit einem kurzen, dicken Stricke angebunden wird, welcher unbarmherzig in seinen Schenkel einschneidet, den Schwanz reibt, es in der allerunnatürlichsten Art zu laufen nöthigt und seinem Körper fast die Form eines Kommas verleiht – erweckt in mir immer das tiefste Mitleiden. Ich bemerkte dem Fuhrmann, daß man, nach meiner Ansicht, das fünfte Pferd ganz entbehren könnte. Er schwieg ein wenig, zuckte mit den Schultern, versetzte dem Pferde einige Peitschenhiebe über den magern Rücken und den aufgedunsenen Leib – und sagte schmunzelnd: »Hm! Auch wirklich komisch, wie es sich noch dazu geschleppt hat! Weiß der Teufel!« . . . Und auch ich habe mich noch dazu geschleppt . . , Ja, so ist’s; die Station war übrigens nicht weit gelegen.
Ein ueberflüssiger . . . Ich versprach, die Richtigkeit meiner Meinung zu beweisen, und ich werde mein Versprechen erfüllen. Ich erachte es für unnütz, tausenderlei Kleinigkeiten, alltägliche Ereignisse und Begebenheiten zu erwähnen, welche übrigens in den Augen eines jeden richtig denkenden Menschen als unwiderlegbare Beweise zu meinen Gunsten, das heißt, zu Gunsten meiner Ansicht, dienen könnten. Ich beginne lieber sogleich mit einem sehr wichtigen Falle, nach dessen Kenntniß wahrscheinlich schon kein Zweifel mehr zurückbleiben wird in Bezug auf die Begründung des Wortes: »Ueberflüssig«. Ich wiederhole: ich habe nicht die Absicht, in unbedeutende Dinge einzugehen. Aber ich kann nicht umhin, eines vielleicht doch interessanten und bemerkenswerthen Umstandes zu gedenken, nämlich des eigenthümlichen Benehmens meiner Freunde (ich habe auch Freunde gehabt), das sie jedesmal an den Tag legten, wenn ich ihnen begegnete oder sie besuchte. Es war, als ob sie sich alsdann unheimlich fühlten: sie lächelten ganz unnatürlich, sie schauten mir nicht in die Augen oder auf die Füße, wie es doch so Mancher zu thun pflegt, sondern sie sahen aus meine Wangen, drückten mir hastig die Hand, sagten dabei in Eile: »Ah, guten Morgen, Tschulkaturin!« (das Schicksal beschenkte mich nämlich mit diesem Namen), oder: »Ah, da ist ja Tschulkaturin!« – entfernten sich sofort wieder und verblieben manchmal nachher einige Zeit ohne Bewegung, als ob sie sich anstrengten, irgend Etwas in der Erinnerung aufzufrischen. Ich bemerkte dies Alles; denn es fehlt mir nicht an Scharfsinn und an der Fähigkeit, Beobachtungen anzustellen. Ich bin überhaupt nicht dumm: es kommen mir dann und wann manche eigenthümliche Gedanken in den Sinn – nicht ganz gewöhnliche. Da ich aber ein überflüssiger Mensch bin, und vor meinem Innern ein Schlößchen hängt, so wird mir bange, meine Gedanken auszusprechen, um so mehr, da ich im Voraus weiß, daß ich dieselben sehr schlecht ausdrücken würde. Manchmal erscheint es mir sogar seltsam, daß Menschen überhaupt reden, und so einfach, so frei . . . Welche Gewandtheit! – denke ich mir dann. Das heißt, um die Wahrheit zu sagen, auch mit mir ereignete es sich oftmals, daß trotz des Schlößchens meine Zunge den Kitzel bekam. Aber in Wirklichkeit brachte ich nur in meiner Jugend Worte hervor; dafür gelang es mir jedoch in den reiferen Jahren immer, mich zu bezähmen. Ich pflegte mir im Falle der Versuchung halblaut vorzusagen: »Nun, wir wollen lieber ein wenig schweigen« – und ich beruhigte mich alsdann – Zum Schweigen haben wir Alle Lust. Besonders zeichnen sich hierin unsere Frauen aus: manches hohe russische Fräulein schweigt oft mit solcher Energie, daß dabei sogar ein geübterer Mensch in leichtes Fieber und kalten Schweiß gerathen kann. Doch – es handelt sich hier um etwas Anderes, und ich bin am allerwenigsten berufen, Andere zu kritisiren. – Ich schreite zur versprochenen Erzählung. Vor einigen Jahren ereignete es sich durch ein Zusammentreffen von an sich zwar unbedeutenden, für mich aber verhängnißvollen Umständen, daß ich etwa sechs Monate in der Kreisstadt O . . . zubringen mußte.
Diese Stadt ist sehr unbequem an einem Abhange gelegen und zählt etwa achthundert Einwohner. Die Armuth ist hier zu Hause, alle Häuschen sehen bis zur Unbeschreiblichkeit elend aus. Auf der Hauptstraße lagen an manchen Stellen, als wollten sie Einem an ein Pflaster glauben machen, weibliche, häßliche Platten von unbehauenem Kalkstein – ein Grund, weshalb Lastwagen dieselbe gewöhnlich vermieden. Grade in der Mitte eines zum Erstaunen schmutzigen freien Platzes erhebt sich ein kleines, gelblich angestrichener Bau mit dunkeln Löchern, und in diesen Löchern sitzen Menschen in großen Mützen und machen eine Miene, als ob sie sich mit Handelsgeschäften abgaben. Auf demselben Platze ist eine ungewöhnlich hohe, bunte Stange aufgepflanzt; neben der Stange ist, der Ordnung halber, auf Befehl der Behörde ein Wagen mit fahlem Heu angefahren, und dabei schreitet ein der Krone angehöriges Huhn umher. Mit einem Worte, in der Stadt O . . . ist der Aufenthalt ergötzlich. In den ersten Tagen fürchtete ich vor Langeweile um den Verstand zu kommen. Ich muß gestehen, daß, wenn ich auch ein überflüssiger Mensch bin, ich nichtsdestoweniger alles Krankhafte nicht auszustehen vermag . . . Ich hatte ja auch dem Glücke nicht abgeschworen, und habe mich bemüht, es von rechts und von links anzupacken – und deshalb ist es wohl nicht zu verwundern, daß auch ich mich langweilen kann, wie andere Sterbliche. – Ich hielt mich in O . , . in Dienstangelegenheiten auf . . .
Aber Terentjewna scheint sich unbedingt vorgenommen zu haben, mich zu Tode zu quälen. Hier eine Probe unserer Unterhaltung.
Terentjewna. – Ei, ei, mein Väterchen! Was schreiben Sie denn da in einem fort? Es ist nicht gesund, gar nicht gesund für Sie zu schreiben.
Ich. – Aber ich vergehe vor Langeweile Terentjewna!
Sie. – Nehmen Sie nur etwas Thee zu sich, und gehen Sie dann zu Bett! Sie werden mit Gottes Hilfe schwitzen und dabei ein wenig schlafen.
Ich. – Ich will nicht schlafen.
Sie. – Aber Väterchen, wo denken Sie denn hin? Gott sei mit Ihnen! Gehen Sie zu Bett, gehen Sie ja nur schlafen: es ist für Sie besser.
Ich. – Ich werde ja ohnedies sterben, Terentjewna!
Sie. – Der Himmel soll uns behüten und bewahren! . . . Nun! Befehlen Sie den Thee aufzutragen ?
Ich. – Ich halte kaum noch eine Woche aus, Terentjewna!
Sie. – Ei, ei, Väterchen! Was schwatzen Sie da? . . . Also ich werde den Samowar aufsetzen . . .
O Du hinfälliges, gelbes, zahnloses Geschöpf! Bin ich auch für Dich schon kein Mensch mehr!