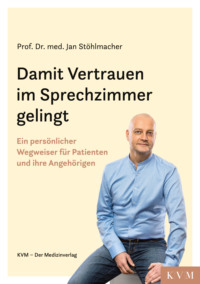Loe raamatut: «Damit Vertrauen im Sprechzimmer gelingt»
Prof. Dr. med. Jan Stöhlmacher
Damit Vertrauen im Sprechzimmer gelingt
Ein persönlicher Wegweiser für Patienten und ihre Angehörigen
K|V|M
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im
Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Anschrift des Verlags:
KVM – Der Medizinverlag, Dr. Kolster Verlags-GmbH
Ifenpfad 2–4, 12107 Berlin
Korrespondenz:
Wichtige Hinweise:
Das Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die
Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
© KVM – Der Medizinverlag Dr. Kolster Verlags-GmbH, ein Unternehmen der Quintessenz-Verlagsgruppe
1. Auflage 2022
Projektleitung: Swantje Steinbrink, Berlin
Lektorat: Christian Weller, Berlin
Layout und Satz: Jana Gontscharuk, Berlin
Gesamtproduktion: KVM – Der Medizinverlag, Berlin
Druck: Druckhaus Sportflieger, Berlin
ISBN: 978-3-86867-603-7
Printed in Germany
Für Ralf und Frank
INHALT
»Das wird schon wieder«
Einleitung
KAPITEL 1
»Der Doktor macht das schon«
Ihre Beschwerden und der erste Arzttermin
KAPITEL 2
»Das habe ich mir aber anders vorgestellt«
Was Patienten und Ärzte voneinander erwarten
KAPITEL 3
»Die können nicht verständlich formulieren«
Über das Zuhören, Beobachten und Sprechen
KAPITEL 4
»Die Herausforderung annehmen«
Wie Sie die Zeit nach der Diagnose meistern
KAPITEL 5
»In rosa Watte gepackt zu werden wäre schön«
Hilfe durch die Angehörigen
KAPITEL 6
»Angst ist ein gefährliches Gift«
Über den richtigen Umgang mit schlechten Nachrichten
KAPITEL 7
»Ein Nachmittag mit Folgen«
Angehörige können eine Herausforderung sein
KAPITEL 8
»Die letzte Chance«
Pro und Contra einer Studienteilnahme
KAPITEL 9
»Das wird hier nichts mehr«
Wann Sie an einen Arztwechsel denken sollten
KAPITEL 10
»Kann ich doch alles selbst nachschauen«
Hilfen und Grenzen des Internets
KAPITEL 11
»So könnte es gut gehen«
Das Fazit der Protagonisten
VERWENDETE QUELLEN
WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN
»Das wird schon wieder«
Einleitung
Frank, ein sportlicher junger Mann, war nur noch ein Schatten seiner selbst, so zusammengesunken, wie er auf seinem Stuhl saß. Sein vertrauter Humor hatte sich restlos verflüchtigt. Wie oft hatte ich in der Vergangenheit bei ihm Rat gesucht. Immer wieder hatte er mich überzeugt, dass die Dinge nicht so schlimm seien, wie sie zunächst schienen, dass sich letztlich alles zum Guten wenden würde. Sein Optimismus war ansteckend. Doch jetzt war sein banger Blick auf mich gerichtet, seinen kleinen Bruder. Was war passiert?
Zu dritt saßen wir in dem engen, schmucklosen Sprechzimmer seiner Urologin, dessen kleine Fenster den Straßenlärm nur unzureichend aussperrten. „Die Ergebnisse der Untersuchungen zeigen nichts Gutes, ganz so, wie ich es erwartet hatte“, sagte sie. „Wir müssen schnell mit einer Therapie beginnen, damit Sie die kommenden Monate und Jahre noch vernünftig leben können. Es gibt heute einige gut verträgliche Medikamente. Ich würde Ihnen nun gern die Einzelheiten der Therapie erläutern. Haben Sie im Moment schon Fragen?“
Mein Bruder antwortete der forschen Ärztin nicht. Er hatte in diesem Moment erfahren, dass er an einem bösartigen Tumor der Prostata litt, der bereits gestreut hatte. Eine Heilung war ausgeschlossen. Da Frank nicht in der Lage schien, etwas zu sagen, antwortete ich. „Dies sind keine guten Neuigkeiten“, entgegnete ich ihr. „Wir möchten das erst einmal in Ruhe miteinander besprechen.“ Ich bat um einen kurzfristigen Folgetermin, um die mit Sicherheit aufkommenden Fragen und Details einer möglichen Therapie zu erörtern. Sie willigte ein. „Das wird schon wieder“, sagte sie beim Hinausgehen zu meinem Bruder, der noch immer kein Wort von sich gegeben hatte.
Ich hielt es für richtig, das Arztgespräch zu beenden. Frank schien mit den Neuigkeiten vollkommen überfordert zu sein. Erklärungen und Erläuterungen zu einer möglichen Therapie wären bei ihm wohl gar nicht angekommen. Nach der Mitteilung der Diagnose war er schlicht nicht in der Lage, irgendetwas mit der Ärztin zu besprechen. Später hat er mir erzählt, er sei froh darüber gewesen, dass ich mich in das Gespräch eingeschaltet habe.
Als Angehöriger bin ich selten im Sprechzimmer eines Arztes gewesen. Meist habe ich selbst als Behandelnder auf der anderen Seite des Schreibtisches gesessen. Diese Situation, an der Seite meines schwer erkrankten Bruders, war für mich neu – und sie war viel schwieriger, als ich vermutet hatte. Zwar verfüge ich als Facharzt für Krebserkrankungen über das Wissen, um meinem Bruder seine Diagnose und Therapiemöglichkeiten zu erklären. Doch als Angehöriger war ich unsicher. Was will mein Bruder? Was ist ihm jetzt wichtig? Welche Erwartungen hat er an mich? Wie kann ich ihm konkret helfen?
Von der eigentlichen Diagnose wurde ich nicht wirklich überrascht. Frank hatte im Vorfeld mehrere Symptome beschrieben, die aus meiner Sicht auf ein ernstes Erkrankungsgeschehen hindeuteten. Trotzdem fühlte ich mich im ersten Moment überwältigt und auch hilflos. Im Nachhinein habe ich mir gesagt: Das ist normal. In einer solch schwierigen Situation, die keiner planen kann, ist es in Ordnung, sich zunächst zu orientieren und nicht sofort zu wissen, was genau zu tun ist. In der Position des begleitenden Bruders zu sein erschien mir viel schwieriger als in der mir vertrauten Rolle des behandelnden Arztes.
An der Seite meines kranken Bruders ist mir auf eine sehr persönliche Art bewusst geworden, dass das Mitteilen einer Diagnose, die das Leben so einschneidend verändert, eine gehörige Portion Empathie und Einfühlungsvermögen von ärztlicher Seite erfordert. Jedenfalls mehr, als er und ich gemeinsam erlebt hatten. In einer solchen Situation kommt jedoch auch den Angehörigen eine wichtige Rolle zu. Sie können einen wesentlichen Anteil daran haben, die Begegnung des Patienten mit dem Arzt zufriedenstellend und gut zu gestalten.
Aus mehr oder weniger heiterem Himmel erfährt man, dass man ein schwer kranker Mensch ist. Dabei muss es sich nicht immer um eine Krebsdiagnose handeln. Eine langsam voranschreitende rheumatische Erkrankung oder ein schwerer Schlaganfall sind nur einige andere Beispiele. Auch ein viel zu früh geborenes Kind verändert das Leben von Grund auf. Eine Flut an Gedanken, Gefühlen und Fragen ist die unausweichliche Folge. Plötzlich dreht sich anscheinend alles nur noch um die eigene Gesundheit. Je mehr man versucht, wieder Ordnung in das Chaos an Gefühlen und Gedanken zu bringen, desto mehr wird einem bewusst, dass es nicht nur die Sorge um den eigenen Körper ist, die einen schlecht schlafen und nicht zur Ruhe kommen lässt. Wie sage ich es der Familie, wird diese Verbindung halten oder stehe ich plötzlich alleine da? Wie lange kann ich noch arbeiten? Was wird nun aus den eigenen Träumen, den gemeinsamen Plänen? Was ist nun wirklich wichtig? In dieser Achterbahnfahrt wird einem bewusst, wie selbstverständlich man sein ganzes Leben auf einer guten Gesundheit aufgebaut hat. Und nun steht die Welt auf dem Kopf. Nichts ist mehr wie zuvor. So sieht es zumindest zunächst aus.
Fragen, Bedürfnisse und Wünsche bezüglich einer guten Begegnung im Sprechzimmer stehen im Mittelpunkt des Buches.
Prof. Dr. med. Jan Stöhlmacher

Eine echte Lebenskrise lässt sich nicht einfach durch gute Gespräche oder Gedanken in den Griff bekommen. Es beginnt ein Prozess, an dem viele Menschen beteiligt sind und der nur gelingt, wenn alle – Patientin oder Patient, Ärztin oder Arzt und Angehörige – emotional und sachlich ihr Bestes geben. Dabei hat jeder seine eigene Rolle. Nach einer einschneidenden Diagnose muss jede und jeder nach den eigenen Maßstäben entscheiden, wie es weitergehen soll. Der Lebensentwurf muss überdacht, Dinge müssen neu geordnet werden. Das betrifft auch die Angehörigen. Deren Unterstützung ist in dieser Situation enorm wichtig und vielschichtig. Sie können den Patienten zur Seite stehen und in Gesprächen vermitteln, ähnlich wie ich es bei meinem Bruder getan habe. Bei den vielen Entscheidungen, die in einer solchen Lebensphase anstehen, können sie unterstützen, trösten und beschützen. Der Arzt schließlich kann fachlich kompetent und empathisch die medizinischen Prozesse koordinieren und den Patienten begleiten. Das Gespräch ist hierbei ein zentraler Baustein.
Aus der geschilderten persönlichen Erfahrung heraus entstand mein Bedürfnis, das Treffen zwischen Patienten, Angehörigen und Arzt besser zu verstehen. Welche Prozesse werden in Gang gesetzt? Was sind die Erwartungen der Beteiligten? Wann gelingt das Zusammenspiel und wo hakt es typischerweise? Was kann man verbessern? Ich habe angefangen, persönliche Erfahrungsberichte zu sammeln, und dabei ist mir klar geworden: Wir reden häufig aneinander vorbei. Wir Ärzte bemühen uns zu selten, die Erkrankungssituation mit den Augen der Betroffenen zu sehen.
Dieses Buch richtet sich allerdings nicht in erster Linie an meine Kollegen. Es ist für Patientinnen und Patienten geschrieben, die an einer chronischen oder schweren Erkrankung leiden, und für ihre Angehörigen. Ich möchte Sie ermuntern und Ihnen praktische Hinweise an die Hand geben, wie Sie das Gespräch mit Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin aktiv mitgestalten können. Denn Sie können viel einbringen; oft sind es die berühmten Kleinigkeiten, damit es ein partnerschaftliches Gespräch wird. Und nur dann wird es ein gutes Gespräch. Seien Sie mutig und werden Sie aktiv! Einen überarbeiteten oder gar überheblichen Arzt ohne Empathie werden Sie nicht ändern. Aber nach der Lektüre haben Sie ein klares Bild, wie ein Gespräch auf Augenhöhe aussehen sollte. Dies schließt auch das Wissen darüber ein, wann es, als letzte Konsequenz, angezeigt ist, sich einen anderen Arzt zu suchen.
Der Umgang mit schwerer, chronischer Krankheit ist mir gut vertraut, als Angehöriger und als Mediziner. Die Geschichten und Gedanken in diesem Buch basieren auf eigenen Erfahrungen und persönlichen Gesprächen mit Betroffenen in meinem Freundes- und Bekanntenkreis. Ich habe bewusst mit Menschen gesprochen, zu denen ich ein enges Vertrauensverhältnis habe, um zu erfahren, was sie in solchen Momenten wirklich bewegt hat. Ihre Fragen, Bedürfnisse und Wünsche bezüglich einer guten Begegnung im Sprechzimmer stehen im Mittelpunkt des Buches. Die einzelnen Kapitel widmen sich dabei Themen, die von Patienten und Angehörigen im Austausch mit Ärzten als besonders wichtig erachtet, aber von uns häufig als nebensächlich abgetan werden. Dazu zählen Fragen wie:
Sollte ich mich auf den Arztbesuch vorbereiten?
Was mache ich, wenn ich den Arzt nicht verstehe?
Wann bespreche ich am besten die Ergebnisse meiner Internetsuche oder ähnliche Erkrankungsbeispiele aus der eigenen Familie mit dem Arzt?
Was kann ich selbst beitragen, damit das Gespräch gelingt?
Wie beuge ich typischen Konflikten in der DreiecksbeziehungPatient-Arzt-Angehöriger vor?
Wodurch unterstütze ich als Angehöriger meine Partnerin, mein Kind, meine Eltern oder meinen Freund am besten?
Ich hoffe, auf den folgenden Seiten kann ich Ihnen Einblicke geben und Aha-Erlebnisse vermitteln, die ich selbst im Lauf meiner Recherche gehabt habe. Ich werde versuchen, Ihnen ganz praktische Wege aufzuzeigen, damit Sie das Sprechzimmer Ihrer Ärztin beziehungsweise Ihres Arztes beim nächsten Mal zufriedener verlassen. Denn gute Gespräche im Arztzimmer sind ein wesentlicher Baustein der Bewältigung Ihrer Erkrankung beziehungsweise der Behandlung Ihres Angehörigen.
1
»Der Doktor macht das schon«
Ihre Beschwerden und der erste Arzttermin
Beim Blick in den Spiegel hab ich keine Auffälligkeiten gesehen. War es doch nur Einbildung? Ich habe mich seit Jahren problemlos mit dem kleinen Apparat rasiert. Nun blieb ich dabei immer wieder links unterm Kinn hängen. Habe ich meinen Hals befühlt, dann war da so eine kleine Verdickung, so groß wie eine Erbse vielleicht. Weh tat es nicht, ging aber auch nicht weg. Schließlich hat mich der kleine Knoten gestört und ich bin doch zum Arzt gegangen. Ist doch so: Wenn man nicht genau weiß, was los ist, geht man zum Arzt und lässt ihn machen. Er ist der Experte und sollte wissen, was zu tun ist.“
So hat mir Michael, ein guter Freund, den Beginn seiner Odyssee erzählt. Sie kennen das sicher selbst: Irgendetwas stimmt nicht. Aber man will sich nicht anstellen und ist auch nicht begeistert von der Vorstellung, die Tagesplanung über den Haufen zu werfen und sich in ein Wartezimmer zu setzen. Sicher ist es nur eine Kleinigkeit. Kann ich selbst etwas dagegen tun? Irgendwann ist man doch beunruhigt: Vielleicht ist es etwas Schlimmes … Muss ich ins Krankenhaus? Im Vorfeld geistert einem alles Mögliche durch den Kopf. In den Gedankensalat ein wenig Ordnung zu bringen, so eine Art roten Faden zu finden, wäre schön. Denn wenn Sie sich entschieden haben, einen Arzt aufzusuchen, ist eines klar: Gleich zu Beginn des Treffens müssen Sie die eigenen Beschwerden schildern.
Missempfindungen in Worte zu fassen ist aber nicht leicht. Der Arzt hat ein ganz eigenes Vokabular für körperliche Störungen. Und jeder Mensch hat seine Weise, den eigenen Zustand zu erleben und zu beschreiben. Möglicherweise empfinde ich Sodbrennen als unglaublich schmerzhaft und beeinträchtigend. Sie hingegen würden es nicht einmal erwähnen. Michael hat sich durch den kleinen Knoten, obwohl er nicht schmerzhaft war, verunsichert gefühlt und einen Arzt aufgesucht. In meiner Tätigkeit als Leiter einer Universitätsambulanz habe ich dagegen häufiger Patienten erlebt, die erst im letzten Moment, als die Beschwerden nicht mehr zu ertragen waren, in der Praxis auftauchten. Symptome werden individuell sehr unterschiedlich wahrgenommen.
Die weiteren Schritte der Behandlung hängen entscheidend davon ab, die Beschwerden richtig und vollständig zu erfassen. Ob Sie nun zum Arzt gehen, um einen kleinen Knoten am Hals abklären zu lassen, oder ob Sie mit massiven Schmerzen kommen. Beides sind gute Gründe. Nun meint Michael, der Arzt sei der Fachmann. Er kenne die nächsten Schritte. Aber so einfach ist das nicht. Wir reden hier ja nicht über einen Schnupfen oder einen gebrochenen Arm. Gerade bei Schmerzen oder diffusen Missempfindungen ist es für den medizinischen Experten gar nicht so einfach, Ihre Beschwerden richtig einzuordnen. Damit es gelingt, muss er sich ein klares und umfassendes Bild von der Persönlichkeit verschaffen, die vor ihm sitzt. Und hierbei können Sie ihm helfen. Versetzen Sie sich auch ein bisschen in die Perspektive des Arztes. Das, was Sie ihm erzählen, ist zunächst erst einmal alles, was er von Ihren Beschwerden kennt. Ein guter Mediziner wird aufgrund Ihrer Schilderungen gezielte Fragen stellen und auf diese Weise einer Diagnose näherkommen. Sich nur auf den angebotenen Stuhl zu setzen und zu hoffen, dass der Fachmann die „richtigen“ Fragen stellt, nämlich die, die Sie erwartet haben, ist allerdings eine riskante Strategie.
Wenn Sie aktiv mitmachen, ist es viel weniger wahrscheinlich, dass ein Teil der Symptome von ihm nicht erfragt wird und am Ende gar nicht auf den Tisch kommt. Gehen Sie hingegen mit der Vorstellung in die Sprechstunde, dass der Arzt Ihre Gedanken und Gefühle lesen und auch ohne Röntgenapparat in Ihren Körper hineinschauen kann, werden Sie bald das Gefühl haben, er verstehe sein Handwerk nicht, zum Beispiel weil er nicht exakt die erwarteten Fragen gestellt hat. Die Denkweise Ihres Arztes ist möglicherweise, ja sogar wahrscheinlich, eine ganz andere als Ihre. In seinen Augen mögen Dinge als wesentlich erscheinen, an die Sie überhaupt nicht gedacht haben, und umgekehrt. Wenn Sie ihm helfen, indem Sie die Beschwerden vollständig und so geordnet wie möglich vortragen, können Sie nicht enttäuscht werden, denn er wird Ihnen entsprechende Fragen stellen. Gibt es keine Enttäuschung, fassen Sie viel schneller Vertrauen, das Verhältnis wird sich entspannter und harmonischer entwickeln. Erzählen Sie daher möglichst genau, was mit Ihnen nicht stimmt und warum Sie gekommen sind. In der Regel wird der Arzt Sie zu Beginn des Gespräches mit einer offenen Frage hierzu einladen.
Ich würde nicht davon ausgehen, dass die Ärztin oder der Arzt alles für einen regelt. In dieser Hinsicht bin ich anderer Meinung als Michael. Mit gezielter Vorbereitung habe ich gute Erfahrungen gemacht. Die Beschwerden und eventuellen Fragen einfach auf einem Zettel zu notieren hat sich hierbei bewährt. Stichpunkte reichen meist aus. Das hat mehrere Vorteile. Sie vergessen auf diese Weise nichts von dem, was Sie sagen und fragen wollten. Sollten Sie im Sprechzimmer dann doch aufgeregt sein, gibt Ihnen der kleine Zettel Sicherheit. Und wenn Sie gut vorbereitet sind, hilft das Ihrem Gegenüber. Nicht nur, weil sie oder er zügig vorankommt.
Gehen Sie mit Beschwerden das erste Mal zu Ihrer Ärztin, sind aus meiner Sicht folgende Dinge wichtig: Wo und wann treten die Beschwerden auf? Wann erstmalig? Wie ist der Charakter (zunehmend, abnehmend, wellenförmig etc.)? Werden sie durch irgendetwas ausgelöst oder gab es ein spezifisches Ereignis, wonach die Beschwerden erstmals auftraten? Wodurch werden sie gegebenenfalls besser oder schlechter? Treten Begleiterscheinungen auf (Übelkeit, Durchfall, Fieber, Schmerzen usw.)? Haben Sie bereits etwas dagegen unternommen? Wenn ja, in welcher Form (eigene Behandlung, anderen Arzt konsultiert etc.)? Was ist dabei herausgekommen? Eindeutig hilfreich ist es, sich auf die Schilderung der tatsächlichen Beschwerden zu beschränken. Präzise und vollständig. Sie erleichtern Ihrer Ärztin hierdurch das Zuhören. Zügig entsteht ein klares Bild Ihrer Beschwerden. Der kleine Zettel unterstützt Sie dabei. Vergessen Sie nicht, auch alle aktuellen eingenommenen Medikamente aufzulisten. Dazu zählen Naturkräuter ebenso wie frei verkäufliche Präparate aus der Apotheke oder Teesorten, insbesondere solche, die Sie in letzter Zeit neu ausprobiert haben.
Unterschätzen Sie deren Wirkung nicht! Vanessa, eine gute Freundin, rief mich an, weil sie einen Druck unten dem Rippenbogen spürte, für den sie keine Erklärung finden konnte. Ich nahm ihren Anruf ernst, da mir die alleinerziehende Mutter nicht als zimperlich bekannt war. Sie suchte nur dann Rat, wenn es wirklich nicht mehr anders ging. Bei der körperlichen Untersuchung zeigte sich eine deutlich vergrößerte Leber. Da dies viele Ursachen – eher harmlose und sehr ernste – haben konnte, riet ich zu einer Laboranalyse und einem Ultraschall des Oberbauches. Deren Befunde deuteten auf eine massive Entzündung der Leber und waren so besorgniserregend, dass Vanessa stationär aufgenommen wurde. Es ließ sich weder eine Virusinfektion der Leber noch eine andere Erkrankung nachweisen. Neue Medikamente hatte sie auch nicht eingenommen. Der Grund für die Leberschwellung blieb unklar. Erst nach Tagen mit umfangreicher Diagnostik und mehreren Gesprächen stellte sich heraus, dass die Ursache der Leberschädigung der übermäßige Genuss von Schöllkrauttee war. Den hatte Vanessa nach Auftreten von Krämpfen im Oberbauch getrunken. Aber offensichtlich viel zu viel. Erfreulicherweise klangen die Beschwerden nach einigen weiteren Tagen Schonung folgenlos ab. Deshalb mein Rat: Geben Sie Ihrer Ärztin eine vollständige Liste inklusive „alternativer“ Produkte wie Tees, Pilze, Algen, Tinkturen und aller sonstigen Dinge, die Sie einnehmen, auch wenn sie Ihnen noch so unwichtig erscheinen. Zum einen ersparen Sie sich möglicherweise unnötige Untersuchungen, zum anderen vermeiden Sie, dass Ihnen eine Arznei verordnet wird, die sich mit dem, was Sie sonst noch einnehmen, nicht verträgt.
Wenn Sie glauben, dass bei einem gewöhnlichen Arztbesuch nach den Schilderungen der Patienten und den anschließenden Fragen der Ärzte in der Regel alle Informationen auf dem Tisch liegen – dann irren Sie sich leider. Die aktuellsten Daten hierzu stammen aus einer breit angelegten Onlinebefragung, die zusammen von mehreren amerikanischen Universitäten durchgeführt wurde. Dr. Levy und ihre Kolleginnen werteten die Gespräche Tausender Patienten mit ihren Ärzten aus und konnten zeigen, dass die Mehrzahl (ca. 70 Prozent) dem Arzt entweder wichtige Dinge vorenthält oder die eine oder andere Frage nicht wahrheitsgemäß beantwortet. Vor allem, wenn die Patienten die Erklärungen des Arztes nicht verstanden hatten oder wenn sie mit einer Empfehlung bzw. Entscheidung nicht einverstanden waren, wurde nichts gesagt und nicht nachgefragt.
Für den Behandelnden ist es in so einem Fall nahezu unmöglich, zu erkennen, dass etwas nicht stimmt. Denn das Gebot, ehrlich und offen zu sein – und das gilt nicht nur für die Patienten-, sondern auch für die Arztseite –, hat einen ganz praktischen Grund: Die Entwicklung des gemeinsamen Behandlungsplanes beruht darauf. Dieser Plan ist ein wesentlicher Schritt für die Therapie, aber auch für das vertrauensvolle Miteinander. In der Regel wird Ihnen Ihre Ärztin die wesentlichen Bestandteile eines solchen Plans vorschlagen, beispielsweise die Art und Dauer der Therapie. Sie ist die fachliche Expertin. Ihr Wissen und ihre Fähigkeiten sind der Grund, warum Sie sie aufgesucht haben. Ein tragfähiger Plan kommt nur zustande, wenn er gemeinsam entwickelt wird. Dazu gehört, dass Sie als Patient Ihre Meinung, Bedenken und Wünsche äußern, aber eben auch Ihre Beschwerden offen und vollständig zu schildern. Die Ärztin sollte Ihre Fragen beantworten und Zweifel ausräumen. Das schließt auch Erläuterungen ein, weshalb ihr eine bestimmte Vorgehensweise geeigneter erscheint als eine andere. Im idealen Fall wird sich dann ein Kompromiss finden lassen.
Ist es nicht verständlich, dass man zum Beispiel unangenehme Dinge lieber nicht erzählt? Ja, aber die hohe Anzahl hat mich doch überrascht. Stellen Sie sich vor, der Vermieter Ihrer neuen Wohnung verheimlicht, dass sich hinter der Badewanne Schimmel befindet. Der Ärger wäre vorprogrammiert. Wenn Sie sich im Sprechzimmer für eine offene Herangehensweise entscheiden, bleiben Ihnen zusätzliche Untersuchungen, vergeudete Zeit und Ärger erspart. Das mag sich vernünftig anhören, werden Sie denken, aber die Patienten in der Onlinebefragung hatten für ihr Flunkern doch Gründe. Auf Platz eins: Sie möchten vom Arzt nicht verurteilt oder belehrt werden. Das kann ich gut verstehen. Ich erwarte als Patient auch ein Gespräch auf Augenhöhe.
Ähnliche Ergebnisse ergab eine vor wenigen Jahren von der GfK, dem größten deutschen Marktforschungsunternehmen, durchgeführte Umfrage, wonach zwei Drittel der Befragten als Grund für einen Arztwechsel angaben, dass sie sich „von oben herab behandelt“ gefühlt hätten. Zweifellos trägt der Arzt die Hauptverantwortung dafür, dass Sie einander auf Augenhöhe begegnen und sich unterhalten können. Voraussetzung für das Entstehen eines partnerschaftlichen Gespräches ist aber auch Ihre wahrheitsgemäße und selbstbestimmte Darstellung. Schildern Sie die Dinge offen und ehrlich, kann er seine Entscheidungen aufgrund richtiger und vollständiger Angaben fällen. Und Sie müssen sich später nicht vorwerfen, dass eine Behandlung in eine Sackgasse geraten ist, bloß weil Sie Symptome nicht ganz oder nicht richtig erzählt haben. Für Ihre Offenheit dürfen Sie Respekt und Wertschätzung erwarten.
Weitere Gründe, die Patienten angaben, warum sie nicht die ganze Wahrheit erzählt hatten: Sie wollten nicht hören, dass ein bestimmtes Verhalten ungesund ist. Es steht ja nun auf jeder Zigarettenpackung, dass Rauchen schädlich ist. Das will man sich vom Arzt ebenso wenig anhören wie die Ermahnung, dass es einfach nicht gut ist, jeden Tag Alkohol zu trinken. Anderen Teilnehmern der Befragung wäre es unangenehm gewesen zuzugeben, dass sie Empfehlungen, zum Beispiel zu Ernährung oder Sport, nicht umgesetzt hatten. Also haben Sie die Details weggelassen oder dem Arzt gegenüber nicht wahrheitsgemäß geantwortet.
Wenn Sie ehrlich sind – kommt Ihnen das bekannt vor? Irgendwie führt an der Erkenntnis kein Weg vorbei: Ein Arztbesuch aufgrund einer gesundheitlichen Krise findet außerhalb der eigenen Komfortzone statt und er geht ans Eingemachte. In dieser Situation ist es natürlich wichtig, wie vertrauensvoll Ihr Gegenüber wirkt. Über Ihren Schatten springen müssen Sie aber auf jeden Fall. Die ärztlichen Entscheidungen können nur auf den Informationen basieren, die Sie zur Verfügung stellen. Denken Sie an Ihre neue Wohnung. Hätten Sie gewusst, dass das Bad von Schimmel befallen ist, wären Sie nicht eingezogen, sondern hätten erst einmal auf der Beseitigung bestanden.
Erlauben Sie Ihrer Ärztin, am Anfang einen eigenen Eindruck ausschließlich aufgrund Ihrer Beschwerden zu gewinnen. Zweifellos haben Sie sich eigene Gedanken gemacht, bevor Sie in die Praxis gekommen sind, vor allem bei besorgniserregenden Symptomen. Bestimmt haben Sie das Internet, Erfahrungsberichte von Bekannten und Verwandten oder andere Quellen zu Rate gezogen. Wenn Sie jetzt aber Ihrer Ärztin gegenübersitzen, lassen Sie Ihre Vermutungen besser erst einmal in der Warteschleife. Wenn diese sich aufgrund einer sachlichen Darstellung ein Bild gemacht hat, können Sie immer noch über Ihre Befürchtungen sprechen. Die Fachfrau kann Ihnen dann auch viel klarer antworten und verschiedene Deutungen bewerten.
Stellen Sie sich vor: Über ein Inserat haben Sie endlich eine Wohnung gefunden, die Ihren Vorstellungen entsprechen könnte. Bei der zügig vereinbarten Besichtigung sind Sie dann mit der Einrichtung des Vormieters konfrontiert, der noch beim Auszug ist. Alles steht voll. Wie wollen Sie inmitten dieser fremden Wohnentscheidungen beurteilen, welche Möglichkeiten die Wohnung Ihnen bietet? Mir wäre eine besenreine Wohnung lieber. Es wäre viel einfacher, die einzelnen Räume auszumessen. Ich könnte mir besser vorstellen, ob mir der Zuschnitt der Zimmer zusagt, genauer beurteilen, ob die Wände ausgebessert werden müssen. Für mich als Arzt ist ein möglichst klares, unverfälschtes Bild Ihrer Beschwerden die beste Arbeitsgrundlage. Eigene Überlegungen zur möglichen Erkrankung oder Therapie lassen sich zu einem späteren Zeitpunkt besser diskutieren, beispielsweise wenn ich Sie mit einer Verdachtsdiagnose konfrontiere. Deckt sich meine Vermutung nicht mit Ihren Recherchen, ist nun ein guter Moment, um ins Gespräch zu kommen.
Wollen Sie zu diesem ersten Besuch allein gehen? Das ist eine Frage, die Sie gut überlegen sollten. Einige Vorteile, den Arzttermin mit Begleitung wahrzunehmen, liegen auf der Hand. Die Wahrscheinlichkeit, etwas Wesentliches zu vergessen, sinkt, da jemand da ist, der Sie erinnern und unterstützen kann. Und: Was die Ärztin oder der Arzt sagt, wird von mehreren Personen aufgenommen. Gerade wenn Sie aufgeregt sind, kann es hilfreich sein, dass noch jemand zuhört. Wie bereits in den einleitenden Worten zu diesem Buch erwähnt, war es für meinen Bruder sehr beruhigend, dass ich bei seinem Gespräch dabei war. Auf diese Weise gingen nicht nur weniger Informationen verloren, weil wir zwei Leute waren, die zuhörten. Wir konnten uns im Nachgang auch über das Gehörte austauschen und Widersprüche aufklären. Ein weiterer Vorteil war, dass ich einspringen konnte, als ich den Eindruck hatte, dass Frank dem Gespräch nicht mehr gewachsen war. Diese halbe Stunde als Angehöriger im Sprechzimmer war für mich, wie gesagt, eine wirklich wichtige Erfahrung.
Rückblickend muss ich allerdings zugeben, dass ich nicht gut vorbereitet war. Im Unterschied zu vielen anderen Angehörigen hatte ich mich aufgrund meines Fachwissens auf die Diagnose bereits einstellen können. Anders als es Ihnen oder Ihrer Begleitung möglicherweise ergeht, bin ich nicht „aus allen Wolken“ gefallen. Aber wie mein Bruder reagieren würde, wenn es wirklich eine schlimme Nachricht gäbe, darüber hatte ich nicht genug nachgedacht. Auf die Möglichkeiten und Herausforderungen für die Begleiter werde ich später ausführlich zurückkommen. Drei Aspekte scheinen mir aber bereits für den ersten Besuch wichtig.
Zunächst einmal: Versuchen Sie, sich auf eine weitere Person zu beschränken. Ihre Ärztin muss ihre Aufmerksamkeit auf alle anwesenden Personen aufteilen. Sie werden im Mittelpunkt stehen, aber Ihr Gegenüber kann Ihre Begleitung nicht ignorieren. Außerdem ist es gut, sich im Vorfeld Gedanken über Ihre Beziehung zu machen: Wie ist das Verhältnis zwischen Ihnen und der Begleitperson, die Sie mit in die Sprechstunde nehmen wollen? Manchmal ist eine Freundin geeigneter als der Partner. Das kann verschiedene Gründe haben. Vielleicht wollen Sie Ihren Partner nicht unnötig beunruhigen oder Sie erinnern sich, dass Ihre Freundin schon einmal ein ähnliches Problem hatte, und Sie daher sehr gut verstehen wird. Wichtig ist, dass Sie der mitgebrachten Person vertrauen und sich ihrer Unterstützung sicher sind. Wenn Schuldgefühle oder Spannungen das Verhältnis belasten, sollten Sie genau abwägen und im Zweifel lieber allein ins Sprechzimmer gehen.