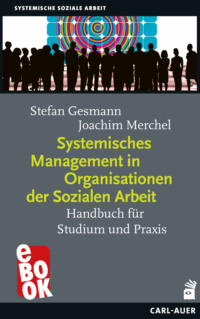Loe raamatut: «Systemisches Management in Organisationen der Sozialen Arbeit»
Stefan Gesmann/Joachim Merchel
Systemisches Management in Organisationen der Sozialen Arbeit
Handbuch für Studium und Praxis
Zweite Auflage, 2021

Mitglieder des wissenschaftlichen Beirats des Carl-Auer Verlags:
Prof. Dr. Rolf Arnold (Kaiserslautern)
Prof. Dr. Dirk Baecker (Witten/Herdecke)
Prof. Dr. Ulrich Clement (Heidelberg)
Prof. Dr. Jörg Fengler (Köln)
Dr. Barbara Heitger (Wien)
Prof. Dr. Johannes Herwig-Lempp (Merseburg)
Prof. Dr. Bruno Hildenbrand (Jena)
Prof. Dr. Karl L. Holtz (Heidelberg)
Prof. Dr. Heiko Kleve (Witten/Herdecke)
Dr. Roswita Königswieser (Wien)
Prof. Dr. Jürgen Kriz (Osnabrück)
Prof. Dr. Friedebert Kröger (Heidelberg)
Tom Levold (Köln)
Dr. Kurt Ludewig (Münster)
Dr. Burkhard Peter (München)
Prof. Dr. Bernhard Pörksen (Tübingen)
Prof. Dr. Kersten Reich (Köln)
Dr. Rüdiger Retzlaff (Heidelberg)
Prof. Dr. Wolf Ritscher (Esslingen)
Dr. Wilhelm Rotthaus (Bergheim bei Köln)
Prof. Dr. Arist von Schlippe (Witten/Herdecke)
Dr. Gunther Schmidt (Heidelberg)
Prof. Dr. Siegfried J. Schmidt (Münster)
Jakob R. Schneider (München)
Prof. Dr. Jochen Schweitzer (Heidelberg)
Prof. Dr. Fritz B. Simon (Berlin)
Dr. Therese Steiner (Embrach)
Prof. Dr. Dr. Helm Stierlin (Heidelberg)
Karsten Trebesch (Berlin)
Bernhard Trenkle (Rottweil)
Prof. Dr. Sigrid Tschöpe-Scheffler (Köln)
Prof. Dr. Reinhard Voß (Koblenz)
Dr. Gunthard Weber (Wiesloch)
Prof. Dr. Rudolf Wimmer (Wien)
Prof. Dr. Michael Wirsching (Freiburg)
Prof. Dr. Jan V. Wirth (Meerbusch)
Themenreihe: »Systemische Soziale Arbeit«
hrsg. von Heiko Kleve
Umschlaggestaltung: Uwe Göbel
Umschlagmotiv: © pixabay
Satz: Verlagsservice Hegele, Heiligkreuzsteinach
Printed in Germany
Druck und Bindung: CPI books GmbH, Leck
Zweite Auflage, 2021
ISBN 978-3-8497-0310-3 (Printausgabe)
ISBN 978-3-8497-8199-6 (ePub)
© 2019, 2021 Carl-Auer-Systeme Verlag
und Verlagsbuchhandlung GmbH, Heidelberg
Alle Rechte vorbehalten
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Informationen zu unserem gesamten Programm, unseren Autoren und zum Verlag finden Sie unter: https://www.carl-auer.de/. Wenn Sie Interesse an unseren monatlichen Nachrichten haben, können Sie dort auch den Newsletter abonnieren.
Carl-Auer Verlag GmbH
Vangerowstraße 14 • 69115 Heidelberg
Tel. +49 6221 6438-0 • Fax +49 6221 6438-22
Inhalt
Einleitung
1Die systemtheoretische Sicht auf Organisationen
1.1Allgemeine Charakteristika von Organisationen
1.2Das traditionelle (zweckrationale) Organisationsverständnis
1.3Eckpunkte eines systemtheoretischen Organisationsverständnisses
1.3.1Organisation als Differenz: Zur Bedeutsamkeit der System-Umwelt-Unterscheidung
1.3.2Entscheidungsprämissen als Strukturen einer Organisation
1.3.3Und wo bleibt der Mensch? Zur Rolle der Organisationsmitglieder
1.3.4Von der Zweck- zur Systemrationalität
1.4Leitorientierungen für ein systemtheoretisches Organisationsverständnis
2Das Besondere von Organisationen der Sozialen Arbeit als Bedingungsfaktoren bei der Konzipierung von Management
2.1Politische Konstituierung sozialer Dienstleistungen
2.2Interaktion als Kern sozialer Dienstleistungen
2.2.1Charakteristika sozialer Dienstleistungen
2.2.2Folgen für das Steuerungshandeln
2.3Legitimation sozialer Dienstleistungsorganisationen
2.4Soziale Dienstleistungsorganisationen im Spannungsfeld verschiedenartiger Anforderungen und Handlungslogiken
2.5Fazit: Spezifika von Organisationen der Sozialen Arbeit und deren Bedeutung für Management
3Steuerung als Managementfunktion und Leitungsaufgabe
3.1Anspruch »Steuerung«: Selbstverständlich und fragwürdig zugleich
3.2Das »traditionelle« Steuerungsverständnis – und dessen fehlleitende Orientierungen
3.3»Steuerung« systemtheoretisch gedacht
3.4Möglichkeiten zur Steuerung in und von Organisationen
3.5Steuerungskompetenz als Haltung gegenüber der Organisation als sozialem System
3.6Leitorientierungen für ein systemisch verstandenes Steuerungshandeln
4Organisationsgestaltung
4.1Zentrale Gestaltungsanforderungen
4.2Organisationsgestaltung als Umgang mit Spannungsfeldern und Paradoxien
4.3Organisationsgestaltung »systemisch«
4.4Leitorientierungen für eine systemisch konzipierte Organisationsgestaltung
5Zur Bedeutung und Beeinflussbarkeit von Organisationskultur
5.1Zur (bedeutsamen) Funktion von Organisationskulturen
5.2Traditionelle Ansätze zur Beeinflussung von Organisationskulturen
5.3Organisationskultur systemtheoretisch betrachtet
5.4Veränderung von Organisationskultur: Impulse auf der Grundlage des Verstehens
5.4.1Veränderung von Artefakten
5.4.2Indirektes Ansprechen der Organisationskultur über die Formalstruktur
5.4.3Zur Vorbildfunktion von Leitungskräften
5.5Leitorientierungen für eine systemisch konzipierte Beeinflussbarkeit der Organisationskultur
6Organisationsveränderung – Entscheidungen herbeiführen als Management von Balancen
6.1Organisationsveränderung – eine systematisierte Annäherung
6.2Orientierungspunkte für episodische Phasen der Organisationsveränderung
6.3Zur (bewussten) Steigerung der organisationalen Lernfähigkeit
6.3.1Zur Erhöhung des Variationsreichtums
6.3.2Zur Schärfung von reflektierten Selektionen
6.4Organisationsveränderung: Vom Entweder/oder zum Sowohl-als-auch
6.5Leitorientierungen für eine systemisch konzipierte Organisationsveränderung
7Betriebswirtschaftliche Steuerung: Controlling – systemisch konzipiert
7.1Ausgangssituation: Warum überhaupt Controlling?
7.2Spannungsfelder innerhalb des Controllings
7.3Zur Grundlogik des traditionellen Controllings
7.4Systemisches Controlling: Was ist es, und wie kann es gehen?
7.4.1Zum mehrdimensionalen Beobachtungsfokus eines systemischen Controllings
7.4.2Zur erweiterten Beobachtungsform des systemischen Controllings
7.4.3Zum selbstreflexiven Charakter eines systemischen Controllings aufgrund von dessen begrenzter Sichtweise
7.4.4Reflexives Bewerten statt rationales Absichern
7.5Leitorientierungen für ein systemisch konzipiertes Controlling
8Marketing
8.1Warum Marketing auch in der Sozialen Arbeit für Management bedeutsam ist
8.2Zum Kern von Marketing und dessen Herausforderung für Managementhandeln
8.3Absichten und Paradoxien im Marketing
8.4Orientierungslinien für ein systemisch ausgerichtetes Marketing
8.5Unterschiede zu »nicht systemischen« Marketingkonzepten
8.6Leitorientierungen für ein systemisch konzipiertes Marketing
9Qualitätsmanagement
9.1Warum Qualitätsmanagement in der Sozialen Arbeit? Anforderungen und Widersprüche
9.2Orientierungslinien im »traditionellen« Qualitätsmanagement
9.3Perspektiven eines systemisch konzipierten Qualitätsmanagements
9.4Leitorientierungen für ein systemisch konzipiertes Qualitätsmanagement
10Personalmanagement
10.1Personalmanagement als Herausforderung insbesondere in sozialen Dienstleistungsorganisationen
10.2Spannungsfelder und Paradoxien im Personalmanagement
10.3Orientierungslinien für ein systemisch ausgerichtetes Personalmanagement
10.4Aufgaben des Personalmanagements
10.5Leitorientierungen für ein systemisch konzipiertes Personalmanagement
11Bildungsmanagement
11.1Ausgangssituation: »Anything-goes-Mentalität« innerhalb der Fort- und Weiterbildung
11.2Spannungsfelder und Herausforderungen in Bezug auf die Steuerung von Fort- und Weiterbildungen
11.3Traditionelle Bildungsmanagementansätze
11.4Handlungsorientierungen: Perspektiven eines systemischen Bildungsmanagements
11.5Systemisches Bildungsmanagement: Eine abschließende Betrachtung
11.6Leitorientierungen für ein systemisch konzipiertes Bildungsmanagement
12Strategisches Management
12.1Warum Strategisches Management in Organisationen der Sozialen Arbeit?
12.2Strategisches Management: Zweck und Erwartungen
12.3Systemische Strategieentwicklung jenseits des Rationalitätsparadigmas
12.4Typen oder Muster der Strategiebildung in Organisationen
12.5Leitorientierungen für eine systemisch konzipierte Strategiebildung
Literatur
Über die Autoren
Einleitung
Ein Auslöser für das Vorhaben, ein Buch über ein systemisch konzipiertes Sozialmanagement zu schreiben, war die Beobachtung einer markanten Differenz in Organisationen der Sozialen Arbeit: Während einerseits »systemische Konzepte« zum methodischen Handeln in der Sozialen Arbeit allgegenwärtig erscheinen, trifft man in den Leitungsebenen der Einrichtungen und Dienste auf ein eher sozialtechnisch ausgerichtetes Managementverständnis. Man erhält den Eindruck, dass gleichsam »zwei Welten« in der Sozialen Arbeit existieren und in einer Organisation weitgehend irritationsarm nebeneinanderstehen: die Welt der systemisch inspirierten Methoden und Instrumente im Umgang mit Klienten1 einerseits und die Welt eines implizit sozialtechnischen Bemühens und Glaubens, Organisationen nach eigenen Vorstellungen intentional gestalten zu können, bei den Managementaktivitäten andererseits.
Bereits in der Ausbildung werden viele Studierende mit systemischen Denkweisen und systemisch inspirierten Methoden konfrontiert; beim Hineinwachsen in die beruflichen Tätigkeitsfelder können sie in vielfältigen Fortbildungen ihre Grundkenntnisse erweitern. Nicht wenige Organisationen in Handlungsfeldern der Sozialen Arbeit (z. B. Beratungsstellen, ambulante und stationäre Erziehungshilfen, Jugendamt/ASD u. a. m.) erwarten von den dort tätigen Fachkräften, dass sie sich in systemischen Beratungsmethoden fortbilden und ein Zertifikat als »Systemische/r Berater/in« erwerben. Dass das systemische Denken im Hinblick auf die Arbeit mit Klienten innerhalb der Sozialen Arbeit einen beachtlichen Verbreitungsgrad angenommen hat, scheint keine allzu gewagte These zu sein.
Blickt man andererseits in die Leitungsetagen von Organisationen der Sozialen Arbeit, dann stellt man verwundert fest, dass sich das systemische Denken von Hierarchieebene zu Hierarchieebene zu verflüssigen scheint. Hier nehmen Leitungspersonen fast selbstverständlich die an sie herangetragene Erwartung an, »ihren Laden im Griff« zu haben. Das Ausbleiben der Effekte von Steuerungshandeln wird als partielles Steuerungsversagen interpretiert und mit der Suche nach neuen, »zielgenaueren« Impulsen zwischen Sanktionierung und »sozialverträglicher Überredung« der Mitarbeiter beantwortet. Neue Instrumente des Marketings, des Controllings, des steuerungsrelevanten Qualitätsmanagements, der sozialtechnisch verbesserten, psychologisch ausgeklügelten Personalführung werden gesucht – und häufig vermeintlich in der »traditionellen« Betriebswirtschaftslehre gefunden; alles in dem Bestreben, »zielgenauer« zu steuern und das Leben in der Organisation über Steuerungshandeln »in den Griff zu bekommen«.
Was zur Praxis des Managements in Organisationen der Sozialen Arbeit zu beobachten ist, gilt auch für die konzeptionelle Diskussion zum Sozialmanagement: Nicht einmal auf der konzeptionellen Ebene (und erst recht nicht in der Praxis) des Sozialmanagements hat das systemische Denken einen Platz erhalten, das dem in der Methodendiskussion als selbstverständlich angenommenen Vokabular des Systemischen auch nur annähernd entspricht.
Die skizzierte beobachtete Differenz zwischen den unterschiedlichen Ständen der Verarbeitung systemischen Denkens in Organisationen der Sozialen Arbeit ruft zum einen nach Erklärungen und motiviert zum anderen zur Suche nach Ansatzpunkten, die Differenz dadurch zu verringern, dass systemische inspirierte Denkweisen und Methoden auch von den Managementebenen der Sozialen Arbeit stärker aufgegriffen werden.
Versucht man, die markierte Differenz zu erklären, bieten sich insbesondere vier Überlegungen als Hypothesen an:
•Die Wahrnehmung, systemische Konzepte seien in der Arbeit mit Klienten zum allgemeinen und akzeptierten methodischen Inventar von Fachkräften der Sozialen Arbeit geworden, ist möglicherweise verkürzt und trifft nur die Oberfläche der Beobachtung. Es existieren Anzeichen dafür, dass »systemische« Konzeptformulierungen zum methodischen Handeln in der Praxis vielfach nur begrenzt aufgenommen und verarbeitet werden. Es wird vornehmlich derjenige Teil aufgenommen, der die Einbettung des Individuums in soziale Konstellationen (»Systeme« wie Familien, Peergroups, Nachbarschaft, sozialräumliche Konstellationen etc.) anspricht: Man denkt »systemisch«, weil man in der Arbeit mit dem Individuum soziale Konstellationen (»Systeme«) mitdenkt und beim methodischen Handeln berücksichtigt. Wenn man dann noch bestimmte aus dem »Systemischen« abgeleitete methodische Vorgehensweisen (zirkuläres Fragen, die »Wunderfrage« etc.) kennt und partiell anwendet, glaubt man, sein Handeln vor dem Hintergrund des »Systemischen« ausreichend legitimieren zu können. Der andere Teil systemtheoretischer Überlegungen und Konzepte – die Frage der Steuerbarkeit sozialer und psychischer Systeme, die Frage der Kausalität, die Autonomie des Individuums etc.) – bleibt bei der »Anwendung« systemischer Konzepte weitgehend ausgespart. Das »Systemische« in der Praxis der Sozialen Arbeit erscheint vielfach als eine Ausweitung des Blickes, die allerdings auf einige methodische Aspekte begrenzt bleibt. Die grundlegenden theoretischen Annahmen, die Irritation und Reflexion hervorrufen würden, werden jedoch nicht als prägend zur Kenntnis genommen. Das »Systemische« wird also auf bestimmte »Instrumente« beschränkt und damit in einer pragmatischen Absicht verkürzt. Es wird vornehmlich das aufgenommen, was das Handlungsinstrumentarium erweitern könnte; das Irritierende, zur Reflexion und zum Zweifel Herausfordernde wird an den Rand gedrängt oder gar ignoriert.
•Es wird eine deutliche Trennung vorgenommen zwischen der interaktionalen Ebene der Hilfegestaltung einerseits und der organisationalen Ebene andererseits, innerhalb derer die Hilfe stattfindet und in welche die Interaktionen eingebunden sind. Während auf der interaktionalen Ebene das Vokabular des »Systemischen« geradezu zur Norm geworden ist, wurde die organisationale Ebene davon abgetrennt, weil man soziale Organisationen primär (oder gar ausschließlich) als Mittel zum Zweck der interaktionalen Hilfegestaltung verstand, ohne sie als soziale Systeme mit eigener Dynamik zur Kenntnis zu nehmen und in dieser Hinsicht praktisch zu würdigen. Implizit denkt und handelt man nach dem Motto: »Die Organisation hat zu funktionieren, damit die Hilfe geleistet werden kann; man braucht sie irgendwie, aber sie soll ansonsten nicht stören.« Organisation wurde nur als instrumentelles Element der Sozialen Arbeit begriffen. Entsprechend wurde die Erwartung an Leitungspersonen formuliert: Sie sollten dafür sorgen, »ihren Laden im Griff zu haben«, also das Instrument »Organisation« so aufzustellen, dass die Hilfegestaltung reibungslos verlaufen kann, und sie wurden an dieser (impliziten) Norm gemessen. Dies blieb nicht ohne Auswirkungen auf das Selbstbild und den Selbstanspruch der Leitungspersonen: Auch sie wollten »den Laden im Griff haben« und suchten daher Konzepte, Methoden und Instrumente, die ihnen dies verlässlich ermöglichen sollten: daher der Rückgriff auf die (traditionelle) Betriebswirtschaftslehre (»von der Wirtschaft lernen«). Insofern konnte und kann es in Organisationen der Sozialen Arbeit geschehen, dass es eine markante Zweiteilung im Reden (und konzeptionellen Denken) gibt: die »Basis-Mitarbeiter« (interaktionale Ebene der Hilfegestaltung) mit ausgeprägtem »systemischem« Vokabular und die Leitungsebene (organisationale Ebene) mit aus der traditionellen BWL entlehntem steuerungsoptimistischem, tendenziell sozialtechnischem Denken. Und mehr oder weniger erstaunlich: Dieses Nebeneinander führte nicht immer zu Irritationen, die Reflexionen auslösten! Es herrscht weiterhin der »alte« Anspruch vor, dass eine Leitungsperson dann gut ist, wenn sie a) »ihren Laden im Griff« hat, und dies b) auf eine (in der Sozialen Arbeit normativ verankerte) sozialverträgliche Weise (partizipativ, kollegial etc.) erreicht.
•Organisationale Kontexte (und damit Management) wurden über eine lange Zeit in ihrer Bedeutung für fachliches Handeln in der Sozialen Arbeit vernachlässigt. Die Einführung von Managementdenken in der Sozialen Arbeit war verbunden mit der Intention, organisationale Dysfunktionen zu beseitigen. Man rufe sich in Erinnerung: Das Aufkommen von Managementdiskussionen und -konzepten in den 1980er- und 1990er-Jahren kam nicht primär aus der Profession selbst, sondern wurde gleichsam »von außen« herangetragen. Bücher wie »Funktionaler Dilettantismus« (Seibel 1992), in denen den freien Trägern der Sozialen Arbeit massives Managementversagen vorgeworfen wurde, oder der Spiegel-Report zum Managementversagen der freien Wohlfahrtspflege unter dem Titel »Saugen und Mauscheln« (o. V. 1988) und weitere Veröffentlichungen zu Managementdefiziten warfen insbesondere den freien (und später auch den öffentlichen) Trägern mangelnde Kompetenz in der Wirtschaftsführung mit Folgen für das soziale Hilfesystem vor. Erste Versuche, Konzepte des Sozialmanagements zu entwickeln, bewegten sich noch in der Diktion einer Sozialarbeitstradition (eher gruppendynamisch ausgerichtete Konzepte wie z. B. Müller-Schöll u. Priepke 1989; Müller-Schöll 1993). Doch auch solche Konzepte verhießen keine angemessene Perspektive zur Verbesserung der betriebswirtschaftlichen Steuerung, sodass sich eher eine Haltung gegenüber dem Sozialmanagement als »ordnender Zugriff« ausprägte, mit der die bestehenden Ineffektivitäten, Organisationsmängel und Mängel in der Wirtschaftsführung behoben werden sollten (Merchel 2009) – eine Haltung, die das Einsickern von systemisch inspiriertem Denken in das Sozialmanagement nicht gerade beförderte.
•Dort, wo systemisches Denken zumindest partiell in die Konzipierung von Sozialmanagement einbezogen wurde, blieb es häufig in eher allgemeinen Konzeptionsformulierungen stecken und wurde nicht so gezielt auf einzelne Steuerungsbereiche des Sozialmanagements bezogen, als dass es Leitungspersonen Orientierungen für ihr praktisches Leitungshandeln geboten hätte. Dadurch blieb »systemisches Denken« abstrakt und für das praktische Managementhandeln weitgehend unzugänglich. Eine Leitungsperson, der eine Vorstellung vermittelt wurde, wie Sozialmanagement generell unter systemischen Gesichtspunkten zu verstehen und zu konzipieren ist, die dies aber nicht für ihre konkreten Managementaufgaben anwenden konnte, erlebte das systemische Konzept als zu wenig nutzbar für ihre Aufgaben der betriebswirtschaftlichen, fachlichen und mitarbeiterbezogenen Steuerung etc. »Systemisches Denken« wird in den Konzeptionsüberlegungen des Sozialmanagements höchstens ansatzweise mit konkretem Managementhandeln verkoppelt, es erscheint letztlich nicht ausreichend »anschlussfähig« an die Praxis des Sozialmanagements. Es wird von den Managementakteuren als zu weit weg von ihrem Alltag und den dort zu bewältigenden Anforderungen erlebt – mit der Folge, dass Leitungspersonen sich in ihrem Alltagshandeln entweder »irgendwie durchwursteln« oder eher zu Methoden und Instrumenten greifen, die ihnen im Sinne der »traditionellen« Betriebswirtschaftslehre vermeintlich die Möglichkeit eines intentionalen, auf bestimmte Effekte gerichteten Steuerungshandelns eröffnen.
Ziele und Aufbau dieses Buches
Wir wollen mit dem vorliegenden Buch einen Beitrag leisten zur Verringerung der Differenz zwischen der Tendenz zu systemischem Denken und Handeln auf der Interaktionsebene einerseits und der Ausrichtung an einem tendenziell sozialtechnologischen Managementverständnis andererseits. Wir wollen Orientierungen entwickeln und zur Diskussion stellen für systemisch inspiriertes Denken und Handeln auch auf den Managementebenen. Dazu charakterisieren wir in einer theoretisch basierten, jedoch auf die Ebene praktischen Managementhandelns ausgerichteten Weise zunächst das systemtheoretische Verständnis von »Organisation« (Kapitel 1) und – daraus abgeleitet – ein systemtheoretisches Konzept von Steuerung in Organisationen der Sozialen Arbeit (Kapitel 3). Ferner verdeutlichen wir, um welchen Organisationstypus es sich bei Organisationen der Sozialen Arbeit handelt und mit welchen spezifischen Konstellationen das Managementhandeln in diesen Organisationen verknüpft ist (Kapitel 2), um dann konkret auf die einzelnen Steuerungsbereiche einzugehen und jeweils zu entfalten, wie sich das zuvor dargelegte Organisations- und Steuerungsverständnis dort konkretisieren lässt im Hinblick auf einzelne Managementaufgaben und Steuerungsfelder:
•Organisationsgestaltung (Kapitel 4) und
•Organisationsveränderung (Kapitel 6) mit besonderer Erörterung des Einflussfaktors »Organisationskultur« (Kapitel 5),
•Controlling als betriebswirtschaftlicher Steuerungsmodus (Kapitel 7),
•Marketing als Gestaltung der Bezüge einer Organisation zu ihrer Umwelt (Kapitel 8),
•Qualitätsmanagement mit fachlichem Steuerungsfokus (Kapitel 9),
•Personalmanagement als Umgang mit dem zentralen Qualitätsfaktor »Mitarbeiter« (Kapitel 10) unter besonderer Beachtung des Bildungsmanagements als zentralen Bestandteils der Personalentwicklung (Kapitel 11) sowie abschließend
•das Strategische Management als das kontinuierliche Bemühen um Aufrechterhaltung der Existenz einer Organisation der Sozialen Arbeit im Gefüge einer sich verändernder Umwelt und der Anforderungen, die durch die gesellschaftliche Verarbeitung der Dynamik Sozialer Probleme an die jeweilige Organisation Sozialer Arbeit herangetragen werden, aber von dieser wahrgenommen und zur Gewährleistung ihrer eigenen Existenz interpretiert und verarbeitet werden müssen (Kapitel 12).
In der Bezugnahme und Verarbeitung der generellen Blickweise auf »Organisation« und auf »Steuerung« im Hinblick auf die verschiedenen Steuerungsbereiche versuchen wir Antworten auf die folgenden Fragen zu entwickeln:
•Welche praktischen Probleme müssen in dem jeweiligen Steuerungsbereich bearbeitet oder gelöst werden? Welche Spannungsfelder und Paradoxien, die in den Blick genommen und bewältigt werden müssen, ergeben sich dabei im jeweiligen Managementbereich?
•Wie sind die in vielen Organisationen der Sozialen Arbeit sichtbaren Aufgaben sowie Lösungs- und Bearbeitungsstrategien aus systemtheoretischer Perspektive zu interpretieren?
•Welche Unterschiede ergeben sich zwischen einer »traditionellen« Sozialmanagementsichtweise und einer systemtheoretischen Perspektive? Warum vermag eine systemtheoretische Perspektive den Blick auf angemessenere Bearbeitungen zu eröffnen?
•An welchen »Leitorientierungen« kann sich ein »systemtheoretisch aufgeklärtes (Sozial-)Managementhandeln« ausrichten?
Mit dem Versuch, systemtheoretische Perspektiven konkreter auf Steuerungsbereiche für Managementhandeln in Organisationen der Sozialen Arbeit zu beziehen und dadurch praktische Reflexions- und Handlungsorientierungen zu entwickeln, verbinden wir die Absicht und die Hoffnung, zur oben skizzierten Differenzminimierung beizutragen und die systemtheoretische Perspektive auch für Akteure des praktischen Sozialmanagements »anschlussfähiger« zu machen.
Schon zu Beginn, in dieser Einleitung, wollen wir die Leser auf eine zentrale Orientierung für die Herausbildung eines systemtheoretisch konzipierten Sozialmanagements aufmerksam machen, deren Beachtung hilfreich für die Lektüre des Buches ist und die in den einzelnen Kapitel jeweils deutlicher herausgearbeitet, begründet und konkreter auf die einzelnen Steuerungsbereiche bezogen wird:
Für alle Bereiche des Managements in Organisationen der Sozialen Arbeit gilt die Anforderung, das bisherige Managementhandeln reflexiv in den Blick zu nehmen:
•im Hinblick auf Wirkungen und Nebenwirkungen,
•im Hinblick auf (explizite und implizite) Annahmen, die das Managementhandeln bisher geleitet haben oder die in diesem zum Ausdruck kommen,
•als Bewertung zur Angemessenheit dieser Annahmen sowie
•als Nachdenken darüber, wie Managementimpulse bisher verarbeitet worden sind.
Eine verstärkte Ausrichtung auf systemische Perspektiven im Sozialmanagement bedeutet auch, das Managementhandeln in der Vergangenheit zu beobachten, um a) daraus Erkenntnisse zu gewinnen über Zustand und Dynamik der Organisation sowie b) Schlussfolgerungen für die Handhabung weiterer Managementimpulse zu ziehen (als begründete Hypothesen). Umorientierung im Managementhandeln bedeutet auch, Beobachtungen der Dynamik bisherigen Managementhandelns und seiner Funktion in der Organisation zu machen als Reflexionshintergrund zur Entwicklung anschlussfähiger neuer (veränderter) Managementimpulse.
Weil die zukunftsorientierte Reflexion zu systemischen Perspektiven des Sozialmanagements immer auch eine reflexive Verarbeitung des bisherigen Managementhandelns und des jeweiligen Zustands des Managements einer Organisation der Sozialen Arbeit einschließen sollte, möchten wir mit den Darstellungen in den einzelnen Kapiteln dazu anregen, sich nicht nur mit möglichen zukünftigen (systemisch ausgerichteten) Handlungsperspektiven zu beschäftigen, sondern sich anhand der in diesem Buch enthaltenen Kategorien und Darstellungen auch mit der bisherigen Managementpraxis in einer Organisation der Sozialen Arbeit auseinanderzusetzen. Denn anschlussfähige und damit praktisch handhabbare und wirkungsvolle Entwicklungsperspektiven haben immer eine sorgfältige Analyse und Reflexion des Bisherigen zur Voraussetzung.
Zur Genese dieses Buches
Zum Schluss der Einleitung möchten wir noch etwas zur Genese dieses Buches sagen und zugleich einem besonderen Personenkreis unseren Dank aussprechen. Früher Ausgangspunkt zu Überlegungen für dieses Buch waren die Vorbereitung und die Durchführung des Fachtages »Systemisches Management – Was ist das und was nützt es?«, der im Februar 2014 an der Fachhochschule Münster stattfand (Referent u. a. Fritz B. Simon). Die Arbeit an dem Buch verzögerte sich durch viele andere Aufgaben und Arbeitsvorhaben – u. a. durch die Konzipierung des weiterbildenden Zertifikatskurses »Systemisches (Sozial-)Management«, der dann schließlich in sieben Seminarmodulen mit einer Gruppe von 18 Teilnehmern (Leitungspersonen in Organisationen der Sozialen Arbeit) von Oktober 2017 bis September 2018 an der Fachhochschule Münster (Fachbereich Sozialwesen) stattfand. Die Diskussionen in den Seminaren mit diesen Leitungspersonen zu den verschiedenen Steuerungsbereichen und zu deren »systemischer Ausprägung« waren für das Schreiben und Überarbeiten der einzelnen Kapitel dieses Buches insofern sehr anregend, als wir durch kritische Rückfragen, durch »Hinweise aus der Praxis«, durch Reflexionsimpulse motiviert wurden, unsere Gedanken zu ordnen, zu präzisieren, anzureichern. Dafür möchten wir an dieser Stelle den Teilnehmern des Kurses danken; durch ihre Beiträge in den Seminardiskussionen haben sie zur Präzisierung einiger Argumentationen in diesem Buch beigetragen. Nicht nur für dieses Buch, sondern auch in anderen Weiterbildungskursen zum »Systemischen (Sozial-)Management« (www.fh-muenster.de/systemisches_management) können wir ihre Anregungen nutzen, und wir sind zuversichtlich, dass auch in weiteren Fortbildungen und Fachdiskussionen das Vorhaben »Systemisches (Sozial-)Management« zu einem kontinuierlichen Entwicklungsprojekt in Theorie, Konzeptionsarbeit und Praxis werden kann.
1Auf Wunsch des Verlages wird in diesem Werk bei Personenbezeichnungen in der Regel darauf verzichtet, jeweils die männliche und die weibliche Form anzuführen. Gemeint sind jeweils alle Geschlechter, unabhängig davon, ob die männliche oder die weibliche Form benutzt wird.