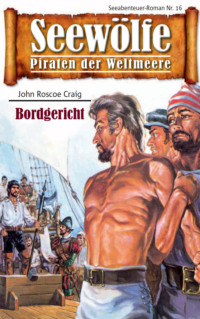Loe raamatut: «Seewölfe - Piraten der Weltmeere 16»
Impressum
© 1976/2013 Pabel-Moewig Verlag GmbH,
Pabel ebook, Rastatt.
ISBN: 978-3-95439-199-8
Internet: www.vpm.de und E-Mail: info@vpm.de
1.
Die See war spiegelglatt wie der Tisch in der Kapitänskammer der „Pelican“, den der Page John Drake bereits seit zwei Stunden mit verbissener Hartnäkkigkeit auf Hochglanz zu bringen versuchte. Die Segel hingen bewegungslos von den Rahen. Nur selten unterbrach ein Knarren von Blöcken oder Tauwerk die nervenzermürbende Stille an Deck der kleinen Galeone, die in einem Meer von dunkelgrünem Teer zu stecken schien.
Ein paar Männer kauerten bewegungslos unter der Back und starrten dumpf in die Näpfe, die ihnen Mac Pellew mit Pökelfleisch gefüllt hatte. Das griesgrämige Gesicht des Kochs war nicht dazu angetan, die Laune der Männer zu heben.
Johnnie Duncan lief ein Schauer über den Rücken, als er in den Napf griff, um sich ein Stück Fleisch in den Mund zu schieben. Angewidert zog er die Hand wieder fort. Wie er den Fraß haßte, den sie jetzt schon seit mehr als dreißig Tagen von diesem Widerling Mac Pellew vorgesetzt kriegten! Immer nur versalzenes Pökelfleisch, verschimmelter Schiffszwieback und abgestandenes Dünnbier! Und wie es aussah, würden sie bis in alle Ewigkeit nichts anderes zu fressen kriegen, denn in dieser Höllengegend gab es nicht einmal einen Hauch von Wind, der die Schiffe des Drakeschen Verbandes vorwärts getrieben hätte.
Johnnie Duncan versuchte das Zittern seiner Schultern zu unterdrükken, aber es gelang ihm nicht. Ein Geräusch hatte sich in seinen Ohren festgefressen und wurde von Sekunde zu Sekunde lauter. Das Schmatzen des Wassers an der Bordwand war kaum zu hören, doch für Duncan war es, als würde sich ein Dämon die geifernden Lefzen lecken, bevor er seine Opfer verschlang.
Taumelnd sprang er auf. Der Napf mit dem Pökelfleisch polterte aufs Deck und beschmutzte die gescheuerten Planken.
Die Köpfe der anderen Männer ruckten hoch.
„Ich will nicht!“ brüllte Johnnie Duncan. Ein riesiges rotes Auge starrte ihn an, eine fürchterliche Fratze näherte sich seinem Gesicht. Er sah die nadelspitzen Zähne, von denen Blut tropfte. Er schrie sein Entsetzen hinaus. In seiner Verzweiflung riß er das Messer aus seinem Gürtel und hieb auf die fürchterliche Fratze ein.
Der Dämon war schneller als er. Wo er auch hinhieb, die Fratze war längst an einem anderen Ort. Johnnie Duncan spürte die Klauen des Dämons an seinen Armen. Er wehrte sich mit aller Kraft, aber er war nicht stark genug, um gegen die dunklen Mächte anzukämpfen. Ein stechender Schmerz zuckte durch seinen Hinterkopf. Noch einmal konnte er seine Arme losreißen und mit dem Messer nach seinem unsichtbaren Feind stoßen, doch dann griff die Klaue des Dämons nach seinem Hirn und zog ihn in eine tintenschwarze Dunkelheit.
Edwin Carberry wischte sich den Schweiß von der Stirn und schüttelte nachdenklich den Kopf. Er hielt den Belegnagel in der rechten Pranke bereit, um jederzeit zum drittenmal zuschlagen zu können, wenn Duncan wieder aufwachen und mit seinem Messer herumfuchteln sollte.
Carberry wandte den Kopf und starrte Mac Pellew böse an.
„Was hast du dem armen Jungen wieder erzählt?“ fragte er grimmig. „Du weißt, daß er eine weiche Birne hat und nicht viel vertragen kann. Er faselt schon die ganze Zeit von Riesenkraken und Meerungeheuern, da brauchst du ihn nicht auch noch mit deiner Unkerei wild zu machen.“
„Ich hab’ kein Wort gesagt“, maulte Mac Pellew. „Keiner hat die Fresse aufgemacht. Er ist plötzlich hoch und hat mit dem Messer herumgefuchtelt, als wollte er den Mast absäbeln.“ Er wies auf die Decksplanken. „Da, sieh dir die Sauerei an. Er hat sein Essen einfach weggeschmissen.“
„Zu was anderem taugt das auch nicht“, brummte einer der Männer unter der Back, preßte aber schnell die Lippen aufeinander, als ihn der wütende Blick Carberrys streifte.
„Ihr haltet die Schnauze, verstanden?“ brüllte der Profos. „Ich werde euch zeigen, was los ist, wenn einer versucht, hier den wilden Mann zu markieren. Will sich noch einer beschweren von euch Affenärschen, wie, was?“
„Mäßigen Sie Ihre Worte, Carberry“, sagte eine näselnde Stimme vom Quarterdeck, und der Profos zuckte zusammen, als wäre eine Peitsche auf seinen Rücken geklatscht.
Carberry drehte sich langsam um. Das Kinn hatte er vorgeschoben. Seine rechte Hand zitterte. Er hatte Mühe, sich zurückzuhalten. Am liebsten hätte er dem geschniegelten Sir Thomas Doughty den Belegnagel mitten ins hochmütige Gesicht geschleudert.
Sir Thomas Doughty war auch nach endlosen Tagen der Flaute wie aus dem Ei gepellt. Er wußte, was sich für einen Gentleman gehörte. Der Spitzbart in seinem faltenlosen Gesicht, das er gegen allzu intensive Sonnenbestrahlung durch einen breitandigen Hut schützte, war sorgfältig gestutzt.
„Ich kann die Männer verstehen“, fuhr Doughty fort. „Auch mir geht diese Fahrt langsam auf die Nerven. Wer weiß, was uns noch alles erwartet, wenn wir erst einmal die Küste der Neuen Welt erreicht haben. Ich habe so allerlei gehört, aber ich will die Männer nicht noch mehr beunruhigen ...“
Er schwieg und wandte den Kopf, als er Schritte hinter sich hörte. Es war sein Bruder John.
„Ah, John“, sagte Doughty. „Diese bleierne Luft treibt mir den Schweiß auf die Stirn. Befiehl dem Pagen, mir Wasser zu holen.“
John Doughty nickte und verschwand. Sir Thomas schlenderte zur Backbordreling hinüber und warf einen Blick auf die anderen Schiffe, die nur ein paar hundert Yards voneinander entfernt träge im bewegungslosen Wasser lagen. Seine Augen verengten sich, als er Philip Hasard Killigrew auf dem Achterdeck der gekaperten portugiesischen Galeone stehen sah, die in „Isabella II.“ umbenannt worden war. Instinktiv hatte er vom Anfang ihrer Bekanntschaft an gespürt, daß er in dem schlanken, schwarzhaarigen Mann aus der Sippe der Killigrews aus Arwenack einen Feind hatte, den er nicht unterschätzen durfte.
Trotzdem war Sir Thomas sicher, diesen draufgängerischen Kraftprotz in den Sack stecken zu können. Killigrew hatte einen entscheidenden Fehler, der ihn immer wieder ins Hintertreffen bringen würde: Er war aufrichtig.
Sir Thomas Doughty verzog seine Lippen. Oh, er haßte diese Narren, die die Welt verbessern wollten. Was würde schon dabei herauskommen? Langeweile. Sonst nichts.
Was war ein Leben ohne Intrige, ohne hinterhältige Fallstricke seiner Feinde, die man rechtzeitig erahnen mußte, wenn man überleben wollte?
Doughty blickte kurz zur Tür hinüber, die vom Quarterdeck in den Gang führte, von dem man zu den Kammern der Offiziere gelangte. Der junge John Drake, der Neffe des Kapitäns, erschien mit einer Karaffe Wasser.
Drake ist ein anderer Gegner als Killigrew, dachte Doughty. Er ist skrupellos, wenn es um die Erreichung eines Zieles geht. Er würde nicht zögern, seinen besten Freund zu opfern. Ich muß mir einiges einfallen lassen, wenn ich ihn übertölpeln will.
„Ihr Wasser, Sir Thomas“, sagte der Page.
Doughty schaute den Jungen nicht einmal an. Er nahm das Glas und die Karaffe vom silbernen Tablett und goß sich Wasser ein. Er stellte die Karaffe zurück und hob das Glas an die Lippen. Aus den Augenwinkeln beobachtete er den Profos Carberry und die anderen Männer in der Kuhl, die immer noch um den bewußtlosen Johnnie Duncan herumstanden und zum Quarterdeck hochstarrten.
Wahrscheinlich haben sie meine Andeutungen über das, was sie an der Küste erwartet, noch nicht richtig verdaut, dachte er zufrieden.
Er trank einen Schluck, erstarrte plötzlich und spuckte das Wasser in hohem Bogen wieder aus. Sein Gesicht lief vor Wut rot an. Mit einer kurzen Handbewegung schüttete er den Rest des Glases dem Pagen ins Gesicht.
„Bist du von allen Geistern verlassen?“ rief er voller Empörung. „Wie kannst du es wagen, mir eine solche Brühe anzubieten? Mit diesem fauligen Zeug würde ich mich nicht einmal waschen! Das kannst du der Mannschaft zum Saufen geben, aber nicht mir, verstanden?“
John Drake stand belämmert da, verbeugte sich hastig und eilte davon. Er hörte das Gemurmel in der Kuhl, aber er war zu sehr mit sich selbst beschäftigt, als daß er begreifen konnte, was dort unten vor sich ging.
„Dieses elende Dreckschwein“, murmelte Patrick Evarts. „Den sollte man in einen dreckigen Lappen einwickeln und den Haien zum Fraß vorwerfen.“
„Den würden sie garantiert wieder ausspucken“, sagte Mac Pellew.
Das Murren der Leute wurde lauter. Jeder von ihnen hatte gesehen, daß das Wasser in der Karaffe um einiges sauberer gewesen war als das, was ihnen vorgesetzt wurde, und dieser hochnäsige Affe schüttete es dem jungen Drake in die Fresse und erklärte, er würde sich nicht mal mit dem Wasser, das die Mannschaft trinken mußte, waschen!
Carberry spürte die Wut, die seine Leute ergriffen hatte, fast körperlich. Wenn er nichts unternahm, würde es eine Meuterei geben. Zu lange hielt die Windstille sie schon in diesen Breiten. Die Untätigkeit trieb die Männer zu Handlungen, die sie unter normalen Umständen niemals begehen würden.
„Wer noch einmal behauptet, daß der ehrenwerte Sir Thomas ein elendes Schwein ist, wird ausgepeitscht, bis ihm die Haut in Fetzen herunterhängt!“ brüllte Carberry aus vollem Hals. „Ich werde euch zeigen, was sich für einen ehrlichen englischen Seemann gehört! Alle Mann in die Wanten! Überprüft sämtliche Spieren und Stags! Auf, ihr Himmelhunde, oder ich jage euch mit dem Belegnagel die Masten hoch!“
Das Schiff dröhnte unter den stampfenden Füßen der Männer. Ihre angespannten, vor Wut verzerrten Gesichter hatten sich gelöst. Mit grinsenden Gesichtern befolgten sie Carberrys Befehle, und die Seitenblicke, die sie zum Quarterdeck hinüberwarfen, waren eher offen als versteckt.
Sir Thomas Doughtys Gesicht war noch eine Idee bleicher als gewöhnlich. Voller Zorn starrte er den breitschultrigen Profos an, der seine Mütze vom Kopf gerissen hatte und sich ehrerbietig vor ihm verneigte, als hätte er ihm einen Ehrendienst erwiesen.
Sir Thomas durchschaute den Riesen, der den harmlosen Tölpel spielte, aber er würde ihm nichts nachweisen können. Der Profos hatte ihn lächerlich gemacht und seinen Plan, die. Männer zu einer Meuterei zu bewegen, ins Gegenteil gekehrt. Durch seine Bemerkung hatte der Profos alle Männer auf seine Seite gebracht.
Die Tür unter dem Achterdeck schwang auf.
Francis Drake kniff die Augen ein wenig zusammen und blickte in die Takelage, in der seine Männer wie Affen herumturnten. Er ging zu Doughty hinüber und blickte ihn eine Weile nachdenklich an.
„Sie sollten sich etwas zusammennehmen, Mister Doughty“, sagte er leise. „Die Männer sind schon nervös genug.“
„Das kann ich ihnen nicht verdenken“, sagte Doughty heftiger, als er es beabsichtigt hatte. „Statt mit den Afrikanern Handel zu treiben und Geld zu verdienen, lassen Sie sich auf ein Abenteuer ein, an dessem Ende nichts anderes als der Tod steht. Ich habe genausowenig Lust wie Ihre Leute, an einer fremden Küste von Eingeborenen getötet zu werden oder in einem Sturm mit dem Schiff unterzugehen.“
Francis Drake lächelte.
„Vor einem Sturm brauchen Sie im Moment wirklich keine Angst zu haben“, sagte er.
Er wandte sich von Doughty ab, um Carberry nach dem Grund zu fragen, weshalb er die Leute in der Takelage herumklettern ließ, als ein heller Schrei eines Mannes aus dem Großmars über das Schiff gellte.
„Schiff in Sicht! Backbord voraus!“
2.
Philip Hasard Killigrew glaubte nicht an Geister und Dämonen. Aber dieser schwarze Kasten, auf den seine Männer zupullten, jagte auch ihm einen leichten Schauer über den Rücken.
Die See war immer noch bleiern. Hasard fragte sich, wann diese verdammte Flaute endlich ein Ende nehmen wollte. Er hatte so etwas noch nie erlebt. Aus den alten Berichten der ersten Männer, die den Atlantik überquert hatten, ging hervor, daß ein ständiger, kräftiger Wind sie vorwärtsgetrieben hätte. Doch Nuno da Silva, der portugiesische Lotse, den Drake bei sich an Bord hatte, behauptete, diese Winde seien nördlicher anzutreffen. Hier, nur ein paar Grade nördlich des Äquators, sei eine windlose Zone, die die Portugiesen und Spanier möglichst mieden.
Hasard fragte sich, warum Drake in diese Zone gesteuert war. Hatte er den Worten des portugiesischen Lotsen keinen Glauben geschenkt? Hasard mußte zugeben, daß auch er nicht an diese windlose Zone geglaubt hätte, wenn er sie jetzt nicht selbst erlebt hätte.
Die schwarze Galeone war immer noch eine Kabellänge von ihnen entfernt. Hasard trieb seine Männer nicht an. Sie hatten Zeit. Es sah nicht so aus, als würde sich die Wetterlage in den nächsten Stunden ändern.
Die schwarze Galeone war voll getakelt, und doch hatte es den Anschein, als hätte sich seit Tagen niemand mehr um die Segel gekümmert. Nirgends war ein Zeichen von Leben zu entdecken. Falls es Menschen auf der schwarzen Galeone gab, dann mußten sie die anderen Schiffe doch ebenfalls gesehen haben!
Hasard schüttelte sich bei dem Gedanken daran, daß die Mannschaft der Galeone vielleicht von einer Krankheit dahingerafft worden war. Sie mußten sehr vorsichtig sein, sonst holten sie sich die Pest noch auf das eigene Schiff.
Die „Pelican“ war neben der „Isabella II.“ am dichtesten zur schwarzen Galeone aufgeschlossen. Hasard hörte die mächtige Stimme Carberrys, der die Rudergasten anbrüllte, sie sollen gleichmäßiger pullen. Nur langsam schoben sich die Schiffe, die an den Schleppleinen der Boote hingen, durch das glatte Wasser, das die Farbe einer saftigen Wiese hatte.
Hasard kniff die Augen zusammen. Drakes Auftrag, die schwarze Galeone zu entern, behagte ihm immer weniger. Vielleicht hätten sie lieber mit der „Isabella II.“ dicht an die schwarze Galeone heranfahren sollen, um von den Masten aus auf das Deck des unheimlichen Schiffes blicken zu können.
Sechs Männer hatte Hasard in seinem Boot. An Steuerbord saßen Batuti, Stenmark und Matt Davies, an Backbord Dan O’Flynn, Smoky und Ferris Tucker. Im Gegensatz zu Hasard, der steuerte, mußten sie den Kopf wenden, um zur Galeone hinüberblicken zu können.
Hasard erkannte an ihren angespannten Gesichtern, daß sie mit dem Befehl Drakes, die schwarze Galeone zu entern, genauso unzufrieden waren wie er selbst. Andererseits schienen sie froh zu sein, daß endlich wieder einmal etwas los war, das sie aus dem ewigen Einerlei herausriß.
Hasard war froh, diese Männer um sich zu wissen. Die Zeit, die sie zusammen an Bord ihrer ersten „Isabella“ verbracht hatten, hatte sie zu einer Gemeinschaft zusammengeschweißt, die auch nicht zerbrach, wenn sie dem Tod von Angesicht zu Angesicht gegenüberstanden.
Hasard wußte von Tim Brewer, was auf den anderen Schiffen des kleinen Geschwaders vor sich ging. Die Männer wurden langsam verrückt vor Angst. Sie hatten beim Auslaufen in der Heimat geglaubt, sie würden zu einer Handelsreise nach Ägypten aufbrechen, und nun segelte Francis Drake mit ihnen in eine unbekannte Welt, in der Dämonen und Ungeheuer nur darauf warteten, sie zu verschlingen.
Philip Hasard Killigrew hatte seine Mannschaft darauf eingestellt, daß dieses Unternehmen alles andere als eine Vergnügungsreise werden würde. Sie gingen ein großes Risiko ein, doch dieses Risiko war kalkuliert.
Gewiß, sie konnten einem Sturm zum Opfer fallen oder von feindlichen Eingeborenen, die bereits mit den Spaniern oder Portugiesen üble Erfahrungen gesammelt hatten, getötet werden. Vermutlich würden sie auch Kämpfe mit spanischen Schiffen auszufechten haben, aber das war schließlich der Sinn der Reise. Und eins war auch klar: Wer diese Reise lebend überstand, würde als reicher Mann nach England heimkehren.
Tim Brewer, der junge Trompeter Drakes, hatte Hasard von Sir Thomas Doughtys Stänkereien an Bord der „Pelican“ berichtet. Es hatte Hasard nicht überrascht. Er ahnte, daß Doughty nur aus einem bestimmten Grund an dieser Reise teilgenommen hatte: um sie zu verhindern. Aber wie sollte er seine Vermutung beweisen? Konnte er vor Francis Drake treten und Sir Thomas verdächtigen? Nein, Drake würde ihn einen Narren nennen. Dabei wußte Drake so gut wie jeder andere, daß Thomas Doughty enge Beziehungen zu Lord Burghley hatte, und der Lordschatzkanzler gehörte zu denen, die der Königin immer wieder davon abrieten, Spanien zu verärgern.
Drakes Reise war mehr als eine Ohrfeige für den spanischen König. Sie war eine offensichtliche Provokation. Und da sollte Sir Thomas tatenlos zusehen?
Hasard konnte es einfach nicht glauben. Er wünschte nur, Francis Drake würden die Augen aufgehen, bevor es zu spät für ihn und sein kleines Geschwader war.
Hasard schreckte aus seinen Gedanken, als Smoky ins Wasser spuckte und sagte: „Das stinkt verdammt nach Rabenfraß. Der Teufel soll mich holen, wenn die Kerle auf dem schwarzen Kasten nicht schon alle am Verfaulen sind.“
Unheimlich und drohend ragte die schwarze Bordwand vor dem kleinen Boot von der „Isabella II.“ auf. Obwohl kein Windhauch zu verspüren war, hatte auch Hasard einen scharfen Geruch in der Nase, der nur von der Galeone stammen konnte. Er befahl den Männern, um die Galeone herumzupullen. Vielleicht entdeckten sie an Steuerbord etwas, das ihnen Aufschluß über das geheimnisvolle Schiff geben konnte.
Hasard legte beide Hände an den Mund und formte einen Trichter.
„Holla, Deck!“ schrie er. „Was ist los mit euch? Zeigt euch, oder wir verpassen euch eine Breitseite!“
Nichts rührte sich.
Oder doch?
Hasard war es, als hätte er einen schwarzen Schatten hinter einer der Geschützpforten gesehen, die halb hochgezogen war.
Hatte die Besatzung der schwarzen Galeone sie überlistet? Würden gleich die Kanonen ausfahren und sie mit ihren tödlichen Ladungen in Stücke schießen?
Hasard zog für einen Moment den Kopf zwischen die Schultern, doch nichts geschah. Die Stille war so absolut wie vorher. Hasard lauschte auf Schritte. Nichts.
„Batuti und Dan“, sagte Hasard mit heiserer Stimme. „Seht nach, was auf dem Kahn los ist. Wenn ihr Tote seht, faßt sie nicht an, ist das klar?“
Die beiden nickten. Der große Schwarze ließ sein schneeweißes Gebiß sehen, doch seine gräuliche Gesichtsfarbe zeigte Hasard, daß Batuti sich vor den Schiffsdämonen fürchtete.
Mit ein paar kräftigen Schlägen pullen die anderen das Boot an die Bordwand der schwarzen Galeone. Batuti und Dan griffen nach den Berghölzern, turnten zum Schanzkleid der Kuhl hoch und schoben vorsichtig ihre Köpfe in die Höhe.
Der Gestank nahm Dan O’Flynn und Batuti schon den Atem, bevor sie über das Schanzkleid schauen konnten. Dann fielen ihre Blicke auf das Deck.
Dan O’Flynn war plötzlich grün im Gesicht. Was er dort sah, drehte ihm den Magen um.
Neben dem Großmast lagen drei leblose Menschenkörper, von denen teilweise nur noch die Knochen übrig waren. Die Decksplanken waren mit dunklen Flecken übersät. Es war das getrocknete Blut der Toten. Und in diesen dunklen Flecken waren Spuren zu erkennen, wie Dan O’Flynn sie noch nie gesehen hatte.
Trotz der Übelkeit, die in seinem Inneren rumorte, nahm Dan sich ein Herz und wollte sich über das Schanzkleid schwingen, um diesem fürchterlichen Geschehen auf den Grund zu gehen. Krampfhaft hielt er sein kurzes gebogenes Entermesser in der Faust, um jeden Augenblick zuschlagen zu können, wenn ihn das Untier anfallen sollte, das dieses Massaker angerichtet hatte.
Dan hatte das linke Bein gerade über das Schanzkleid gelegt, als er den fürchterlichen Schrei Batutis hörte.
Er zuckte zusammen und riß den Kopf herum. Er spürte, wie ihn eine Faust mit ungeheurer Gewalt auf der Brust traf. Mit der freien Linken wollte er sich am Schanzkleid festklammern, doch der Fausthieb Batutis fegte ihn mit der Gewalt eines Brechers von der Bordwand.
Im Fallen sah Dan einen schlanken schwarzen Schatten auf die Stelle zufliegen, an der er sich eben noch befunden hatte. Er hörte das wilde Fauchen des Dämons und sah den weißschimmernden Fang.
Dann klatschte er mit dem Rücken aufs Wasser und ruderte wild mit den Armen, um wieder an die Oberfläche zu gelangen. Neben ihm tauchte prustend Batuti auf. Riemen streckten sich ihnen entgegen.
Dan hörte die Männer im Boot brüllen. Stenmark hielt eine Muskete in der rechten Faust und hob sie an die Schulter. Krachend entlud sich die Waffe und hüllte die Männer im Boot in eine Pulverdampfwolke.
„Hast du getroffen?“ brüllte Smoky.
Stenmark hob die Schultern, während er die Muskete hastig nachlud.
Hasard hatte seine Pistole aus dem Gürtel gerissen. Mit lauter Stimme befahl er, das Boot von der schwarzen Galeone wegzupullen.
„Was sind das für Biester?“ fragte er Batuti.
Der Gambia-Neger hatte seinen Schrecken noch nicht überwunden.
„Panther“, sagte er keuchend. „Schwarze Panther. In ihnen steckt der Geist des Bösen. Es sind Mörder, die keine Ruhe finden und ewig auf den Tod warten müssen ...“
Hasard schnitt ihm mit einer heftigen Handbewegung das Wort ab. Er hatte auf dieser Reise schon genug Unfug über Geister und Dämonen gehört. Es fehlte noch, daß seine eigenen Männer auch noch daran zu glauben anfingen.
Stenmarks Schuß schien die schwarzen Raubkatzen hochgeschreckt zu haben. Hasard zählte insgesamt vier Stück. Sie schlichen geschmeidig über die Decks, die Schanzkleider und über das Vor- und Achterkastell. Eine der Katzen sprang am Großmast empor, krallte sich in das Holz und glitt ein paar Fuß hinauf.
Aus dem Mars ertönte ein helles, ängstliches Schreien, das sofort verstummte, als die Raubkatze den Versuch, den glatten Mast hinaufzuklettern, aufgab.
Smoky wies mit der Hand nach oben.
„Da, im Mars!“ rief er. „Ein Affe! Den haben die Biester nicht erwischt.“
Dan O’Flynn hatte den Kampf gegen die Übelkeit in seinem Magen verloren. Er beugte sich über das Dollbord und übergab sich. Keuchend und mit Tränen in den Augen erhob er sich wieder, nachdem das konvulsivische Zucken seines Magens aufgehört hatte.
„Sie sehen fürchterlich aus, Hasard“, sagte er leise. „Sie haben die Männer stückchenweise gefressen. Die ganze Kuhl schwimmt von ihrem Blut. Sie haben bestimmt niemanden am Leben gelassen.“
Hasard schüttelte den Kopf. Er konnte sich nicht erklären, wieso diese Raubkatzen überhaupt an Bord eines Schiffes gelangen konnten.
„Pullt gleichmäßig, ihr Affenärsche!“
Die laute Stimme Carberrys zitterte vor unterdrückter Wut.
Hasard drehte sich um. Die „Pelican“ war inzwischen auf eine halbe Kabellänge herangepullt worden. Die Rudergasten im Boot hatten natürlich gesehen, wie sich die Männer auf der Back der „Pelican“ bekreuzigten, und hatten die Köpfe gedreht, um zu sehen, was bei der schwarzen Galeone geschehen war.
Hasard sah die vornehmen Herren auf dem Achterdeck der „Pelican“, die dort herumstolzierten wie die Pfauen, als befänden sie sich auf einem Gartenfest in London. Ein Grinsen huschte über Hasards Züge, als er die bleichen Gesichter der Lords sah. Einige von ihnen verschwanden wieder unter Deck. Ihre Nerven hielten einer solchen Belastung wohl nicht stand.
„Schießen Sie die Bestien ab, Killigrew!“
Hasard nickte. Er hatte nur auf den Befehl Drakes gewartet. Er wies Stenmark und Ferris Tucker an, die schwarzen Panther abzuknallen, sobald sie sich zeigten.
Minuten später peitschten die ersten Schüsse durch die bleierne Luft. Eine der Raubkatzen schrie. Sie hieb mit den Pranken durch die Luft, als wolle sie einen unsichtbaren Feind abwehren. An ihrer rechten Seite bildete sich auf dem schwarzen Fell ein großer, feucht glänzender Fleck aus.
„Du hast sie getroffen, Ferris!“ sagte Matt Davies voller Genugtuung.
„Sie ist aber noch nicht tot“, erwiderte Ferris Tucker brummend. „Die Bestien sind anscheinend nicht totzukriegen.“
Hasard ließ wieder ein wenig näher an die schwarze Galeone heranpullen. Stenmark hatte bereits wieder geladen. Als er eine weitere Katze auf das Schanzkleid springen sah, riß er die Muskete hoch, zielte kurz und drückte ab.
Die Raubkatze vollführte einen Satz, der die Männer in Erstaunen versetzte. Sie sprang mindestens acht Fuß hoch. Ihre scharfen Krallen waren weit herausgestreckt, aber sie schafften es nicht, Halt in der Bordwand zu finden.
Klatschend schlug der schlanke Leib des Panthers aufs Wasser, das sich sofort rot färbte. Durch den Pulverdampf sah Hasard, daß die Katze am Kopf getroffen war.
Das Tier war nicht tot. Es schien einen Moment zu überlegen, ob es an der Bordwand wieder hinaufklettern solle, aber dann richteten sich die glühenden grünen Augen auf das Boot, in dem Hasard stand.
Batuti schrie auf. Er wich zum Dollbord zurück. Das Boot begann zu schwanken. Matt Davies hieb mit seinem Eisenhaken zu. Die Glocke über der Ledermanschette traf Batuti am Hinterkopf. Lautlos sackte er zusammen. Matt Davies fing ihn auf und legte ihn zwischen zwei Duchten.
Die Pistole in Hasards Hand krachte. Er sah sofort, daß er die Raubkatze verfehlt hatte. Dan O’Flynn hieb mit einem Riemen auf den Panther ein, doch die Katze krallte sich mit den Pranken im Holz des Riemens fest.
Ferris Tucker hatte seine Muskete umgedreht und versuchte den Kopf der Bestie zu treffen. Er schlug vorbei, und beinahe hätte die Wucht des Schlages ihn über Bord gerissen. Das Boot schwankte wieder stark.
Der schwarze Panther schnellte sich hoch, rasend vor Wut, Schmerz und Blutgier. Matt Davies’ Haken zuckte vor und schlug in den Nacken der Bestie. Stenmark stieß mit dem Messer zu und traf die Raubkatze im Hals. Smoky hatte endlich die dritte Muskete schußbereit und feuerte sie ab, als er meinte, den Kopf des Panthers genau vor der Mündung zu haben.
Der Rückstoß der Muskete warf Smoky gegen Stenmark, der das Gleichgewicht verlor und sich krachend auf eine Ducht setzte.
Hasard klammerte sich fest.
Die Bestie schrie ihren Schmerz hinaus. Es hörte sich an wie der Todesschrei eines Menschen. Dann endlich hielt Hasard seine zweite Pistole in der Hand und jagte die Kugel der Bestie genau zwischen die Augen.
Wie von einer unsichtbaren Faust gestoßen, klatschte das Tier ins Wasser zurück. Es war fürchterlich zugerichtet. Langsam sackte der Kadaver weg, und nur ein großer roter Fleck blieb auf dem Wasser zurück.
Hasard befahl Stenmark und Ferris Tucker, auch den vierten Panther abzuschießen, und nachdem sie eine Viertelstunde auf ihre Chance gewartet hatten, gelang es ihnen schließlich.
Batuti wachte stöhnend auf und befühlte die Beule an seinem Hinterkopf. Er schien genau zu wissen, wem er das Ding zu verdanken hatte, denn er drehte sich zu Matt Davies um und zeigte ihm die Zähne.
„Warum hast du geschlagen?“ fragte er böse.
„Du warst doch dabei, vor lauter Angst in die Hose zu scheißen und unser Boot zum Kentern zu bringen, Mann“, sagte Matt Davies grinsend. „Ich hab’ gedacht, ich tu dir einen Gefallen.“
Batuti grollte. Seine großen Hände öffneten und schlossen sich. Es sah aus, als wolle er Matt Davies jeden Augenblick an die Gurgel springen.
Hasard beendete den Streit mit einer heftigen Handbewegung. Er blickte hinüber zum Achterdeck der „Pelican“. Sir Thomas Doughty redete ununterbrochen auf Francis Drake ein. Der Kapitän hatte die Hände auf dem Rücken verschränkt.
Hasard hätte zu gern gewußt, was dort auf dem Achterdeck gesprochen wurde. Aber es war müßig, darüber nachzudenken. Er hatte etwas anderes zu tun. Noch bestand der Befehl Drakes, die schwarze Galeone zu entern.
Er befahl den Männern, dicht an die Bordwand heranzupullen.
„Batuti und ich gehen an Deck“, sagte er. Er reichte Stenmark seine beiden Pistolen, damit der Schwede sie nachlud. Dann schlug das Boot mit dumpfem Laut gegen den Rump der Galeone.
„Achtet auf die letzte Katze“, sagte Ferris Tucker. „Sie ist nur verwundet, und in diesem Zustand sollen Raubkatzen besonders gefährlich sein.“
Hasard nickte. Er nahm die geladenen Pistolen von Stenmark in Empfang und schob sie sich in den Gürtel. Er griff nach den Berghölzern und war mit wenigen Klimmzügen oben auf dem Schanzkleid. Er blickte sich nicht nach Batuti um. Er wußte, daß der Schwarze ihm in die Hölle folgen würde, auch wenn seine Angst noch so groß war.
Durch die Erzählung Dan O’Flynns war Hasard vorgewarnt. Das Bürschchen hatte nicht übertrieben. Dieser Anblick konnte einem den Magen umdrehen.
Hasard versuchte nicht auf die drei verstümmelten Leichname zu blikken. Seine Augen huschten über die Kuhl und über die Back, wo der verwundete Panther verschwunden war.
Er zog eine Pistole aus dem Gürtel und machte sie schußbereit. Er wandte kurz den Kopf und blickte Batuti an, der ein grimmiges Gesicht zog und sich bemühte, seine Angst vor den bösen Geistern nicht zu zeigen.
„Bleib hier an Backbord“, sagte Hasard. „Ich gehe hinüber nach Steuerbord. Wenn mich nicht alles täuscht, hat sich die Bestie unter der Back verkrochen.“
Batuti nickte. Er wollte „Aye, aye, Sir“ sagen, aber kein Ton drang über seine Lippen. Seine Zunge fühlte sich an wie ein pelziger Ball.
Hasard glitt geschmeidig vom Schanzkleid und überquerte die Kuhl mit wenigen Sätzen. Hinter dem Beiboot, das in der Mitte der Kuhl auf der großen Gräting lag, stockte er einen Sekundenbruchteil.
Schaudernd wandte er sich ab. Hier lagen zwei weitere Männer, von denen nicht viel mehr als die Knochen übriggeblieben waren. Sein Blick glitt zur Kuhl hinüber. Auch dort das gleiche grausige Bild. Die vier schwarzen Teufel hatten auf diesem Schiff gewütet, wie es schlimmer nicht sein konnte.
Kalter Schweiß stand auf Hasards Stirn. Er hörte das Kreischen aus dem Großmars und hob den Kopf.
Nur aus den Augenwinkeln sah er den schwarzen Schatten auf sich zufliegen. Batuti stieß einen heiseren Schrei aus.
Hasard warf sich zur Seite.
Kurz bevor der schwarze Panther ihn erreichte, zuckte der schlanke Leib zusammen. Hasard sah das Messer, das Batuti geworfen hatte, aus dem Leib der Bestie ragen.
Nur haarscharf fegten die Krallen der Raubkatze an seinem Gesicht vorbei. Hasard vermeinte den Lufthauch zu verspüren und roch den fauligen Atem des Tieres. Der Schweif der Katze peitschte durch sein Gesicht.
Tasuta katkend on lõppenud.