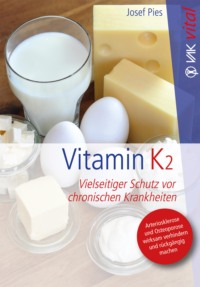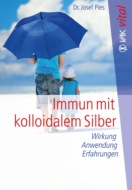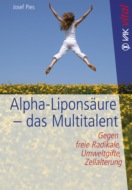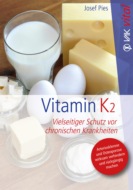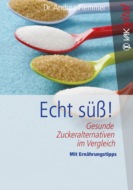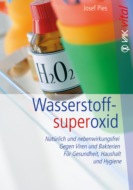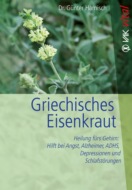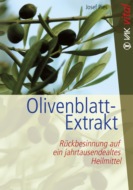Loe raamatut: «Vitamin K2»
Dr. Josef Pies
Vitamin K2
Vielseitiger Schutz vor chronischen Krankheiten

VAK Verlags GmbH
Kirchzarten bei Freiburg
Vorbemerkung des Verlags
Dieses Buch dient der Information über Möglichkeiten der Gesundheitsvorsorge und Selbsthilfe. Wer sie anwendet, tut dies in eigener Verantwortung. Autor und Verlag beabsichtigen nicht, Diagnosen zu stellen und Therapieempfehlungen zu geben. Die Informationen in diesem Buch sind nicht als Ersatz für professionelle medizinische Behandlung bei gesundheitlichen Beschwerden zu verstehen.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten
sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
VAK Verlags GmbH
Eschbachstraße 5
79199 Kirchzarten
Deutschland
© VAK Verlags GmbH, Kirchzarten bei Freiburg 2012
Lektorat: Nadine Britsch
Abbildungen: S. 8, 29, 34, 40, 43, 51, 62, 64, 68, 86, 88, 92, 108, 112 © Microsoft ClipArt;
S. 57 © Uwe Muell, S. 95 © Ogawa Kazumasa, S. 48 © verändert nach Armin Kübelbeck,
S. 95 © Bakkai (oben), S. 95 © Gleam (unten), alle Wikipedia; Rest: © Josef Pies
Umschlagdesign: Hugo Waschkowski, Freiburg
Umschlagfoto: © Photocrew – fotolia.com
Reihenlayout: Karl-Heinz Mundinger, VAK
Satz: Goar Engeländer, www.dametec.de
Druck: MediaPrint GmbH, Paderborn
Printed in Germany
ISBN 978-3-86731-102-1 (Paperback)
ISBN 978-3-95484-068-7 (ePub)
ISBN 978-3-95484-069-4 (Kindle)
ISBN 978-3-95484-070-0 (PDF)
Inhalt
Vorwort
Vitamin K2 – früh entdeckt und über Jahrzehnte vergessen
Begriffsklärung
Woher kommt Vitamin K?
Ein Aktivierungsprinzip mit unterschiedlichen Folgen
Rückgewinnung von Vitamin K im Vitamin-K-Epoxid-Zyklus
Die Rolle von Vitamin K1 bei der Blutgerinnung
Gerinnungshemmer und Vitamin K
Osteoporose, Arteriosklerose und das Kalzium-Paradoxon
Die Bedeutung von Vitamin K2 für gesunde Knochen
Die Bedeutung von Vitamin K2 für die Zahngesundheit
Vitamin K2 und Herzgesundheit
Vitamin K2 und Krebserkrankungen
Vitamin K2 und Nierenerkrankungen
Vitamin K im Alter
Vitamin K2 bei weiteren Krankheiten
Lebensmittel als Quelle von Vitamin K2
Aufnahme und Verteilung von Vitamin K
Vitamin-K-Mangel
Bin ich Vitamin K2 unterversorgt? Ein Selbsttest
Ernährungsempfehlungen
Nebenwirkungen, Wechselwirkungen, Überdosierungen
Glossar
Literatur
Zum Schluss
Über den Autor
Vorwort
Wenn überhaupt, dann verbindet man mit Vitamin K normalerweise den Begriff Blutgerinnung. So erging es auch mir lange Zeit, bis ich mich intensiver mit dem Thema befasste. Schnell wurde mir klar, dass Vitamin K1 und Vitamin K2 zwar eng miteinander verwandt sind, aber völlig unterschiedliche Hauptaufgaben in unserem Körper übernehmen. Ich vertiefte mich mit gesteigertem Interesse in die aktuelle Literatur und ließ mich tragen von der Faszination neuer Erkenntnisse – insbesondere zur Bedeutung von Vitamin K2. Dabei muss man wissen, dass bis vor Kurzem nur selten zwischen den beiden Varianten unterschieden wurde, und häufig geschieht das auch heute noch nicht. Auch Wissenschaftler beginnen gerade erst damit, in Studien genauer zwischen den ungleichen Zwillingen zu unterscheiden. Das ist ein Grund dafür, dass frühere Studienergebnisse manchmal unverständlich und schwer interpretierbar sind.
Während Vitamin K1 in der Tat vornehmlich eine wichtige Rolle bei der Blutgerinnung spielt, liegt die Hauptaufgabe von Vitamin K2 in der Regulierung des Kalziumhaushalts. Damit fällt ihm eine bedeutende Rolle für gesunde Knochen und gesunde Zähne zu. Andererseits verhindert es aber auch Kalziumablagerungen in Blutgefäßen und anderen Weichteilen (Weichgewebe). Ein Vitamin-K2-Mangel trägt daher unter anderem zu Osteoporose und Arterienverkalkung (Atherosklerose /Arteriosklerose) bei. Die ausreichende Zufuhr dieses Vitamins kann hingegen vor diesen Krankheiten und ihren Folgen schützen, wie Knochenbrüchen und Herzinfarkt. Es ist sogar möglich, die Kalkeinlagerungen in den Blutgefäßen in gewissem Umfang mithilfe von Vitamin K2 wieder rückgängig zu machen und die Mineralisierung der Knochen bei Osteoporose zu verbessern.

Das sind aber nur zwei Aspekte dieses lebensnotwendigen Stoffes. Vitamin K2 hat auch eine noch wenig erforschte Bedeutung bei vielen Alterskrankheiten und Krebs. Außerdem ist es wichtig für die Fruchtbarkeit von Mann und Frau.
Zwar überschneiden sich die Aufgaben von Vitamin K1 und Vitamin K2 leicht, ihre Unterschiede sind aber bedeutend. Ein Mangel an Vitamin K1 ist eher selten, hat aber unmittelbare Folgen, nämlich eine erhöhte Blutungsneigung. Ein Vitamin-K2-Mangel ist hingegen weitverbreitet, macht sich aber erst langfristig bemerkbar, beispielsweise durch Knochenbrüche infolge eines zunehmenden Knochenabbaus oder durch einen Herzinfarkt infolge schleichender Arterienverkalkung.
Warum das so ist und was es mit dem sogenannten „Kalzium-Paradoxon“ auf sich hat, das wird in den folgenden Kapiteln erläutert. Aber auch die vielen anderen Aspekte rund um das ungleiche Vitaminpaar K1 und K2 werden erläutert.
Wie erwähnt, sind viele Erkenntnisse brandneu und das Wissen – insbesondere um die Bedeutung von Vitamin K2 –, ist aktuell sehr stark im Fluss. Deshalb kann ein Buch zu diesem Thema in einigen Teilen unter Umständen schon überholt sein, wenn es erscheint. Das gilt auch für den vorliegenden Titel. Trotzdem sind Autor und Verlag sehr zuversichtlich, Ihnen ein gutes Verständnis für das altbekannte Vitamin K1 und seinen Zwilling, das faszinierende Vitamin K2, vermitteln zu können. Auch sind wir sicher, dass nach Lektüre des Buches Ihr Blick für solche Lebensmittel geschärft sein wird, die den Bedarf an Vitamin K2 decken helfen. Ganz sicher wird das Thema in den nächsten Jahren noch stärker an Bedeutung gewinnen und Gegenstand weiterer wissenschaftlicher Untersuchungen sein. Zugleich wird es immer stärker in das öffentliche Bewusstsein rücken. Wenn Sie dieses Buch gelesen haben, werden Sie hierauf vorbereitet sein und das notwendige Verständnis mitbringen, neue Erkenntnisse bewerten und einordnen zu können.
Ich danke dem VAK-Verlag sehr herzlich für die Idee zu diesem Buch. Frau Nadine Britsch hat die Realisierung wieder einmal sehr professionell und engagiert als Lektorin begleitet. Ihr danke ich für die sehr konstruktive und angenehme Zusammenarbeit.
Dr. Josef Pies
Vitamin K2 – früh entdeckt und über Jahrzehnte vergessen
Manchmal liegt die Wahrheit zum Greifen nah und doch dauert es Jahrzehnte, bis sie erkannt wird. So verhält es sich auch mit der Entdeckungsgeschichte von Vitamin K2. Zwar wurden Vitamin K1 und K2 mehr oder weniger gleichzeitig in den 1930er-Jahren entdeckt. Die Wissenschaft betrachtete beide jahrzehntelang aber nur als zwei unterschiedliche Varianten desselben Vitamins mit ein und derselben Funktion, nämlich der Regulierung der Blutgerinnung. Während die Beschäftigung mit Vitamin K1 eine Lawine von Forschungen nach sich zog und 1943 zur Verleihung des Nobelpreises führte (zur Entdeckung von Vitamin K1 vgl. beispielsweise ausführlich Suttie 2009), blieb die zweite Entdeckungsgeschichte bis heute weitgehend unbeachtet (zur Entdeckung von Vitamin K2 vgl. ausführlich Masterjohn 2009 und Rhéaume-Bleu 2012). Erst allmählich beginnt man zu verstehen, dass sich die Aufgaben der beiden Vitamine K1 und K2 ganz wesentlich unterscheiden und nur leicht überschneiden.
Da Vitamin K2 von der Wissenschaft jahrzehntelang sehr stiefmütterlich behandelt wurde, wird in vielen Veröffentlichungen meistens pauschal von Vitamin K gesprochen, auch wenn sich nach heutigem Wissensstand manche Aussagen eher auf Vitamin K2 beziehen. Das erschwert die Interpretation früherer Studienergebnisse oft sehr, was sich auch in diesem Buch wiederspiegelt. In solchen unklaren Fällen wird in den folgenden Kapiteln dann ganz bewusst nur von Vitamin K gesprochen.
Vitamin K1 – Wissenschaftlicher Wettlauf im Labor
Den ersten Hinweis auf Vitamin K fand der dänische Wissenschaftler Henrik Carl Peter Dam (1895–1976) im Jahr 1934 bei seinen Forschungen zum Cholesterinstoffwechsel bei Hühnern. Dabei entdeckte er eine Mangelerkrankung, die tödliche Blutungen der Haut und der Muskeln auslöst (Dam 1934). Er erkannte, dass die gestörte Blutgerinnung (Details zur Blutgerinnung vgl. Kapitel Die Rolle von Vitamin K1 bei der Blutgerinnung) seiner Versuchstiere auf das Fehlen eines bis dahin noch nicht bekannten fettlöslichen Vitamins zurückging. Er nannte es Vitamin K (Dam 1935), weil dies der erste Buchstabe im Alphabet ist, nach dem noch kein Vitamin benannt worden war und weil es der Anfangsbuchstabe des Wortes „Koagulation“ (Blutgerinnung) ist.
Dams Entdeckung löste einen wahren Boom an wissenschaftlichen Veröffentlichungen verschiedener Arbeitsgruppen über Vitamin K aus (vergleiche Suttie 2009). Damals kannte man aus der großen Schar der an der Blutgerinnungskaskade beteiligten Proteine und anderen Faktoren nur das Prothrombin und das Fibrinogen.
Erst allmählich beginnt man zu verstehen, dass sich die Aufgaben der beiden Vitamine K1 und K2 ganz wesentlich voneinander unterscheiden.
Schon Anfang der 1940er-Jahre wusste man, dass sich die bei manchen Neugeborenen auftretende lebensbedrohliche Blutungsneigung (Morbus haemorrhagicus neonatorum) durch die Gabe von Vitamin K behandeln lässt (vgl. Kapitel Vitamin-K-Mangel). Anfang der 1950er-Jahre konnte die Bedeutung der Vitamin-K-abhängigen Gerinnungsfaktoren VII, IX und X nachgewiesen werden. Zwanzig Jahre später wurde die Bedeutung von Vitamin K als Cofaktor bei der Aktivierung von Proteinen erkannt (vgl. Kapitel Ein Aktivierungsprinzip mit unterschiedlichen Folgen) und weitere fünf Jahre später wurden weitere, von Vitamin K abhängige Eiweiße entdeckt.
Wie erwähnt, hatte 1939 ein Wettlauf in der Entdeckung des neuen Vitamins eingesetzt und verschiedene Arbeitsgruppen versuchten, sich bei der Isolierung und der chemischen Analyse und Beschreibung zu übertreffen. Als Quelle für Vitamin K dienten die Futterpflanze Luzerne (Alfalfa) und gereinigtes Fischmehl. Zwar erkannte man schon damals einen Unterschied in dem gelben Öl aus der Luzerne (Vitamin K1) und dem kristallinen Fischmehlextrakt (Vitamin K2), aber noch jahrzehntelang wurde dies weitgehend ignoriert beziehungsweise nur unzureichend differenziert. Außerdem hatte man aus Bakterien (Mycobacterium tuberculosis) Phthiol isoliert, das ebenfalls blutungsstillend wirkt. Auf die Bedeutung von Bakterien für die Bildung von Vitamin K2 kommen wir später noch ausführlich zurück (vgl. Kapitel Woher kommt Vitamin K?).
Besonders herausragend auf dem Gebiet der Vitamin-K-Forschung waren der Entdecker Carl Peter Henrik Dam (1895–1976), Edward Adalbert Doisy (1893–1986) und Herman James Almquist (1903–1994). Allerdings wurden nur die Leistungen von Dam „für die Entdeckung von Vitamin K“ und von Doisy „für seine Entdeckung der chemischen Natur von Vitamin K“ 1943 mit der Verleihung des Nobelpreises für Physiologie bzw. Medizin gewürdigt.
Häufig wird nicht ausreichend zwischen Vitamin K1 und Vitamin K2 unterschieden.
Seit den 1960er- und 1970er-Jahren gelang es dann zunehmend, Funktion und Wirkungsweise von Vitamin K (vorwiegend Vitamin K1) aufzudecken. Und dieser Erkenntnisprozess dauert noch bis heute an. Wie erwähnt, wurde und wird häufig nicht ausreichend zwischen Vitamin K1 und Vitamin K2 unterschieden, obwohl man schon 1939 beide Varianten kannte (Thayer et al. 1939).
Vitamin K2 – Empirische Grundlagenforschung eines Zahnarztes
Ganz neu ist auch die Erkenntnis, dass die Beobachtungen und Schlussfolgerungen des niedergelassenen Zahnarztes Dr. Weston Andrew Valleau Price (1870–1948) ebenfalls mit Vitamin K, nämlich mit Vitamin K2, in Zusammenhang stehen.
Price, der „Charles Darwin der Ernährung“, stammte aus Newburgh, Ontario, und praktizierte seit etwa 1890 fünfzig Jahre lang in Cleveland, Ohio, als Zahnarzt. Er untersuchte die Ursache von Karies und chronischen Erkrankungen (vgl. hierzu Masterjohn 2009, Price 2010, Price 2011 und Rhéaume-Bleu 2012). Dafür bereiste er zusammen mit seiner Ehefrau die ganze Welt, um insbesondere den Einfluss von bearbeiteter „moderner“ Nahrung auf Karies und andere Zivilisationskrankheiten zu erforschen. Auf seinen teils abenteuerlichen Expeditionen machte er beispielsweise die Erfahrung, dass Menschen in weitgehend unbeeinflussten Gegenden mit noch natürlichen Ernährungsgewohnheiten ein tadelloses Gebiss und symmetrische, ausgewogene Gesichtszüge und Gesichtsproportionen aufwiesen. Kamen solche Naturvölker jedoch mit der Zivilisation in Berührung und stellten sie ihre Ernährung auf stark bearbeitete Nahrungsmittel um, verloren sie ihre natürliche Widerstandskraft und die ab diesem Zeitpunkt geborenen Kinder zeigten nicht mehr die ausgewogenen Gesichtszüge ihrer Eltern, sondern starke Fehlstellungen der Zähne.
Diese Fehlstellung lässt sich dadurch erklären, dass es durch Mangelernährung (Mangel an Vitamin K2) zu einer falschen Knochenbildung kommt. Infolgedessen haben die Kiefer zu wenig Platz für den kompletten Satz von Zähnen, sodass diese um das knappe Platzangebot konkurrieren müssen und sich teilweise voreinander schieben.
Heute lassen sich solche Vergleichsstudien kaum noch anstellen, weil es so gut wie keine ursprünglichen Naturvölker mehr gibt. Auffällig ist hingegen, dass es heute kaum noch Kinder ohne Zahnfehlstellungen gibt, die mit teuren und aufwendigen KFO-Geräten (Spangen) korrigiert werden müssen.
Was nun hat all das aber mit Vitamin K zu tun? Price erkannte, dass der modernen Nahrung wie Weißmehl, raffiniertem Zucker, Pflanzenfetten, Dosenkonserven usw. etwas fehlen muss, was für die modernen Krankheiten sowie Karies und Zahnfehlstellungen verantwortlich ist. Zwar vermutete er einen fettlöslichen Faktor, konnte ihn aber nicht identifizieren. Deshalb nannte er ihn einfach Aktivator X (Price 2011).
Unter anderem stellte er fest, dass die traditionelle Nahrung der gesunden Naturvölker viermal mehr Mineralstoffe und wasserlösliche Vitamine und zehnmal mehr fettlösliche Vitamine enthielten als industrielle Nahrung. Damals waren erst zwei fettlösliche Vitamine bekannt, nämlich Vitamin A und Vitamin D. Price war davon überzeugt, dass es sich bei dem Aktivator X ebenfalls um einen fettlöslichen Stoff handelt, der bei vielen lebenswichtigen Funktionen eine Rolle spielt. Durch seine Versuche stellte er fest, dass vor allem Fischeier, Eidotter und Innereien reich an diesem Aktivator X sind.
Vor allem Butter aus Milch von mit grünem, schnell wachsendem Gras gefütterten Kühen enthält hohe Mengen von Aktivator X. Aus einer Mischung eines solchen Butterfetts und Lebertran stellte Price dann ein Öl her, das reich an Aktivator X war. Damit behandelte er kariöse Zähne und sogar schlecht heilende Knochenbrüche, indem er seinen Patienten die Einnahme dieses Öls verordnete. Nachdem wir heute wissen, dass Vitamin K2 eine Schlüsselrolle beim Knochenbau spielt, überrascht uns dieser Erfolg nicht besonders.
Price erkannte, dass der modernen Nahrung etwas fehlen muss, was für die modernen Krankheiten verantwortlich ist: Aktivator X alias Vitamin K2.
Mit unserem heutigen Wissen wird verständlich, warum ein durch die starke industrielle Bearbeitung von Lebensmitteln verursachter Mangel an Vitamin K2 zu fehlerhafter Knochenbildung und zu Karies führt (vgl. Kapitel Die Bedeutung von Vitamin K2 für gesunde Knochen sowie Die Bedeutung von Vitamin K2 für die Zahngesundheit).
Price stellte damals auch bereits einen Zusammenhang zwischen den Jahreszeiten, der Grasfütterung von Nutztieren und der Herzinfarktrate fest.
Ironie der Geschichte: 2007 wird Aktivator X als Vitamin K2 identifiziert
Jahrzehntelang wurde vergeblich versucht, diesen Aktivator X zu identifizieren, bis dies 2007 endlich gelang (Masterjohn 2009). Auch wenn Price den Zusammenhang noch nicht erkennen konnte, bemerkte er schon damals, dass die moderne Ernährung nicht nur zu schlechten Zähnen, sondern auch zu einer Zunahme von Herzerkrankungen führte. Heute liegt der Zusammenhang auf der Hand: Ein Mangel an Vitamin K2, dem Aktivator X von Price, führt zur Entkalkung von Zähnen und Knochen und zu einer Verkalkung von Blutgefäßen, z.B. solchen, die das Herz mit Sauerstoff versorgen. Als Folge davon faulen die Zähne, die Knochen brechen und die Adern verstopfen.
Es ist, so Masterjohn (2009), eine Ironie der Geschichte, dass Price die Bedeutung von Vitamin K2 (als Aktivator X) für den Kalziumhaushalt, das Nervensystem und das Herzkreislaufsystem schon entdeckte, bevor sich die Wissenschaft sechs Jahrzehnte später damit beschäftigte. Andererseits hatten Wissenschaftler die chemische Struktur des Aktivators X (als Vitamin K2) schon lange entschlüsselt (McKee et al. 1939), bevor Price ihn postulierte. Dabei hatte Price sogar die gleiche Nachweismethode (Jodometrie) für Aktivator X angewandt, die für den Nachweis von Chinonen, zu denen auch Vitamin K2 gehört, benutzt wurde (Willstätter und Majima 1910). Allerdings fand das erst 1972 Eingang in die englischsprachige Literatur (Glavind 1972). Deshalb erkannte Price noch keinen Zusammenhang und 1972 hatte man seinen Aktivator X schon längst wieder vergessen.
| Aktivator X | Vitamin K2 |
| In Butterfett von Säugetiermilch, Fischeiern, Tierorganen und tierischem Fett vorhanden | In Butterfett von Säugetiermilch, Tierorganen und tierischem Fett vorhanden; in Fischeiern |
| Wird im Tiergewebe, einschließlich Milchdrüsen, aus einem in schnell wachsendem grünem Gras befindlichen Vorläufer hergestellt | Wird im Tiergewebe, einschließlich Milchdrüsen, aus Vitamin K1 hergestellt, das im Chlorophyll grüner Pflanzen im Verhältnis zu ihrer Photosyntheseaktivität vorkommt |
| Der Gehalt dieses Vitamins in Butterfett ist proportional zu dessen Reichhaltigkeit an Farbe (gelb oder orange) | Der Vorläufer steht in direktem Bezug zu Betakarotin, das Butterfett seine gelbe oder orange Farbe verleiht |
| Setzt zweiatomiges Jod aus Jodwasserstoffsäure frei | Setzt zweiatomiges Jod aus Jodwasserstoffsäure frei |
| Wirkt synergistisch mit Vitamin A und D | Aktiviert Proteine, die Zellen durch Vermittlung von Vitamin A und D bilden |
| Spielt eine wichtige Rolle bei der Fortpflanzung | Wird in großen Mengen in den Fortpflanzungsorganen aus Vitamin K1 gebildet und von ihnen bei Vitamin-Karmer Ernährung bevorzugt gespeichert; die Funktion eines Vitamin-K2-abhängigen Proteins der Spermien ist noch unbekannt |
| Spielt eine Rolle beim Wachstum von Kindern | Trägt zum Wachstum von Kindern und Jugendlichen bei, indem es die vorzeitige Verkalkung der knorpeligen Wachstumszonen der Knochen verhindert. |
Identifizierung des Aktivators X als Vitamin K2 (Masterjohn 2009)
Tasuta katkend on lõppenud.