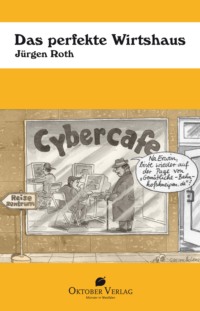Loe raamatut: «Das perfekte Wirtshaus»
Roth
Das perfekte Wirtshaus

Jürgen Roth
Das perfekte Wirtshaus

Jürgen Roth, geboren 1968, lebt als Schriftsteller in Frankfurt am Main. Zuletzt sind von ihm im Verlag Antje Kunstmann drei Hörspiel-CDs erschienen (Stoibers Vermächtnis, Der Untergang des Bayernlandes und Mit Verlaub, Herr Präsident … , die ersten beiden zusammen mit Hans Well von der Biermösl Blosn) sowie bei Zweitausendeins der Band Schrumpft die Bundesrepublik! (zusammen mit Michael Rudolf und F. W. Bernstein). Im Oktober Verlag liegen von ihm diverse Titel vor, darunter Anschwellendes Geschwätz, Fußball! (Buch und CD), Rettet das Rauchen! und die zweite, überarbeitete und stark erweiterte Auflage von Die Poesie des Biers.
© 2009 Oktober Verlag, Münster
Der Oktober Verlag ist eine Unternehmung des
Verlagshauses Monsenstein und Vannerdat OHG, Münster
Alle Rechte vorbehalten
Satz: Claudia Rüthschilling
Umschlag: Linna Grage unter Verwendung einer Zeichnung von Greser & Lenz
Herstellung: Monsenstein und Vannerdat
ISBN 978-3-938568-89-7
eBook-Herstellung und Auslieferung:
readbox publishing, Dortmund
Für V.
Bislang hat der Mensch sich nichts ausgedacht, das so viel
Freude verbreiten könnte wie eine schöne Taverne oder ein
Schankhaus.
Samuel Johnson
Im Wirtshaus allzu subaltern der Gast, im Gasthaus der Wirt;
folglich immer geradewegs in eine Gastwirtschaft.
Thomas Kapielski
Ich trank Bier in gewaltigen Bierhäusern. Eines bestand aus
einer ganzen Flucht von Sälen, und drei Orchester spielten
gleichzeitig. Um elf Uhr morgens waren alle Tische besetzt.
Simone de Beauvoir
Wenn du früher im Wirtshaus schlecht behandelt wurdest, bist
du wenigstens privat schlecht behandelt worden.
Hans Well
Also, wenn das nicht meine Stammkneipe wär’, ich würd’ hier
nicht hingeh’n.
Tresenhocker in der Frankfurter Gastwirtschaft Mampf
Wo ist denn hier die Wirklichkeit?
Tresenhocker in der Frankfurter Gastwirtschaft Kyklamino
Toren bereisen in fremden Ländern die Museen. Weise gehen
in die Tavernen.
Erich Kästner
Inhalt
Vorwort
Unruinierte Universalglückskomponenten
Wege zur Wonne
Wenn Tresen Trauer tragen oder: Zampano der Zunge
Goldener Grüner Baum
Das ideale Wirtshaus
Hinter den Steinen
Gottesgegenbeweise
Kein Ruhetag, keine Ferien
132 Dreier
Blond und blau
Terrassiertes Terrain
Faßbrause und Kühlungsbräu
Krug und Kruzifix
Frikadellengrünfrüchteensemble
Musik
Mühle marsch!
Berwersdorff hat unrecht
Diffuses Wartegebaren
Vergorene Gegenwart
Dialektischer Durst
Beckettistisches Bier
Dänemark verstehen
Trier – Eifel, mehrfach
Wellness contra Wirtshaus?
Wer den Vogel hat
Auffi!
Der Wille zum Bier
Notwendige Zwischenbemerkungen über einige Städte, in denen mitunter auch Wirtshäuser zu finden sind
Dezidierte Gedanken über den Deckel
Die Bestimmung des Containers
Viel Wind
Fürth, Türkei, Washington – Eine Trilogie des Tresens
Die Meister der Zäune
Wasserhäuschenwasserstandsmeldung
Der König von Zimmern
Ausgehorchte Ausländer
Blue Bock Blues
Entbierung schreitet voran!
Der Nil
Der Streit der Religionen
Komische Speisekarte
Ins Dasein geblickt
Wo bleibt Berry?
Im schäbigen Meer
Zum Volkswohl
Geringes Glück
Karpfenbier
In Idiotenland
Anständiges Australien?
Gastronomiegulag Gallus
Normalkneipe
Städtische Strandpromenade
Gemeine Gemeinden – Heute: Stublang
Öd? Ach was!
Das große österreichische Weizenbierschisma
Das Erleben von Lissabon
Andechs oder Bamberg?
Leipziger Nüchternheit
Kneipeneschatologie
Der Zeit die Zunge zeigen
No go
Winzige Wehmut
Der Segen des Elendstrinkens
Das Lexikon der Interjektionen
Beckett und Steinbeck
Der Frankfurter Adi
Das Caio-Evangelium
Rohe Bärte
Die ungeheure Vielfalt der Grüntöne
Habermasianische Kommunikationsinsel
Dunkles Weizen
Franken in Frankfurt
Die Louisa-Fragmente
Nachweise
Vorwort
Dieses Buch ist kein Wirtshausführer. Es ist eine Sammlung von Reisereportagen, von literarischen Feuilletons, von Anekdoten, Geschichten, Glossen, Essays. Allen Texten gemeinsam ist ein Thema oder Motiv: die Beschreibung der Eigentümlichkeiten unterschiedlicher öffentlicher Trinkorte.
Um den möglichen Einwand vorab zu entkräften, es handele sich bei diesem Buch um eine bloße und darob eventuell ja wohlfeile Kompilation bereits erschienener Texte: Zum einen kann es sich ein freier Autor, der nicht über Erbschaftsmillionen oder granatengeile Börsenpakete verfügt, heutzutage bei den lächerlichen Vorschüssen, die Buchverlage zu zahlen bereit oder in der Lage sind, schon aus Gründen der simplen Reproduktion nicht erlauben, ohne Aufträge von Zeitungen, Zeitschriften und Rundfunkanstalten um die Welt zu reisen und durch die Gegend zu latschen; zum zweiten sind nahezu alle hier zusammengestellten (Auftrags-)Arbeiten aus den vergangenen sechs Jahren vor dem Hintergrund entstanden, sich zu einem Buch zusammenzufügen. Daß ich sie noch einmal sorgfältig durchgesehen und hie und da leicht retuschiert habe, darf ich anmerken.
Den endgültigen Anstoß, sich über einen längeren Zeitraum mit Fragen und Phänomenen der Wirtshauskultur und ihres Niedergangs zu beschäftigen, gab 2004 Tanja Kokoska. Sie ist Redakteurin bei der Frankfurter Rundschau und war damals verantwortlich für das neue wöchentliche Regionalsupplement plan.F. Angeregt durch ein Interview, das ich mit Achim Greser und Heribert Lenz geführt hatte (siehe Seite 27), sagte Tanja: »Du hockst doch dauernd in Kneipen und Wirtshäusern rum. Schreib doch bitte für mich eine Serie über das perfekte oder ideale Wirtshaus.«
Ich hocke zwar nicht dauernd in Wirtshäusern und Kneipen herum, aber schon recht häufig und gerne. »Gut«, sagte ich, »gehen wir’s an. Titel: ›Das perfekte Wirtshaus‹.« – »Sehr schön.«
Tanja ist freundlich, kundig und – hartnäckig. Bereits nach der zweiten oder dritten Folge forderte der damalige Chefredakteur der Rundschau, Wolfgang Storz, lauthals die sofortige Einstellung der Serie. Das wiederholte sich praktisch jedesmal, wenn neuerlich eine ganze Seite des Serviceblattes mit einer eher verspielt-verwinkelten Abhandlung über das Wirtshauswesen gefüllt worden war.
Tanja ließ sich nicht beirren und nicht einschüchtern, und so hatten wir es schließlich immerhin auf dreizehn Folgen gebracht. Daß kurz nach Erscheinen des letzten Textes plan.F eingestampft wurde, finden wir noch heute fast ungeheuer okay.
Tanja, merci!
Nach dem Ende der Serie wurde sie informell in multipler Aufsplitterung in anderen Zeitungen fortgesetzt. Ich danke vor allem Jörg Hahn, Freddy Langer und Jakob Strobel y Serra von der FAZ, Michael Ringel von der taz und Christof Meueler von der jungen Welt. Sie haben Texte in Auftrag und/oder in Druck gegeben, die ich im Hinblick auf die Fertigstellung des Perfekten Wirtshauses zusammengehauen habe.
Gut möglich, daß das eine oder andere Etablissement, das auf den folgenden Seiten Erwähnung findet, mittlerweile nicht mehr existiert. Das wäre ein weiteres Indiz für das unaufhaltsame Verschwinden der letzten wahren, schönen, guten Wirtshäuser und Trinklokalitäten.
Gut möglich obendrein, daß dem Leser gewisse regionale Einseitigkeiten ins Auge fallen und er im Gegenzug lobenswerte Kneipen etwa im Ruhrgebiet oder im hohen Norden vermißt. Erstens: Ich kann nicht überall sein. Zweitens: Neigung und Gewohnheit spielen in Sachen Gasthausbesuch natürlich keine unbedeutende Rolle. Drittens: Die Auswahl unterliegt auch dem Zufall; wo mich eine Redaktion hinschickt oder wo ich eine Rast einlege, das entscheide nicht ich und plane ich nicht. Viertens: Es geht hier letztlich um das Typische von Orten, an denen es sich lohnt, zu verweilen und – vornehmlich – Bier zu trinken.
Sicher, zur Münsteraner Brauerei Pinkus Müller, in deren Ausschank ich mit Michael Rudolf mal einen hervorragenden Nachmittag verbaselt habe, zu einem ausgezeichneten Lärmladen in der Dresdner Südstadt, dessen Name mir entfallen ist, zum Augustiner-Keller und zum Jennerwein in München (ich bin im Besitz des Jennerwein-Raucherklubausweises Nummer 5.000), zur Gaststätte der Erdinger Weißbräu und zum Raucherclub Möller’s in Hamburg hätte ich durchaus ein paar Worte verlieren können. Aber manchmal habe ich keine Lust, mir Notizen zu machen und zu schreiben. Ich bitte um Nachsicht.
Unruinierte Universalglückskomponenten
Wer durch die Praxis galvanisierte Mitteilungen machen möchte über die letzten wahren Wirtshäuser, über Gaststätten und Lokale, die sich gegenüber dem Perfektibilitätsgedanken der Aufklärung zumindest noch als aufgeschlossen erweisen, der wird zunächst kaum im engeren oder weiteren hessischen Großraum verweilen, sondern voller Verve und maßstabsuchend ins angrenzende Bayern ausreiten und dort aber sofort in eines der gesegneten Segmente der Erdschrunde preschen: in die Fränkische Schweiz.
Der Mensch ist anthropologisch maßgeblich bestimmt durch zweierlei – durch die Sprache und, so legt es der radikale französische Republikaner Claude Tillier in seinem mit Rinderzungen zu preisenden großhumoristischen Roman Mein Onkel Benjamin (1843) überzeugend dar, durch die Fähigkeit, sich zu betrinken. Der Mensch ist im Sinne auch Schillers nur dort voll entwickelt und des weiteren in irgendeiner Weise und Richtung entwicklungsfähig, wo er ohne Arg noch List und ohne störende Umstände herumhocken kann (also beispielsweise in einem Gerhard Poltschen »erdbebensicheren Gebiet« als vornehmlich Biergartengebiet), wo er dann in einem gewissermaßen traulichen Ambiente herumschwatzen darf und zudem eines jederzeit in unerschöpflicher Menge und extraordinärer Qualität vorrätigen Getränks habhaft zu werden vermag, eines Getränks, das sich reziprokproduktiv zur hellen, lichten Sprachlichkeit des Menschen verhält. Es handelt sich hierbei um das Bier.
Alle drei Universalglückskomponenten sind in Heckenhof im Zentrum der Fränkischen Schweiz aufs edel-irdischste miteinander verbunden. Das liegt zum einen an einer waldbuckeligen, von Hohlwegen und Feldgehölzen durchzogenen und tektonisch krisenfreien Landschaft, zum anderen an der Wirtschaft Kathi-Bräu. Der Frankfurter muß lediglich etwa zweihundertdreißig Zug- oder Pkw-Kilometer überwinden, um das im 15. Jahrhundert gegründete Brau- und Schankhaus zu erreichen. Das ist fürs Paradies kein schlechter Wert.
Am besten schlägt man sich östlich von Bamberg via Heiligenstadt nach Aufseß durch und erklimmt anschließend eine kleine Anhöhe über den neuerdings zum »Wellness-Wanderweg« beförderten Treckerpfad. Hinter einer generös arrangierten Baumgruppe eröffnet sich dem himmelblauen Blick zunächst ein gar nicht hinterfotzig genug zu verfluchender Parkplatz für jene Biker, die Kathi-Bräu zum »Szenetreff« erkoren haben und wochenends als »Wheelies« das »hopfige Naß« (www.bikeandmedia.de) in die Lederkörper importieren, um hinterher folgende Bike-and-Beer-Poetry ins virtuelle worldwide Hohlhausen zu pflanzen: »Ich geh nach Heckenhof seitdem ich 10 bin, da bin ich noch mit meinem Vater gefahren. Mittlerweile fahre ich selber und ich werde auch noch mit 60 Jahren dahin fahren, da ist es einfach super und die Kathi Bräu in Heckenhof ist im Sommer schon so ne Art Familie.«
Ist sie, Gott sei es gedankt, unter der Woche nicht – sondern vielmehr ein anarcholibertäres Gemütlichkeitsterrain at its best. Da rasten unter elysischer Laubüberdachung und in archäologisch wertvoller Ruhe um halb elf Uhr morgens junge Müßiggänger, Spazierleut’, Handwerker, festgeschraubte Krugstemmer und gemischte Rentnermannschaften, die frohvollst das malzmuntere, nach »Geheimrezept« der 1993 verstorbenen Braumeisterin Kathi Meyer verfertigte braune Lagerbier einsaugen, das zwischen Plackenschwarz und Lakritzbraun changiert und durch seine kompottartigen Nuancen zuweilen an Schwarzbier oder sonst was erinnert. Eine Katze sieht das ebenfalls für geraten an, sofern sie nicht im wilden Garten neben dem durch und durch unruinierten, weil unrenovierten Gasthaus inklusive finsterem Schankraum, schwankendem Steinboden, Rinnenpissoir und Eistruhe herumtapst oder -fläzt.
Draußen darf es zwar auch eine Brotzeit sein respektive ein Käsekuchen; doch wer »auf den Keller geht«, wie es heißt, wenn man in Oberfranken in den Biergarten marschiert, der hält a) keine »Benzinreden« (s. o.) und bleibt b) »den ganzen Tag sitzen, verdammt!« (K. Sokolowsky), nämlich beim Bier (und höchstens bei einem Zusatzteller Sauerkraut). Er weiß dann, daß auf der hiesigen »Agora reborn« nicht bloß die »unheimliche Macht von Hademar Bankhofer« angemessen erörtert und eine fürwahr fortschrittliche Debatte über Biker geführt werden kann, über Stahlroßdompteure, die im Münchner Englischen Garten den Bärlauchsammler Prof. Sailer in den Wahnsinn treiben. Er erfährt obendrein, daß am Tisch der Wissenden ab Seidla Nummer fünf (0,5 l, 1,60 €) noch weit über Luthers Tischredenidiotien hinaus der diverseste Quark und versierteste Schrott in die Dialogspirale flutscht; so daß er zuletzt volle Kartusche »am Baum der Erkenntnis genascht hat«
(E. Stoiber, 14. März 2003) und es ihm mithin nachgerade vernünftig dünkt, ergänzende drei bis sechs Runden lang den Arsch nicht mehr hochzukriegen.
Oder er schaut klappehaltend einer fingernagelgroßen grünen Raupe zu, die sich über Stunden hinweg stillvergnügt und lässig leuchtend in der Bierpfütze auf dem Holztisch wälzt.
Wege zur Wonne
Wer mit dem Wort »Bierstraße« nicht bloß eine Gasse in Osnabrück oder Chemnitz meint, die genau so heißt, und wer des weiteren unter »Bierstraße« nicht allein die sogenannte mallorquinische Sauf- und Raufmeile Calle de Miquel Pellisa in S’Arenal versteht und dabei verzückt an das degoutante Gebaren in Vorhöllen wie dem Deutschen Eck und dem Almrausch denken muß, der weiß, daß es im Bierwunderland Franken nicht nur Hunderte von kleinen und feinen Brauereien, sondern auch Bierstraßen gibt, die zum Teil sogar ins Niederbayerische und nach Thüringen ausgreifen.
Im Oberfränkischen zentriert bleibt zunächst die Fränkische Bierstraße, eine Fremdenverkehrsinitiative, die mit Brauerei- und Kirchweihbesuchen, Bierwochen und anderen Festivitäten für die Region wirbt. Der Verein Fränkische Bierstraße bietet jedoch darüber hinaus Touren an, die auch Nürnberg, das südliche Mittelfranken oder den Steigerwald einbegreifen.
Eine der Rundreisen startet in Bayreuth, wo sich neben dem Festspielhaus vor allem das Museum der Maisel’s-Brauerei und der Herzogkeller für eine Visite anbieten. Auf der B 85 Richtung Kulmbach erreichen wir dann Altdrossenfeld. Dort hält die Brauerei Schnupp ein gängiges Edelpilsener bereit, das unter beinahe allen Umständen runtergeht. Einige nordöstliche Kilometer entfernt wirft allerdings der Bierbetrieb Haberstumpf in Trebgast das dunkle Kupferkrönla in die Gaumenschale.
Von Trebgast rauschen wir östlich an Bayreuth vorbei Richtung Pegnitz, wo zweimal Bier gefaßt werden kann, um über die B 470 gestärkt in die gesegnete innere Fränkische Schweiz zu gelangen, nach Pottenstein. Ob da mehr die drei Brauereien locken oder eher der Burgberg interessiert, mag Veranlagungssache sein. Entlang des sich gen Westen hinstreckenden Wiesenttals sind im Anschluß End- und Ruhepunkte sonder Zahl anpeilbar – zumal auf dem rechter Hand gelegenen Plateau, auf dem neun hochgradig empfehlenswerte Privatbrauereien logieren.
Während sich die Aischgründer Bierstraße auf den Steigerwald konzentriert und zwischen Bad Windsheim und Uehlfeld auf zirka fünfzig Kilometern mit sieben Familienbrauereien aufwartet, die im näheren Umfeld der B 470 zu finden sind und im Rahmen von 1- bis 3-Tages-Trips inklusive Bierseminar, Brennereiexkursion und Anzapfkurs geprüft werden können, geht die Bier- und Burgenstraße, 1977 in Kulmbach als Arbeitsgemeinschaft gegründet, bei einer Gesamtlänge von 500 Kilometern in die vollen. Hier braucht es nicht nur mehrere Fahrer, hier sind obendrein diverse Rast- und Rekreationsphasen angebracht.
In Passau beginnend, schlängelt man sich auf der B 85 nordwärts und macht beispielsweise in Amberg und Sulzbach-Rosenberg Station. Ein Stopp bei Sperber-Bräu im Zentrum Sulzbach-Rosenbergs (Rosenberger Straße 14) kann nicht schaden. Die Weisheiten der Schafkopfrunden sind unerschütterlich, wie Eckhard Henscheid mehrfach überlieferte. Vorher allerdings zieht bereits das Amberger Rathaus in Bann, ein gotisches Schmuckstück, das einen drei- bis vierfachen Toast mit der legendären Falk-Weiße verdient, einem Hefeweizen, das heute und nicht minder cremig durch die örtliche Brauerei Bruckmüller hergestellt wird.
Die Route führt weiter über Pegnitz, Bayreuth und Kulmbach, dessen unterdessen monopolistischer Großbraubetrieb zugunsten der Plassenburg zu ignorieren wäre, und touchiert Gampert-Bräu in Weißenbrunn und Jahn-Bräu in Ludwigsstadt, beides akzeptable Orte der Erfrischung. Hinter der thüringischen Landesgrenze böte sich ein bierologisches Intermezzo im Bürgerlichen Brauhaus zu Saalfeld an (Pößnecker Straße 55), gleichwohl wir, das Schloß Heidecksburg und das Blankenhainer Schloß grüßend, bei Weimar einen Abstecher nach Apolda favorisieren würden. In der hiesigen Vereinsbrauerei (Am Töpfermarkt 1) darf man sich ein Gambrinus Pils oder den Glockengießer Urtyp gefallen lassen, um die Kraft der zwei Herzen fürs Finale der Bier- und Burgenstraße zu tanken: für das Kyffhäuser-Denkmal bei Bad Frankenhausen. Das Barbarossa Pilsner der Privatbrauerei Artern gibt einem dann den Rest.
Bierstraßen sollen Orientierungsangebote in einer vielfältigen Kulturlandschaft sein und die Erkundung der Bierwelt mit anderweitigen touristischen Zielen, mit Baudenkmälern, Ruinen und Naturparks, verbinden. Da herrscht der Marketinggedanke notgedrungen vor. So empfiehlt es sich, falls einem an der Entdeckung wahrer Kleinode der Braukunst und der Wirtsstubenbehaglichkeit gelegen ist, immer der Nase nach und mit der Fränkischen Brauereikarte von Stefan Mack in der Hand durch Frankens Lande zu stiefeln.
In den östlichen Haßbergen zum Beispiel, etwa zwanzig Kilometer nördlich von Bamberg, sollte der Neugierige im exquisiten Bierstützpunkt der Baunacher Brauerei Sippel, geführt von Baptist Fößel, ein paar Seidel des dunklen, streng rezenten und experimentell gehopften Vollbiers stürzen, während der Stammtisch seine Knollnasen mit Bierschnaps pflegt. Anschließend marschiert man zwei Kilometer weiter in westlicher Richtung, durch ein weiches Tal. Am Ortseingang von Appendorf steht die Brauerei Fößel-Batz, in der nicht bloß eine bittersüße Feinheit kredenzt wird, die in solcher Vollkommenheit selten aufzuspüren ist, sondern Freitag abends ein unglaubliches Tanz- und Musikspektakel stattfindet, an dem Hobbyinstrumentalisten und Walzerwütige aus der ganzen Region teilnehmen, um im schönsten Gewoge die Vermählung von Rausch und hochmodernem Entertainment zu zelebrieren.
Hat man das Remmidemmi halbwegs unbeschadet überstanden, steht am nächsten Tag einer weiteren Tour über die (noch) unbenannte Bierstraße entlang der B 4 nichts im Wege. An demselben werben mit der Brauerei Zum Goldenen Adler in Höfen, der Brauerei Fischer in Freudeneck und der Brauerei Sonnenbräu in Mürsbach kurz hintereinander drei vorbildliche Bierinstitute um die Gästegunst – Pilgerstätten, die durch die dargebotenen glitzernden Getränke nicht weniger für sich einnehmen als durch ihre seraphischen Namen.