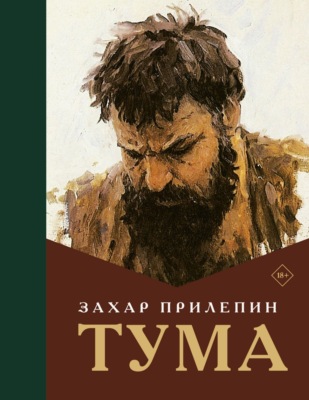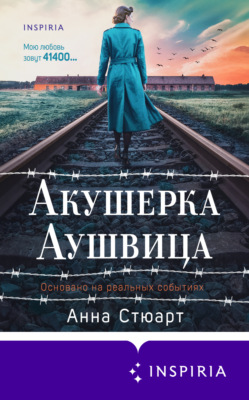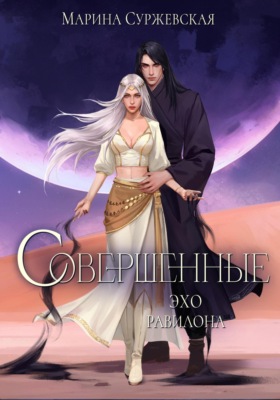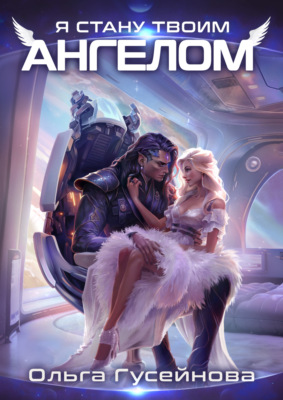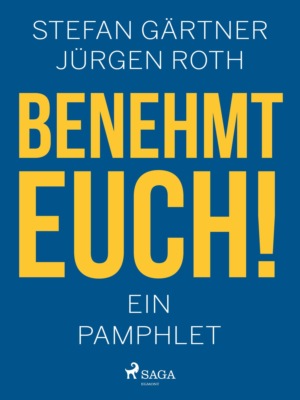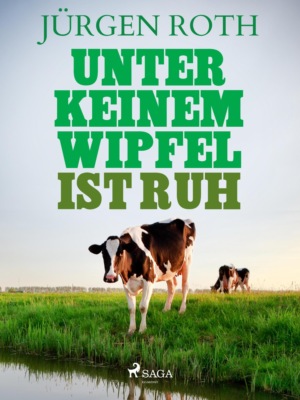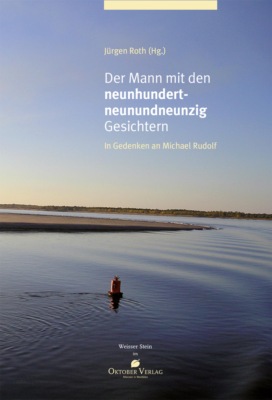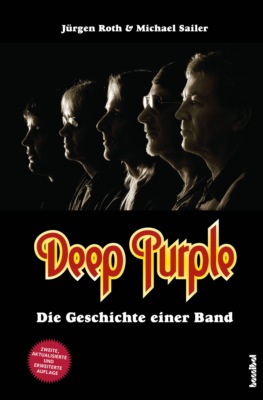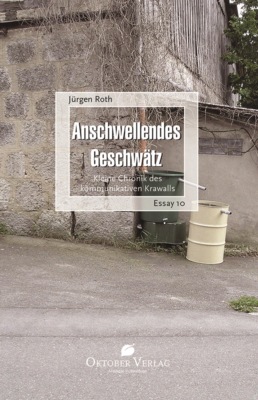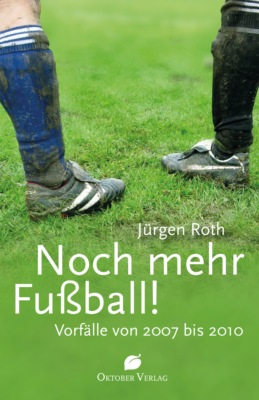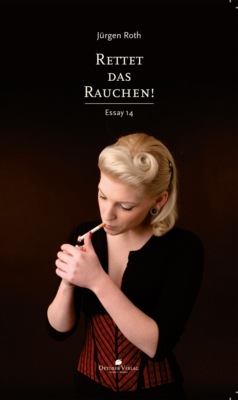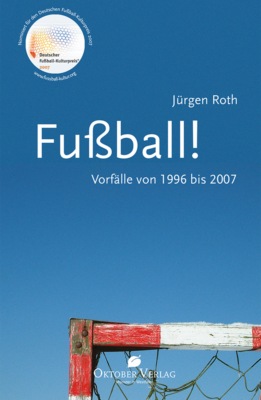Loe raamatut: «Die Poesie des Biers»
Roth
Die Poesie des Biers

Jürgen Roth
Die Poesie des Biers
Mit Gastbeiträgen von Matthias Egersdörfer,
Marco Gottwalts, Christian Jöricke,
Friederike Reents, Michael Rudolf, Jörg Schneider
und Dieter Steinmann

Jürgen Roth, geboren 1968, lebt als Schriftsteller in Frankfurt am Main. Jüngst sind von ihm im Verlag Antje Kunstmann drei Hörspiel-CDs erschienen (Stoibers Vermächtnis, Der Untergang des Bayernlandes und Mit Verlaub, Herr Präsident …, die ersten beiden zusammen mit Hans Well von der Biermösl Blosn) sowie bei Zweitausendeins der Band Schrumpft die Bundesrepublik! (zusammen mit Michael Rudolf und F. W. Bernstein). Im Oktober Verlag liegen von ihm diverse Titel vor, darunter Anschwellendes Geschwätz, Fußball! (Buch und CD), Das perfekte Wirtshaus und, als Herausgeber, die Live-Lese-CD Der saubere Herr Rudolf.
2., korrigierte, überarbeitete und stark erweiterte Auflage
© 2010 Oktober Verlag, Münster
Der Oktober Verlag ist eine Unternehmung
des Verlagshauses Monsenstein und Vannerdat OHG, Münster
Alle Rechte vorbehalten
Satz: Claudia Rüthschilling
Umschlag: Tom van Endert unter Verwendung
eines Photos von Jürgen Roth
Alle anderen Bildnachweise am Ende des Buches
Herstellung: Monsenstein und Vannerdat
ISBN: 978-3-938568-91-0
eBook-Herstellung und Auslieferung:
readbox publishing, Dortmund
Ich hab’ nach vier Runden schon gemerkt, daß ich
so blau bin, da hab’ ich gemerkt: Oh, oh, das wird schwer!
Claudia Pechstein
Kann man einem Menschen trauen, der keinen
Alkohol trinkt? Ich habe da meine Bedenken.
Gerhard Polt
[…] dieses eine Bier hatte auf ihn gewartet, und
er hatte es noch nicht ganz ausgetrunken.
Malcolm Lowry: Unter dem Vulkan
Was soll man denn die Leute in den Geschichten immer trinken
lassen – nimmt man Whisky, muß man einen Revolver einbauen,
und bei Sekt wird die Beschreibung der Kleider der Weiber gleich viel
zu langwierig. Bei Bier schreibt man Bier, und damit hat es sich.
Franz Dobler: Bierherz
So sind zum Beispiel Bier, Wein und Denken
Reize, aber nur vom erstern ließe sich leben.
Jean Paul
Pilsner Bier ist das eigentlich einzige Alkoholgetränk,
das absolut für viele Leidende eine Medizin, ein Diätetikum, eine
Rekonvaleszenz, eine Erlösung, ein Heil erster Ordnung bedeutet!
Peter Altenberg
Bier ist unter den Getränken das nützlichste, unter den Arzneien
die schmackhafteste, unter den Nahrungsmitteln das angenehmste.
Plutarch
Da der Komfort das oberste Prinzip ist, so versteht es sich
von selbst, daß man Bier haben kann, wenn man einen
Menschen anzapft und ein Gefäß unter die Öffnung hält.
Karl Kraus: Varieté
Andere gehen am Vormittag in ein Wirtshaus und
trinken drei oder vier Gläser Bier, ich setze
mich hier herein und betrachte den Tintoretto.
Thomas Bernhard: Alte Meister
Trinkst du persönlich auch noch was?
Wirtin in der Frankfurter Gastwirtschaft Lokalteil
Bier hilft!
Jörg Fauser
Cerevisiam bibunt homines.
Es war alles Bier.
Heino
Man trank, um getrunken zu haben.
Jörg Fauser
Inhalt
Vorbemerkung zur zweiten Auflage
Vorbemerkung
Grußwort
Michl Rudolf, alter Seebär!
Ein Abend in Aufseß
Neulich am Tresen
Die einzig wahre Flaschenpost
Ein Flecken
Arbeiterfrühling
Der Russe
Vom Russ’
Aus der Welt der Wahrheit
Der Staub der Seele und das Grün des Gemüts
Kino
Kneipenkomik
Die Gasthaushölle und die goldene Gerste
Das Verschwinden des dicken Luftraums
Bier im Schuh
Trotz Zahlkraft der Heimat so fern
Alles fahren lassen
Beim Bistrobier belauscht
Beckett guckt Beckenbauer
Daseinsbewältigung 2008
Das heilige Viereck
Kleine psychosoziale Biertypologie
Bohlens Bier (im Kontext)
Die Blaue Bierblume oder: Ein hehrer Halunke und harter Herold
Wrba contra Rehse
Der Poet des Bieres oder: Ode an Helmut Stier
Kafka in Pirmasens
Dorst und Dorf
Eins für die Chefin
Von Dieter Steinmann
Das Zelt der Zerberusse
Vom Briten lernen
Von Dieter Steinmann
Aufklärung à la Albion
Leberwurstbauch
Auf Hemdknopfhöhe
Blonde Bräute in spe
Der oder das Radler – akzeptabel?
Oberneuses
Bock around the clock
Mosers Mühen
Oberharnsbach
Karnevalskirche
Paradigmenwechsel in Jesbach
Das lohnende Los
Bald Barbarei in Borgentreich?
Trauer um Spuckesepp
Der Bischoff-Bischof
Dummheit + Bier = Mildernde Umstände
Alle Irren
Richtig trinken
Mehrere Männer und zwei Frauen
Über den Biersatz
Erwähnenswerte Ereignisse
Sieh an, ein Anagramm!
Neue Überlegungen übers und beim Bier
Was A sagt, muß auch B sagen oder: Sich verabreden
Schnitzel, quo vadis?
Total wahre Anekdote über und zu Ror Wolf
Von der mangelhaften Lautlosigkeit im Schnitzelgebirge
Stadt, Land, Fluß
Ursprüngliche Bierakkumulation oder: Bloß eine Jugendsünde?
Unser liebes Bätzibaby
Biermanieren
Witz aus der Flasche
Auf, zum Teufel!
A Hardy’s Night
Fuller Frühling
Irrtum
Bierpoesie
Die zehn besten Biere vom Niederrhein
Die zehn besten Biere aus Franken
Die zehn besten Biere aus Sachsen-Anhalt
Das modernische Dingsda
Erneute Ereignisse und erwähnenswerte Erwägungen
Kneipenkomik II
Pappkameraden
Singendes Sitzfleisch
Der Herumführer
Trier an der Nordsee
Im Dienste der vielfachen Völkerverständigung
Jetzt mal ein paar Worte zu Gießen
Teufelswerk im Kloster Machern
Obere Wiese, untere Wiese
Die Rühreifrage
Spafallera
Wie wir Weltmeister wurden
Aussicht auf nichts
P13
Wolkensuche
Zugglück
Achtung, aufgeschichtetes Holz!
Kettenrauchen contra Katarrh
Auf der Jagd nach einer Dose
Lustprinzip im Modus der konjunktivischen Vorvergangenheit
Bierdeckelarithmetik
Mein terroristischstes Erlebnis
Gemischte Völker- und Tierkunde (nach Robert Gernhardt)
Australien doch nicht!
Wer ist Kafka?
Trinkorte, Nicht-Orte, Gegenorte
Tratschort Trinkhalle
Skatskandal
Die Marmelade am Hering
Da lacht die Leber
Dosenbierkrise
Schöner reisen nach Afrika
Von der Kunst des Negerphotographierens
Dreierlei Maßarbeit oder: Ein Tresentriptychon
Sprachlos
Die Fünf-Promille-Hürde
Die Biervision
Die besten Elf*
Breakfastbierbrezeling
Rechenkünstler
Es tritt auf: das Arschloch
Godesberger Farben
Monsters Of Miltenberg
Sommerausklang
Winzer und Würstl
Weinberater Gonzales
Gegen das Klavierspielen
Zehn bemerkenswerte, vielleicht sogar gesellschaftsrelevante Bierlieder
Der Abschaffelverein
Die Sonne im Sonnenhof
Rauschende Spiele
Welcome Asia Bistro
Pizza-Connection
Zwei oder drei, du mußt dich entscheiden
Jürgen Roth kauft sich eine Hose und geht zu einer Lesung – Ein Drama in drei Akten und mit glücklichem Ausgang
Bierwart Jubb
Magnetbier oder Bountybier
Kaufen, kaufen!
Medizin
Abstürze, Katerkunde
Schwund und Schund
Die guten Eindrücke von Lahnstein
Livealbum oder: Ein Remixroman in mehreren, nämlich ganzen drei Kapiteln
Anhang: Marken und mehr
Nachweise
Bildnachweise
Vorbemerkung zur zweiten Auflage
Jeden Autor freut es, wenn ein Buch von ihm vergriffen ist. Es wurde gekauft, womöglich sogar gelesen und weiterempfohlen. Also einfach geschwind eine Neuauflage drucken?
Nein. Bei Lesungen hat man gemerkt, daß dieser und jener Text an der einen oder anderen Stelle nicht richtig fließt, daß man hier ein wenig kürzen, dort hingegen eine Kleinigkeit einfügen müßte, daß sich ein Druckfehler, eine Wiederholung oder ein falsches Wort eingeschlichen hat. Die Suche nach dem »mot juste« (Flaubert), auf die man sich dann begibt, kann außerordentlich mühsam sein, denn sie verleitet einen dazu, die alten Sachen, die man Arno Schmidt zufolge fünfundzwanzig Jahre nicht mehr anschauen sollte, einer genauen Überprüfung zu unterziehen.
Das ist keine angenehme Arbeit. Ich habe alle Texte so penibel wie möglich durchgesehen, und das hat sich hingezogen. Deshalb erscheint die Neuauflage mit einem Jahr Verspätung. Zudem konnte ich es nicht lassen, noch etwelche Glossen, Reportagen, Geschichten, Aufsätze und Minidramen zu schreiben, und der Anhang ist auf das Fünffache des ursprünglichen Umfangs angeschwollen. Es werden dort jetzt 844 Biermarken inspiziert und bewertet. Ob es sie alle noch gibt, vermochte ich beim besten Willen nicht zu recherchieren. Wo das nicht der Fall ist, verweise ich auf das konservatorisch-eschatologische Moment von Literatur.
Im Verbund mit dem im Frühjahr 2009 erschienenen Band Das perfekte Wirtshaus liegen meine Texte zum Thema Bier nun gesammelt in Buchform vor. Dann kann es ja weitergehen.
Vorbemerkung
Vielfältig sind nicht nur die Lobgesänge, die die besten Dichter auf das Bier angestimmt haben, auf das älteste Getränk der Kulturgeschichte, die sinn- wie würdevollste Erfindung des Menschen. Eindrucksvoll vielfältig ist die Alltagspoesie selbst, die der Zungenlöser und Geselligkeitsförderer Bier anregt.
Die Poesie des Biers wendet sich einigen bemerkenswerten Aspekten und einigen abgelegenen Winkeln des unermeßlich weiten Bierkosmos zu, unternimmt Exkursionen in fränkische Bockbierparadiese und in Bierprovinzen, erzählt von Tresengesprächen und von konfusen Bierdiskursen – verpflichtet im wesentlichen den Gattungen und Genres Prosa, Polemik und Panegyrik. Zuweilen mogelt sich das Bier auch bloß vom Rande herein, was nicht bedeutet, daß es dann eine weniger wichtige Rolle spielt.
Im Anhang werden einige spezielle und nicht so spezielle Erzeugnisse der weltweit tätigen Brauwirtschaft begutachtet; mit 241 neu verkosteten Marken ist er als Ergänzung zu den Bänden Bier! Das Lexikon und Bier! Das neue Lexikon gedacht.
Der freundliche Hinweis auf Michael Rudolfs Opus 2000 Biere – Der endgültige Atlas für die ganze Bierwelt sei hier auch gestattet.
Grußwort
Bis zum April 1999 dachte ich, Herrn Rudolf ganz passabel zu kennen; diesen distinguiert auftretenden, edle Lederjacken schätzenden, stets leidlich gescheitelten, kotelettenfreien Herrn, der während seiner Jahre als Sudingenieur c/o Greizer Vereinsbrauerei ein reines Gespür für Hopfen, Malz und die Solistenkunst Ritchie Blackmores entwickelt zu haben schien; der bei gelegentlichen Luftspeedgitarrenwettkämpfen gar nicht mal »schlecht« aussah und dem Moment des musikalischen Glücks meist wohltönende Lautreihen zu schenken verstand; der, und wann findet man so was schon in unsren verlotterten Zeiten, ein Freund war. Bis zum April 1999 –
– da wir gemeinsam die Fränkische Schweiz bereisten und keine drei Tage später getrennte Wege gingen. Gehen mußten.
Ich könnte Sachen erzählen. Wenn hier zum Beispiel einer den Arsch offen hat, dann der feine Herr Rudolf. Der saubere Herr Rudolf, der sich vertraulich gerne »Brüsteforscher Rudolf« nennt, peppt jenen Trank, den er »testifizieren« möchte, mit Zigaretten auf, »um der schalen fränkokanadischen Hopfenkaltschale wenigstens etwas Power« zu »verleihen«. Ernste Verkostung gehorcht gewiß anderen Regeln. Der honorige Herr Rudolf, die Schnapsdrossel und temporäre Whiskyleiche, pflegt jede halbe Stunde zu fordern: »Laß uns noch einen Liter Bierschnaps wegputzen, du fährst ja« – die häßlichste der bekannten Formen des Bierdopings.
Der superbe Herr Rudolf gestand mir am Schanktisch des Aufsesser Brauhauses, bevorzugt bei geschlossener Flasche und »per Anblick« zu verkosten. Es ist der anständige Limofan Rudolf, der im Grunde nur nach Weibern ächzt und einen Dreck um die Weiterentwicklung der Bierliteratur sich kümmert. Die Notizen und Notate des Rauchbierrauchers Rudolf erfüllen samt und sonders den Tatbestand des Betrugs und wollen, erklärt er gegen zwölfe steinvoll johlend, »eh bloß dem verfickten Kunstgedanken Genüge leisten«.
Der edle Herr Rudolf, der ab einse »Mein Freund, der Frauenarsch« intoniert, ist ein akkurater Lump und nur zum Schein ein manierliches Mitglied der Menschengesellschaft. Mein Vertrauen hat er verwirkt. »Ich fress’ jetzt ein Schnitzel«, waren die letzten Worte, die er an mich richtete, bevor er ein Warsteiner köpfte, sein Rad bestieg und in den blitzend roten Horizont entschwand, um »dieses Scheißbuch runterzusemmeln«.
Immerhin: Drei Wörter hier sind wahr. Mehr als auf den folgenden Seiten.
Michl Rudolf, alter Seebär!
So hatten wir zwar nicht gewettet; aber Du hast es so gewollt: im Greizer Wald, wo Du vor vierzig Jahren zusammen mit Deinen Großeltern sämtliche bekannten Pilz- und Reharten der nordöstlichen Hemisphäre in einem Akt spontaner Willkür komplett um- und neubenannt hast, kurz nach dem Rechten zu sehen und dann die Lebensnot- und -mutreißleine zu ziehen.
Michl, alter, guter Stiefel: Jetzt trinkst Du uns im Deutschen Brauer-Bund-Himmel die siedend schönen Bierkessel auf eigene Rechnung leer und weg, und bei solch sauberer Feinarbeit wollen wir Dich auch nicht stören, auch wenn wir’s zu gerne täten. Aber, good old Lump, hinauf zu Dir brüllen und jammern dürfen und müssen wir doch: Keep on rockin’ and drinkin’ in a Binding-free world!
Deine Schwermutmatrosen von stets Deiner
Titanic
Ein Abend in Aufseß
Ich weiß nicht, ob ich richtigliege – vielleicht weiß man ohnehin praktisch nichts von jenen Dingen, die relevant sind –, aber eine autobiographische Miniatur aus Michael Rudolfs seit Mitte der neunziger Jahre in dichter Abfolge erschienenen Büchern lese ich heute als eine Art Programmschrift, die mir die Augen öffnet für sein schriftstellerisches und sein Lebenscredo, die er beide nie explizit formuliert hat.
»Topographie des Taumels« aus Der Pilsener Urknall (Leipzig 2004) ist die Hommage an den Bürgerhof überschrieben, an eine seiner zwei Stammkneipen während der Schulzeit in der DDR. »Die Schwerkraft wirkte höchstens symbolisch, damit die Leute auf den Stühlen blieben. Nicht daß es in dieser Topographie des Taumels einen einzigen Augenblick stille gewesen wäre. Immer gab es was zu erzählen und am meisten von denen, die ohnehin ihren ganzen Tag hier verbrachten. Selten waren die Gespräche ergebnisorientiert. Trotzdem funktionierte die vor der oralen Hysterie draußen hermetisch behütete – Achtung: Kalauer! – Oral history. Wohl weil deren Protagonisten stilsicher auch an den richtigen Stellen weinen konnten.«
Zwischen den »Distinktionsverlierern« und sozial Geächteten war ein Glück beheimatet, »da lebten sie auf, lebten sie vorübergehende Gleichberechtigung. Und fühlten sich als Subjekt.« Man sollte diese Sätze ganz und gar ernst nehmen. Michael Rudolf spricht hier ohne satirische Camouflage: »die Welt – und was für eine – in einer Nußschale.« – »Im Bürgerhof operierte die Kommandoebene eines Lebensverschönerungsvereines […]. Im Bürgerhof kam ich mir vor wie in einem Paralleluniversum: unendlich nah an der albernen Sinnestäuschung, die von der Menschheit als Leben hingenommen wird, und doch un(an)greifbar und Welten davon entfernt.«
Nicht greifbar und mitten im Leben – jedoch in einem Leben, das mit dem gewöhnlichen, realistisch abschilderbaren ›Leben‹ nichts gemein hat, mit dem Leben der Honoratioren und Dicketuer und »Kaufleute und Lokalpolitiker«, gegen deren herrschende Gegenwart eine Idee des Lebens steht, von deren Finalität Michael Rudolf im Rückblick auf den Abriß des Bürgerhofes etwas preisgibt, und zwar in einer kaum verschlüsselten absurden Figur: »Dem Wirt half dieser bittere Gegenschlag des Daseins wenigstens, den Kampf gegen seinen Selbsterhaltungstrieb zu gewinnen.«
Ich hatte das große Glück, Michael Rudolf 1994 kennenzulernen. Wir hatten bis dahin ein paarmal miteinander korrespondiert und telephoniert, und nun kauerten wir in der Frankfurter Messekoje seines Verlages Weisser Stein, mit dem er – unter beträchtlichem finanziellen Verlust – Autoren wie Gerhard Henschel, Susanne Fischer, Fritz Tietz und Eugen Egner die Tür zur großen Verlagswelt aufstieß.
Wir tranken irgendeinen hessischen Bierrotz und schienen uns zu verstehen. Zwei Jahre später kampierten wir dann in meiner Wohnung und schrieben Bier! Das Lexikon. Michael, der in der Titanic (4/1994) mit einer Parodie auf die Verkostungsliteratur die Blaupause für das schließlich juristisch von allerlei Seiten schwer bombardierte Buch geliefert hatte, war schon damals gesundheitlich angeschlagen – er machte vor allem die höllischen acht Jahre als Brauingenieur und Schichtleiter in der Greizer Schloßbrauerei für seine oftmals marode Verfassung verantwortlich –; aber in den zwei Wochen, in denen wir wie bekloppt zwischen Batterien von Bierflaschen aus aller Welt herumstaksten und nebenher unseren Unsinn in die Tasten klopften, war er nicht selten fast entfesselt ausgelassen. »Mit dir ist gut arbeiten«, sagte er plötzlich eines Abends strahlend, und ich muß gestehen, daß nahezu alles, was von dem Buch bleibt, von Michael stammt – natürlich auch mein Lieblingseintrag: »Beck’s Spitzen-Pilsener – 4,7% Brauerei Beck & Co. Bremen. Eigenartig: schmeckt immer so, wie man sich gerade fühlt, also meistens schlecht.«
Annäherungsweise begriffen habe ich erst Jahre danach, als er schlagartig keinen Schluck mehr vertrug und die peinigenden Schmerzen und multiplen depressiven Beschwerden den manischen Arbeiter zur wiederholten Krankschreibung zwangen, daß in dieser beiläufigen Biernotiz sein ganzes Lebensgefühl ausgedrückt war. Er schrieb trotzdem hartnäckig weiter und ließ ein bewunderungswürdiges Buch auf das nächste folgen: seinen wahrlich »wunderbaren Pilzführer« Hexenei und Krötenstuhl, den Roman Morgenbillich – die ostdeutsche Antwort auf den legendären Arnold Hau von Bernstein, Gernhardt und Waechter –, den in der Öffentlichkeit völlig untergegangenen, grandios albernen Kolportagepolitporno Chefarzt Dr. Fischer im Wechselbad der Gefühle oder die kleine monographische Liebeserklärung an die Artrockband Yes, Round About Jutesack. Michael war ein Genie.
Ich würde gerne von vielem erzählen; es ist hier kein Platz. Nie ist Platz. Ich würde gerne von unseren Forschungsreisen ins Böhmische erzählen, auf denen uns das montypythoneske Metal-Trio Primus erquickte, bis wir vor Vergnügen fast ins Auto kotzten, oder von unseren in jedem Frühjahr anberaumten Biertouren, deren erste in einer komatösen Pkw-Fahrt kulminierte, bei der uns der Allmächtige beigestanden haben dürfte und die wir mit einem Rockkassettenkonzert in meinem Wagen krönten, das die Bewohner des von Michael mehrfach porträtierten Dörfleins Aufseß nie vergessen werden.
Dieser duale Radau- und Klamaukkreis erweiterte sich auf Betreiben Michaels, der den normierten Gesellschaftsmenschen als Pest empfand und die freundschaftliche Geselligkeit über alles schätzte. Bald war ein stabiles Vergnügungsteam gebildet, das standhaft dem »Qualitätspilsener« (Michael) zusprach und es sich ein paar Tage pro Jahr sackrisch gutgehen ließ, inklusive der Kultivierung extraterrestrischer Katerphänomene.
Ich würde gerne erzählen von einem Abend in Aufseß, an dem wir uns ungeplant und stundenlang ausnahmslos in den allerdümmsten Phrasen unterhielten und dabei lachten, wie vielleicht noch nie gelacht worden war. Oder erzählen würde ich gerne von einem wahnsinnigen Verkostungsnachmittag bei Tucher-Bräu in Fürth, an dem uns der damalige Boß Franz Inselkammer nicht nur sein gesamtes Monstersortiment vortrank, sondern der Welt auch die Sentenz »Biertrinken ist erlebbare Realität« schenkte, die Michael in der Folge wie eine Art Zauberwort immer wieder aufgriff.
»Erlebbare Realität«: Das ist ein Schlüssel für Michaels Werk, im spöttischen und im emphatischen Sinn. An der Realität zu verzweifeln, zugleich verzweifelt zu versuchen, sie zu gewinnen, für sich und gegen die Wirklichkeitsmodellierungen derer, die einem immerzu nachstellen, indem sie einem über ihre Agenturen einhämmern, was man als ›Welt‹ zu akzeptieren habe – von diesen bisweilen grausamen Zwiespalterfahrungen erzählen Michaels melodiöse, grantige, bübisch übermütige, sorgsam krumme Geschichten und Satiren, und diesen Riß zwischen gelungener Welterfahrung, die Michael am Schreibtisch, unter Freunden, in der Familie, in der Rockmusik und in der idyllischen Natur ab und an machen konnte, sowie den unauslotbaren, tiefen Daseinszumutungen hat er, der von seinen Qualen hie und da in Andeutungen sprach, nicht mehr ausgehalten, als er am 2. Februar dieses Jahres um die Mittagszeit das Haus verließ, nur mit einem Rucksack, in dem ein Strick lag.
»Auch nicht angezweifelt werden darf die Dignität einer funkelnd hellgrünen Zitronenfalterraupe beim Schlürfen der Bierpfützen unseres Tisches. Diese Kreatur hatten wir schon in Heckenhof angetroffen, wo sie ihrer Daseinsform weitere Glücksmomente zufügte.« Das steht im letzten Kapitel des Pilsener Urknalls, in der Eloge »No Sleep ’til Nankendorf«. Zugefügte Glücksmomente – ich bin mir sicher, Michael hat dieses Oxymoron, das durch eine kleine Verschiebung, eine winzige Abweichung vom konventionellen Sprachgebrauch (Glücksmomente, die sich fügen o. ä.) entsteht, bewußt gewählt.
Ich habe diese unscheinbare, kunstvoll verhüllte Formulierung erst in diesen Tagen als das wahrgenommen, was sie ist: als bedeutendes Beispiel oder Moment der Poetologie, auf der Michaels Texte aufruhen und die seinen Arbeiten jenen ganz und gar eigentümlichen, barocken, enigmatischen und zugleich luftigen Sound verleiht, jenes spielerische Flair, in dem sich das Dunkle, Bedrohliche, schwer Sagbare in der Posse, im witzigen Kniff, in der Wortverdrehung, im artistischen Jux, in der Pointe vermummt. Wovon man nicht sprechen kann, damit treibe man Schabernack.
Seltener griff Michael zu den Mitteln der uneingeschränkt und notgedrungen brachialen Polemik – zuletzt in seinem Streifzug durch die sprachlichen und allgemeingeistigen Verwüstungen, die der nicht endende Kapitalismus anrichtet (Atmo. Bingo. Credo – Das ABC der Kultdeutschen, Berlin 2007), früher in kulturkritischen Interventionen, die der Band Trost und Unrat (Mainz 2001) versammelt. Das Cover ziert ein Bild von Ernst Kahl, auf dem ein Mann mittleren Alters am Galgen baumelt und von einem Kind als Schaukel benutzt wird, und die »Abrechnungen« und »Grobheiten« berichten von »mottentief im Haarkleid der Mutter Erde verborgen liegen[den] ostdeutsche[n] Kleinstädte[n]«, sie verhöhnen die Religion, das Fernsehen und die Zeitschrift Rolling Stone, für die Michael im WM-Sommer 2006 eine anbetungswürdige Abrechnung mit dem Fußball schrieb, sowie »diese überflüssige Drecksblase« der Musikjournalisten überhaupt, und sie vernichten den Deutschen als Gattungswesen und das von ihm verunstaltete Land, für welche Michael das Arno Schmidtsche Verdikt von der »Faß=Zieh=Nation« verwandte. Dem Buch vorangestellt hatte er ein Motto von Emile Cioran: »Habe ich die Fresse von einem, der hienieden irgendeine Aufgabe hat?«
Auf der vorletzten Seite des Pilsener Urknalls ist ein Photo zu sehen. Drei schwarzgekleidete Gestalten, von hinten aufgenommen (rechts Michael, in der Mitte Ina, links ich), schlendern einen sacht ansteigenden Feldweg in der Fränkischen Schweiz hinauf; am blitzblanken Horizont lagert eine schöne, buschig ausfransende Hecke; die Bildlegende, die Michael daruntergesetzt hat, lautet: »Die Himmelsrichtung.«
Er hat sich in der Fränkischen Schweiz wohlgefühlt; vielleicht war er in diesen versunkenen Tagen auch stundenweise glücklich. Denn geschrieben hat er über unsere jährlichen Ausflüge ins Reich der Weltruhe: »Wiese, Wald und Weide wechseln wie nicht gescheit. Die Nachmittagssonne sengt auf die Hochalbflächen, die Luft flimmert, die Köpfe dampfen bedrohlich, und Flüssigkeitsaufnahme dürfte jeden Moment essentiell werden. Ein bißchen in den Schatten legen könnte auch nicht schaden – die Luft ankucken, schweigen, Gedanken fassen oder in süßen Albträumen schwelgen.«
Am Montag wurde Michael Rudolfs Leichnam in einem Wald in der Nähe von Greiz von einer Pilzsammlerin gefunden. Michael Rudolf hat sich erhängt. Er wurde fünfundvierzig Jahre alt und hinterläßt seine Frau Ina und seine Tochter Eva.