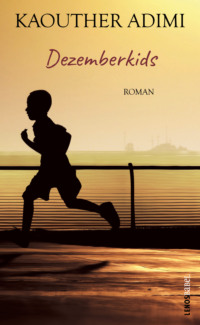Loe raamatut: «Dezemberkids»

Kaouther Adimi
Dezemberkids
Roman
Aus dem Französischen übersetzt und mit einem Nachwort versehen von Regina Keil-Sagawe

Die Übersetzung aus dem Französischen wurde vom SüdKulturFonds in Zusammenarbeit mit Litprom e. V. – Literaturen der Welt unterstützt.
Dieses Buch erscheint im Rahmen des Förderprogramms des französischen Aussenministeriums, vertreten durch die Kulturabteilung der französischen Botschaft in Berlin.

Titel der französischen Originalausgabe:
Les petits de Décembre
Copyright © 2019 by Editions du Seuil
E-Book-Ausgabe 2020
Copyright © der deutschen Übersetzung
2020 by Lenos Verlag, Basel
Alle Rechte vorbehalten
Covergestaltung: Lenos Verlag, Basel
Coverfoto: Hibiki Nakata / Shutterstock
eISBN 978 3 85787 986 9
Die Autorin
Kaouther Adimi, geboren 1986 in Algier, lebt und arbeitet seit 2009 in Paris. Sie veröffentlichte bisher vier Bücher, die zahlreiche Preise erhielten. Nach Des ballerines de papicha und Des pierres dans ma poche (dt. Steine in meiner Hand, Lenos 2017) war ihr dritter Roman Nos richesses (dt. Was uns kostbar ist, Lenos 2018) für den Prix Goncourt 2017 nominiert und wurde mit dem Prix Renaudot des lycéens und dem Prix du Style ausgezeichnet.
Die Übersetzerin
Regina Keil-Sagawe, geboren 1957 in Bochum, arbeitete nach ihrem Studium der Romanistik und der Germanistik als Universitätsdozentin und Kulturjournalistin. Seit rund dreissig Jahren übersetzt sie maghrebinische Belletristik, u. a. von Mahi Binebine, Boualem Sansal, Yasmina Khadra, Azouz Begag, Leïla Marouane, Albert Memmi, Driss Chraïbi, Cécile Oumhani und Youssouf Amine Elalamy; Lyrik u. a. von Habib Tengour und Mohammed Dib. Als Mitglied der Weltlesebühne e. V. organisiert und moderiert Regina Keil-Sagawe Übersetzungslesungen und leitet Workshops zu literarischen Übersetzungen. Sie lebt in Heidelberg.
Für Koteb, eines von den Kids.
Inhalt
Die Autorin
Die Übersetzerin
PLAN DER CITÉ DU 11-DÉCEMBRE-1960 IN DELY BRAHIM, ALGIER
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Das Ende
Nachwort
»Ein paar Kids proben den Aufstand, und im Nu ist das ganze System gestört«
Anmerkungen
Der Junge suchte.
Nach einem Weg, kaum angedeutet.
Tastend kam er voran.
Da verlor sich der Pfad.
Im Regen ertränkt.
Und der Regen, er fiel.
Mohammed Dib,
L’Enfant-jazz
PLAN DER CITÉ DU 11-DÉCEMBRE-1960 IN DELY BRAHIM, ALGIER

1
Algier im Februar. Sturmböen, Nieselregen, sinkende Temperaturen. Die Stadt ertrinkt, ertränkt ihre Einwohner gleich mit. Überall Schlamm, man hat Mühe zu laufen. Zögert, ob man überhaupt aus dem Haus gehen soll, nie ist man warm genug angezogen. In den Bussen ist es eisig, die Klassentüren knallen im Luftzug, weil die Fensterscheiben zerbrochen sind, und die auf den Terrassen ausgespannten Laken sind wasserdurchtränkt.
Der Himmel verhangen, mit Wolken grau und schwer vom Regen, der schon bald so manche Stadt im Land überfluten wird. In den Bäumen ein Knacken und Knarren, das die Passanten in Angst versetzt. Die Vögel verstummt. Patschnass kehren die Kinder von der Schule zurück, mit schlammverschmiertem Schuhwerk.
Im Stadtzentrum kommen die Autos nur mühsam voran. Die Polizisten haben durchsichtige Regenmäntel über ihre blauen Uniformen gestreift. Sie versuchen, den Verkehr in halbwegs geordnete Bahnen zu lenken. Aber sind sie wirklich zu etwas nutze? Sind sie hilfreicher als eine gewöhnliche Ampel? An der Antwort ist nichts zu deuteln, hundert Prozent der Algerier glauben, dass die Polizei das heillose Verkehrschaos in der Weissen Stadt eher verursacht denn behebt. Das wissen auch die Polizisten, deshalb sind sie ständig leicht gereizt. Zur Verkehrsregelung versetzt zu werden gilt als Strafe, als Demütigung. Der unbedeutendste Vorgesetzte kann seinen Untergebenen beim geringsten Verdruss dazu verdonnern, sich wochenlang an einem Kreisel die Beine in den Bauch zu stehen, mitten im Winter oder im Hochsommer bei drückender Hitze.
Auf Höhe der Schlucht der Wilden Frau hat sich eine riesige Schlange gebildet. Die Autofahrer sind nervös. Es wird geflucht, was das Zeug hält. Man kommt nur millimeterweise voran. Auf dem Rücksitz halten die Kinder durch die beschlagenen Scheiben hindurch Ausschau nach dieser berühmten Wilden Frau, die sie so fasziniert. Im 19. Jahrhundert soll sie hier mit ihren zwei Kindern gelebt haben, die sie nach dem Tod ihres Mannes alleine aufzog. Eines Tages, als besonders schönes Wetter war, brach die kleine Familie zum Picknick in das Wäldchen am Oued Kniss auf. Die Kinder trieben sich gar zu gern dort herum. Sie wussten, sie durften sich nicht in die Nähe der hochgefährlichen Schlucht begeben, aber es waren keine sehr artigen Kinder, sie tobten gern und balgten herum. Die Mutter, erschöpft, hielt kurz im Schatten eines Baums Siesta. Als sie aufwachte, waren die Kinder weg!
Nachbarn, Freunde, Gendarmen suchten die ganze Gegend ab. Bei Einbruch der Nacht unterbrach man die Suche. Die Mutter weigerte sich, nach Hause zu gehen, schrie sich weiter die Seele nach ihren lieben Kleinen aus dem Leib. Und verlor den Verstand. Niemand vermochte sie je dazu zu bewegen, den Wald zu verlassen.
Man erzählt sich, dass man sie an manchen Abenden noch immer sehen kann, am Rande der Schlucht. Wer sie erblickt hat, der schwört, dass sie in Lumpen gehüllt durchs Ruisseau-Viertel irrt. Man muss auf der Hut sein, darf sich ihr nur auf Zehenspitzen nähern, denn sobald sie einen entdeckt oder das leiseste Geräusch vernimmt, flüchtet sie hinter dichtes Gestrüpp.
Die Regentropfen, die um die Wette über die Wagenscheiben rinnen, trüben die Sicht; selbst mit weit aufgerissenen Augen gelingt es den Kindern nicht, dort die Silhouette der Wilden Frau zu entdecken. Die Strassen sind ein einziger Albtraum. Das Gehupe hallt in der allgemeinen Gleichgültigkeit wider. Die Fahrzeuge kommen nur mühsam voran, und die Fahrer, die entnervt sind, angespannt und erschöpft, fahren am Ende über Bürgersteige und Rettungswege.
Ab und zu macht ein Polizist von seiner Trillerpfeife Gebrauch und rudert heftig mit den Armen, »Los! Los! Weiterfahren!«, oder er winkt, wenn er gerade schlecht drauf ist, ihm die Nase eines Fahrers oder Beifahrers nicht passt, den armen Kerl mit knapper Geste an den Strassenrand, was dann noch weitere Staus zur Folge hat. Dann hebt ein langer Handel an zwischen Fahrer und Polizist, der nicht selten im Entzug des Führerscheins mündet. Wenn der arme Teufel einen in der Familie hat, der bei der Polizei, der Gendarmerie, der Armee oder auch nur im Rathaus arbeitet, darf er hoffen, ihn schnell zurückzubekommen. Andernfalls wird sein Leben zur Hölle, denn in Algier ohne Auto voranzukommen ist kaum möglich.
In diesem Februar 2016 hofft man im ganzen Land, es möge keine verheerenden Überschwemmungen, keine Toten geben. Hofft, dass die Ernte nicht in den Fluten versinkt. Der Regen ist ein Segen Gottes, der Gedanke ist niemandem fremd, und ein jeder stimmt dem zu, aber im Lauf der Tage erweist sich dieser Segen als zunehmend lästig, zäh und beschwerlich.
In manchen Regionen hat der Regen ganze Dörfer überschwemmt. Die Strassen sind mit Ästen, Schrott, Blech und Abfall übersät. Die Busse, die sonst die entlegenen Weiler mit der nächsten Stadt verbinden, müssen für unbestimmte Zeit den Betrieb einstellen, was die Erwachsenen um ihre Arbeit, die Kinder um ihren Schulbesuch bringt. Aus dem Landesinneren hat das Fernsehen Bilder von Fahrzeugen übertragen, die von reissenden Schlammfluten fortgeschwemmt wurden. Die Leute jammern, dass der Staat keine Unterstützung schickt und wie so wenig Regen das ganze Land lähmen kann, aber kein Mensch wagt es, allzu lautstark den Regen zu kritisieren. Er ist das Werk Gottes.
Doch ein wenig Angst hat man schon. Man hat das Hochwasser des Jahres 2001 nicht vergessen, das das Babel-Oued-Viertel zerstört, fast tausend Todesopfer gefordert und Millionen von Dinar verschlungen hatte. Mancher Körper wurde nie wiedergefunden, und die Kinder von damals, heute junge Erwachsene, hoffen noch immer, selbst nach so vielen Jahren, auf die Rückkehr von Vater oder Mutter.
Anstelle von Gräbern Hunderte von Geschichten.
In der Cité du 11-Décembre in Dely Brahim legen mehrere Männer grosse auseinandergeklappte Pappkartons vor ihren Häusern aus, um einen halbwegs trockenen Zugang zu haben. Am Vortag war Adila, eine im ganzen Viertel bekannte Mudschahida, also eine ehemalige Unabhängigkeitskämpferin, im Schlamm ausgerutscht, und nun tut sie keinen Schritt mehr ohne ihren Gehstock. Das Rathaus weigert sich trotz der zahlreichen Bürgerproteste, die kleinen Strassen, die zu den Häusern führen, zu asphaltieren. In ordentlichem Zustand, weil regelmässig gewartet, sind nur die Strassen zu den Anwesen der Generäle.
Die Cité du 11-Décembre gibt es seit 1987. Anfangs umfasste sie 111 Parzellen, auf denen zum Teil schon die Häuser der einstigen Kolonialherren standen. Man kann sie leicht unterscheiden: Sie haben nur eine Etage, die modernen Bauten dagegen zwei oder drei.
Sämtliche Grundstücke wurden an Angehörige der Armee verkauft, ohne dass man die Siedlung deshalb je als »Militärsiedlung« bezeichnet hätte. Zu den erwähnten 111 Parzellen kamen später 74 weitere hinzu. In der Mitte dieses Ensembles, gegenüber dem Haus von Adila, liegt ein rund anderthalb Hektar grosses Terrain, unter dem bis zum Jahr 2010 die Gasleitungen verliefen.
Welche Pläne hatten der Stadtplaner, der Architekt oder der damals zuständige Funktionär wohl für dieses grosse Terrain gehabt? Vermutlich wollten sie dort Bäume pflanzen, ein paar Spielplätze anlegen, dazu Sitzbänke und hier und da eine Bahn fürs Pétanque-Spiel der Rentner. Nichts von all dem geschah, man überliess es sich selbst. Ebenso wenig wurden die kleinen Strassen asphaltiert, die zu den rund hundert Häusern führen. Die Stadt weigerte sich zu zahlen, mit der Begründung, das Verteidigungsministerium habe die Siedlung ja in Auftrag gegeben, und dieses machte sich nie die Mühe, auf die Anfragen einiger Soldaten zu antworten, die, an Disziplin und Respekt vor der Institution gewöhnt, stets sehr höfliche Schreiben verfassten, in wenig eindringlichem und schon gar nicht drohendem Ton.
Und so blieb das Terrain über Jahre hinweg einfach Brachland. Hin und wieder liessen sich dort ein paar streunende Hunde sehen. Doch nie sah man kleine Mädchen beim Seilspringen oder Gummitwisten, nirgendwo Schaukeln, nirgends Ruheständler, die gemächlich ihre Pétanque-Kugeln schoben. Nichts als ein dreckiges, an Regentagen verschlammtes, den Rest des Jahres über staubtrockenes Gelände voll Geröll und Felsgestein, dazu loses Gestrüpp, das im Winde trieb, der winters mächtig wehen konnte, und ein paar herrenlose Mülltonnen.
Eines Tages, vor vielleicht zwanzig Jahren, machte sich eine Gruppe von Kids daran, das Gelände zu säubern, Tore zu improvisieren, Grenzen abzustecken und sich einen Bolzplatz einzurichten. Und seit nunmehr (vielleicht nicht ganz) zwanzig Jahren wird der Platz von den Kindern und Jugendlichen der Siedlung, aber auch denen aus dem Viertel und der näheren Umgebung zum Kicken genutzt, in Zigtausenden von Matchs mittlerweile. Oh, ein Fussballplatz, wie er im Buche steht, ist es nicht. Den grünen Rasen, die exakten Linien, die Netze im Tor, all das kann man vergessen. Auf den ersten Blick sieht er wie ein Stück Brachland aus. Aber nur auf den ersten Blick.
2
Am 2. Februar 2016 preschen zwei vielleicht zehnjährige Jungs, Dschamil und Mahdi, im strömenden Regen über die grosse Brache in der Cité du 11-Décembre-1960. Sie spielen sich den Ball zu und versuchen, nicht auszurutschen. Einer der beiden steckt in einem grossen Juventus-T-Shirt, der andere hat ein Trikot der algerischen Nationalmannschaft über seinen dicken, grässlich kratzenden Rollkragenpulli gestreift, in den seine Mutter ihn gezwängt hat. Sie nähern sich dem hinteren Rand des Feldes, wo die elfjährige Ines in einem riesigen weissen T-Shirt mit dem Logo der algerischen Armee in einem Tor aus Brettern und Backsteinen steht. Ein altes weisses Bettlaken wurde gespannt, um die Bälle zu halten. Von ferne, sich im Winde blähend, sieht es aus wie ein grosses Gespenst.
Ines hört, wie Dschamil und Mahdi sich etwas zurufen, aber sie ist zu weit weg, um das Geringste zu verstehen, und das Rauschen des Windes verzerrt ohnehin jeden Ton.
Die drei Kids sind glücklich über den Dauerregen, der seit letzter Woche anhält. Ihm ist es zu verdanken, dass die Jugendlichen das Feld geräumt haben, das sie normalerweise mit ihren Grossturnieren tagelang in Beschlag nehmen. Für den Moment hat der Regen sie verjagt. Sie sitzen zu Hause, im Warmen, vor ihrem Computer. Ines, Dschamil und Mahdi fürchten weder Regen noch Schlamm.
Wenn sie spielen, stellen sie sich vor, sie seien auf einem echten Fussballplatz mit grüner Rasenfläche und Toren, wie man sie im Fernsehen sieht. Die Erwachsenen, die mit ihren Pappkartons zugange sind und ihnen lächelnd zuschauen, sind ihnen egal. Manche feuern sie an, noch schneller zu laufen, mit leicht spöttischem Unterton. Den Kindern macht das nichts aus, denn sie sind von einer rasenden Menge umringt, die ihre Vornamen skandiert: »Mah-di! Mah-di! Dscha-mil! Dscha-mil! I-nes! I-nes!« Mit dem Ball am Fuss saust Mahdi los, quer durchs halbe Stadion, ihm wachsen Flügel. Er spielt den Ball Dschamil zu, der ihn aufnimmt und das Tor anvisiert. Jeden Augenblick kann er hinknallen, immer glitschiger wird der Schlamm, doch er hält die Balance und stösst einen kleinen Schrei der Genugtuung aus, als er es bis kurz vors Tor geschafft hat.
Der Wind legt zu, die Kinder sind klatschnass, doch komplett ins Spiel vertieft.
Dschamil stoppt jäh, zwei Meter vor Ines, die mit vorgebeugtem Oberkörper dasteht und die Arme weit auseinanderreisst. Er zögert. Ines, den Pony mit der Haarspange nach hinten geklemmt, zieht die Brauen hoch. Der Regen prasselt. Mahdi brüllt: »Los, mach ’nen Treffer!« Dschamil versucht, alles auszublenden, das Geräusch der Regentropfen, das Schmatzen seiner Sneakers im Schlamm, die anfeuernden Zurufe seines Freundes, das hochkonzentrierte, gerötete Gesicht von Ines, er schliesst die Augen, macht sie wieder auf und … schiesst. Auf den Rängen springen die imaginären Zuschauer mit angehaltenem Atem von ihren Sitzen. Mahdi stösst einen gewaltigen Schrei aus. Ines schnellt vor und bekommt den Ball im Flug zu fassen, bevor sie auf die Knie fällt. Sie springt wieder auf, dreht sich einmal um sich selbst und macht das Victoryzeichen. Ein strahlendes Lächeln erhellt ihr braunes Gesicht.
»Oh, verdammt!«, flucht Dschamil.
Auf den imaginären Rängen jubelt die rasende Menge: »I-nes! I-nes! I-nes!« Kameraschwenk, Nahaufnahme von Ines, die den Ball an die Brust presst.
Es ist 18 Uhr, und endlich hört es auf zu regnen. Es ist schon dunkel.
Die Kinder gehen zu Ines nach Hause. Dazu müssen sie nur das Gelände verlassen und die kleine Strasse überqueren. Sie öffnen das schmiedeeiserne Gartentor, und schon stehen sie vor Jasmin und Adila, Ines’ Mutter und Grossmutter, die regensicher unter einem Vordach vor der Haustür, einer ganz massiven Holztür, sitzen. Jasmin mit der Kippe, Adila mit einer Tasse Tee in der Hand, beide in wattierten Morgenmänteln. Die drei Kids säubern ihre verschmierten Sneakers auf dem Hof, während die beiden Frauen sie gutgelaunt fragen, wie das Spiel gelaufen ist. Ines erzählt, wie es ihr gelungen ist, den Torschuss zu verhindern. »Ich war mir so sicher, dass Dschamil in die rechte Ecke zielen würde, ich weiss nicht, warum, ich hatte halt so ein Gefühl und hab mich schon ein bisschen zur Seite gebeugt, und dann merkte ich im letzten Moment, dass er nach links linste, und konnte im selben Augenblick, in dem er schoss, loshechten und den Ball abfangen. Die beiden waren ganz grün vor Wut!«
»Waren wir gar nicht!«, protestieren Dschamil und Mahdi im Chor. Die Frauen lachen und klatschen Ines Beifall. Adila niest, ein Zeichen, dass sie dringend ins Haus zurückmuss. Jasmin drückt ihre Zigarette im Tontopf vor der Haustür aus und folgt ihrer Mutter nach drinnen.
Und jetzt ist es Mahdi, der sich über seinen Freund amüsiert: »Dschamil, du hast vielleicht ein Gesicht gemacht, als du gesehen hast, dass Ines den Ball gehalten hat.«
»Stimmt doch gar nicht! Und ausserdem hab ich nur mit halber Kraft geschossen.«
»Von wegen«, ruft Ines. »Klar wolltest du den Ball ins Tor kriegen, dein Gesicht war krebsrot, ausserdem hast du kurz davor die Augen geschlossen, was sollte das denn? Hast du gebetet?«
»Jetzt halt aber mal die Luft an!«
Im Wohnzimmer schaltet Adila den Fernseher ein, um wie jeden Abend die Nachrichten von Canal Algérie zu sehen. Die Sprecherin, eine grosse Blondine mit knallroten Lippen, redet von der baldigen Fertigstellung einer neuen Sozialsiedlung am Stadtrand. Mit strahlendem Lächeln verkündet sie, dass bald Tausende von Familien topmoderne Wohnungen bekommen werden.
Adila wettert: »Und kein Wort davon, wie schwierig das wird, ohne Auto oder gescheiten Nahverkehr zur Arbeit zu kommen? Das ganze Land habt ihr euch einverleibt, ihr Ganoven, und jetzt teilt ihr Brosamen aus!«
Durch das offene Küchenfenster hört man den Regen, der wieder zu pladdern anfängt. All diese Geräusche haben doch etwas Beruhigendes – anders als die Stille, die seltsamerweise sehr lärmend sein kann, denkt Jasmin. Natürlich war es idiotisch von ihr, andauernd solche Angst zu haben. Jasmin weiss das und erzählt keinem Menschen davon.
Wenn sie abends heimkommt, hat sie immer Angst, das Haus leer vorzufinden. Ihre Mutter ist trotz ihres Alters viel unterwegs. Vor zwei Jahren hat sie einen Verein für Frauen gegründet, die Opfer häuslicher Gewalt geworden sind. Und ihre Tochter lässt, wenn sie nicht gerade Schule hat, kein einziges Fussballmatch in der Siedlung aus, ständig sitzt sie am Feldrand und schaut zu.
Sobald sie die Haustür geöffnet hat, tastet Jasmin im Dunkeln nach dem Schalter, den sie ganz schnell drückt, um die Finsternis, die bösen Geister oder die Monster zu vertreiben. Während der paar Sekunden zwischen dem Moment, in dem sie heimkommt, und dem, wenn das Licht angeht, hat sie den Eindruck, es ringsum flüstern zu hören, und sie könnte schwören, dass sich in den Winkeln des Hauses die entsetzlichsten Kreaturen ducken, unter den Tischen, den Stühlen, im Badezimmer, und nur darauf warten, auf sie zuzukriechen. Das Licht vertreibt all die seltsamen Wesen ins Obergeschoss, wo sie sich unter den Betten verstecken. Manchmal stellt sie sich vor, dass das Licht nicht angehen will, die Tür hinter ihr ins Schloss fällt und das Geflüster laut und lauter wird, ihr entgegenschiesst und sie verschlingt. Dann pocht ihr Herz heftig, sie spürt, wie ihr die Haare zu Berge stehen, und hätte sie vor der Lächerlichkeit nicht noch mehr Angst als vor den unsichtbaren Monstern, sie würde laut schreiend davonrennen.
Die verrückte Alte, die im Nebenhaus wohnt, die zahnlose Alte mit ihrem hennaroten, zum Kranz geflochtenen Haar fängt immer hämisch zu kichern an, wenn Jasmin ihr über den Weg läuft: »Ein Haus voll Frauen, das muss ja böse Geister anlocken! Ein Haus voll Frauen, das muss ja die bösen Geister anlocken!«
Natürlich ahnt die Familie nichts von Jasmins Ängsten. Was sollte denn Ines, ihre elfjährige Tochter, denken, wenn sie wüsste, dass ihre Mutter sich vor Monstern fürchtet, die unter Möbeln lauern, und dass sie das Haus nicht betreten kann, ohne gleich das Licht anzuknipsen? Ines, die, ohne zu zögern, mitten in der Nacht aufsteht, um ein Glas Wasser zu holen. Und was würde Adila, ihre Mutter, sagen, die noch nicht einmal volljährig war, als sie sich heimlich dem FLN anschloss, die für ein unabhängiges Algerien kämpfte und bedenkenlos der nächtlichen Ausgangssperre trotzte?
Die Stimmen der Kinder reissen sie aus ihren Gedanken. Sie verabschieden sich voneinander, lachen, flüstern sich Geheimnisse zu, lachen wieder hell auf. Seit der ersten Klasse kennen sich die drei. Jasmin ist froh, dass ihre Tochter so gute Freunde hat. Als sie selber klein war, war sie nur von dummen und noch dazu eingebildeten Puten umgeben.
Mit ihren nun blitzblanken Sneakers laufen die Jungs vorsichtig über die von den Erwachsenen zuvor ausgelegten Kartonstege. Sie wissen, wenn sie mit sauberen Schuhen nach Hause kommen, dürfen sie, wann immer sie wollen, wieder raus zum Spielen.
Ines läuft zu ihrer Mutter in die Küche, um ihr bei den Vorbereitungen fürs Abendessen zu helfen. Jasmin nimmt eine Pfanne aus dem Regal, während ihre Tochter den Salat aus dem Kühlschrank holt.
Jasmin macht das Radio an und dreht an mehreren Knöpfen, bevor sie auf Jazzmusik stösst. Sie stellt den Ton lauter. Mutter und Tochter bewegen sich lachend im Takt. Die Glühbirne in der Küche beginnt zu flackern. Jasmin wird bleich, doch sie sagt nichts und wartet ab. Das Licht hört auf zu flimmern. Die junge Frau kann sich entspannen. Adila sitzt noch immer vor dem Fernseher. Sie brummelt, grummelt, regt sich auf und macht sich Notizen in ein schwarzes Heft, das sie seit einigen Wochen mit sich herumträgt. In einer Ecke der Küche pickt der Goldfink der Familie in seinem Napf nach Körnern, die er knackt, während er den beiden Tänzerinnen zuschaut.
Ein paar Strassen weiter isst Dschamil mit seinen Grosseltern zu Abend, einem pensionierten General und dessen Frau, bei denen er seit dem Tod seines Vaters lebt, der 2007 bei einem Bombenattentat ums Leben kam. Seiner Mutter war es nicht gelungen, das Sorgerecht für den Sohn zu bekommen, der damals gerade mal ein Jahr alt war. Der Grossvater, vor Kummer halb verrückt, wollte den Enkelsohn in der Nähe haben. Es brauchte nur einen Telefonanruf, und das ganze System, bestehend aus Richtern, Politikern, Militärs, Geschäftsleuten, diese seltsame Maschinerie, die Tausende von Männern auf allen Verantwortungsebenen des Landes umfasst, setzte sich in Gang, um die Interessen des Generals zu wahren. Und so zog Dschamil, damals noch ein Baby, im Haus seiner Grosseltern ein und sah fortan seine Mutter nicht mehr, ausser zwei-, dreimal im Jahr unter Aufsicht des Chauffeurs.
Zur selben Zeit schaufelt Mahdi seine Tomatensuppe in sich rein. Neben ihm, im Rollstuhl, sein Vater, der im November 1999 beide Beine verloren hat. Eine Mine, von Terroristen in Baraki gelegt, einem Stadtteil im Südosten von Algier. Er war frisch verheiratet und kaum dreissig Jahre alt, als die Bombe explodierte, nur ein paar Zentimeter von ihm entfernt. Seine Frau, eine der wenigen Frauen beim Militär, befand sich gerade im Armeekrankenhaus, sie hatte einen angeschossenen Kollegen dorthin begleitet, als sie erfuhr, ihr Gatte sei ebenfalls eingeliefert worden. Unterhalb vom Knie ging nichts mehr.
An diesem 2. Februar 2016 verschwinden alle drei Kinder pünktlich um 21 Uhr im Bett, wie an jedem anderen Abend auch.