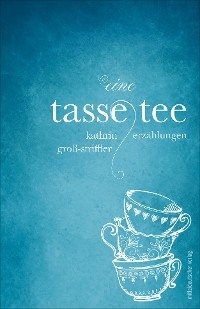Loe raamatut: «Eine Tasse Tee»

Meinen Eltern gewidmet
die hexe
Hast wohl Angst?, flüstert Tom. Gib’s zu, dass du Angst hast. Er tastet nach meiner Hand. Seine ist warm und feucht. Ich habe eine Gänsehaut. Es ist stockdunkel im Wald, und rechts und links knackt es im Gebüsch. Ein Käuzchen schreit. Wie kann man bloß mutterseelenallein dort wohnen. Ich hab’ ja so einen Verdacht, sagt Bernd, was sie mit dem Mädchen gemacht hat. Was denn, flüstert Kathi. Ich spür’, dass auch sie Angst hat. Bernd wartet eine Weile, um die Spannung zu erhöhen. Na, dreimal dürft ihr raten, zischt er dann. Kein Mensch hat das Mädchen mehr gesehen. Also was wird sie wohl mit ihm gemacht haben. An einem Tag war sie noch da, und am nächsten war sie verschwunden. Hört mal, was ist das? Wir bleiben gebannt stehen. Ein gruseliger Schrei, einmal, zweimal. Ein Hirsch, sagt Tom. Sein Vater ist Jäger, er muss es wissen. Meine Nackenhaare sind gesträubt. Am liebsten würde ich umkehren. Wieder knacken Äste, diesmal so laut, als wäre etwas – ein Mensch?, ein großes schweres Tier? – ganz in unserer Nähe. Keine einzige Straßenlampe, murrt Bernd. Er ist über einen Stein gestolpert und flucht leise. Den nehm’ ich mit, sagt er. Bernd hat gesagt: Wetten, dass ihr euch nicht traut, nachts hinter zu ihrem Haus zu laufen? Wetten? Tom hat gesagt: Ist ja wohl Peanuts, ja, das hat er gesagt, und jetzt bibbert er vor Angst. Weil sie eine Verrückte ist. Sie stammt von einem Zigeuner ab und wohnt allein in einem runtergekommenen Haus mitten im Wald. Gaga ist sie, das sagen alle im Dorf. So was von gaga. Mein Vater sagt, sie hätte als Mann zur Welt kommen sollen. Ihre Stimme ist wie ein Maschinengewehr, rattatata. Sie trägt eine alte Jeans und einen Männerhut. Wahrscheinlich hat sie eine Pistole, flüstert Tom. Kathi summt ein Lied, wohl um sich Mut zu machen. We are the champions. Klar. Ich will heim, aber sie schiebt mich weiter. Und wo hat sie es dann hingetan?, fragt Tom. Das Mädchen, mein’ ich. Wahrscheinlich im Garten verbuddelt, sagt Bernd, was weiß denn ich. Hinter uns, im Dorf, bellt ein Hund. Die hört uns doch, sagt Kathi, wenn wir uns vor ihrem Haus rumtreiben. Soll sie ja auch, sagt Bernd. Sie soll sich zu Tode fürchten. Aber auch seine Stimme klingt nicht ganz wie sonst. Am Nachmittag haben er und Kathi sich auf dem Boden gerollt. Sie hat ihn an seinen abstehenden Ohren gezogen. Da scheint die Sonne durch, hat sie gerufen und sich totgelacht. Kathi lässt sich nichts bieten. Ich wünschte, ich wäre wie sie. Sie haben sich gekloppt, weil Bernd gesagt hat: Nichts für Mädchen, ihr bleibt daheim. Können wir nicht brauchen, dass ihr mittendrin die Krise kriegt. Kathi hat verächtlich ausgespuckt. Eine Wolke hängt vor dem Mond, der grade so viel Licht gibt, dass wir den Weg erkennen können. Wieder knackt es laut. Aber ich kann nicht umkehren, ich kann nicht allein zurück. Ich halte mich an Kathi fest. Alte Hexe, knurrt Bernd. Schreibt Gedichte. Andre Leute gehen arbeiten, und sie kassiert Hartz IV und macht so einen Schwachsinn. Neben uns ertönt ein leises Wimmern. Hoch und dünn, als würde ein Tier gefressen, eine Maus vielleicht. Ich sterbe vor Angst. Ich will heim. Ich flüstere: Kommt, wir kehren um. Hab’s ja gewusst, stöhnt Bernd. Weiber. Jetzt erst fällt mir auf, dass Tom kein Wort sagt. Tom, flehe ich. Bitte. Tom brummt: Die braucht mal eine auf den Kopf. Blöde alte Hexe. Genau, bestätigt Bernd. Ruhe jetzt. Erst mal schau’n wir durchs Fenster, was sie treibt.
Das alte Haus liegt im Dunkeln, nur ein Fenster im Erdgeschoss ist erleuchtet. Wir schleichen uns an. Mein Herz pocht so laut, dass sie es hören muss. Aber sie sieht nicht auf. Sie sitzt an einem Schreibtisch und hat eine kleine Lampe brennen. Sie schreibt. Nicht mit dem Computer, sondern mit einem Stift. Auf ihrem Schoß liegt zusammengerollt ihre Katze. Die Katze folgt ihr manchmal, wenn sie im Dorf einkaufen geht. Wo der Wald aufhört, setzt sie sich hin und wartet. Auch das ist gaga. Wer hat schon mal von einer Katze gehört, die ihrer Besitzerin folgt wie ein Hund. Das Verrücktsein ist auf sie übergesprungen, sagt Kathis Mutter. Wir starren hinein. Wir rühren uns nicht. Das Licht scheint so warm, so heimelig. Ich glaub’ fast, die Katze schnurren zu hören. Sie hat die Augen zu schmalen Schlitzen geschlossen. Bernd flüstert: Ich schmeiß’ den Stein in das Schuppenfenster. Dann brüllen wir was und hauen ab. Und wenn sie uns abknallt?, flüstert Kathi atemlos. Im Dunkeln, gibt Bernd höhnisch zurück. Bevor die zu sich kommt, sind wir weg. Wir ziehen uns mit geduckten Köpfen vom Fenster zurück, bis wir wieder auf dem Weg stehen. Da schmeißt Bernd den Stein. Er trifft das Fenster nicht, sondern der Stein rumpelt gegen die Holzwand. Hexe, schreit er, und wir stimmen ein. Hexe! Deine Mutter war eine Zigeunerhure!, schreit Tom, und Bernd lacht begeistert. Kathi schreit: Fuck you! Hinter meinem Nabel kitzelt es. Ich will, dass sie diese Nacht nie vergisst. Ich will, dass sie Angst hat. Dass sie merkt, dass sie keiner leiden kann im Dorf, ich will, dass sie uns in Ruhe lässt mit ihrer Maschinengewehrstimme und ihrer verrückten Katze. Abhauen soll sie. Woanders hinziehen. Und gleichzeitig hab’ ich einen Kloß im Hals. Ich schreie: Hau ab!, und fange an zu heulen. Am liebsten würde ich noch einen Stein schmeißen. Denn sie kommt nicht raus. Sie kommt nicht raus, und sie hat auch keine Pistole. Sie zieht einfach die Vorhänge zu. Als wären wir dumme Gören, nicht der Rede wert. Los, wir hauen ab!, ruft Bernd. Wahrscheinlich holt sie die Polizei, beeilt euch! Dabei wissen wir alle, dass sie die Polizei nicht holt. Sie tut gar nichts. Wir schleichen davon. Wir müssen nicht mal rennen. Wortlos halten wir uns auf dem Weg, die anderen drei sind vor mir, ich stolpere hinterher. Ich weine immer noch. Crybaby, sagt Bernd verächtlich. Die Wolke ist weitergezogen, der Mond scheint hell.
Auch bei uns brennt nur unten im Arbeitszimmer meines Vaters Licht. Er dreht sich um und zieht mich an sich: Sag mal, hat Mama dich auch abends so spät noch rausgelassen, fragt er? Es ist doch gar nicht spät, sage ich, außerdem war ich nur bei Kathi, hab’ ich dir doch gesagt. Ist schon gut, sagt er, ich lehne mich an ihn, ich sage: Du riechst nach Zigarette, er lächelt traurig und sagt: Ich bekenne mich schuldig. Habt ihr schön gespielt?, fragt er, und ich nicke. Bald geht der Ernst des Lebens wieder los, sagt er. Ich bin so froh, dass Kathis Mama die Ferien über nach dir geschaut hat. Und dass ich so viel von daheim aus machen kann. Wir schweigen. Ich spüre seinen Arm um meine Taille. Ich schaue auf den Monitor. Was ist das, frage ich, ein neues Haus? Eine Sporthalle, sagt er. Du weißt doch, wo die Aschenbahn ist, da wird ein Sportzentrum hinkommen. Mit Restaurant, richtig schick. Krass, sage ich. Ihr werdet dort in Zukunft euren Sportunterricht haben, sagt er. Ab dem übernächsten Schuljahr. Kathi und Bernd und Tom auch? Er nickt. Klar, sagt er, das Zentrum ist für alle Schulen in Weikersheim. Weißt du, was ich nicht mag?, sage ich leise. Ich mag das Busfahren nicht. Das wusste bisher nur Mama. Er schaut mich an. Findest du, fragt er, wir sollten in die Stadt ziehen? Er sieht aus, als wäre ihm der Gedanke schon öfter gekommen. Erschrocken schüttle ich den Kopf. Weg von Kathi und Tom und Bernd? Unvorstellbar. Vielleicht, sinniert er, wär’ das gut für uns. Wir könnten das Haus verkaufen und uns eine schöne Wohnung suchen. Er schaut in meine schreckensgeweiteten Augen. Lächelt. Beruhige dich, war nur so eine Idee. Und jetzt lauf, ich hab’ noch zu tun. Er gibt mir einen Schubs. Zieh ab, Häschen, sagt er. Wir kriegen das schon hin, mach dir keine Sorgen. Was er meint, ist unser Leben zu zweit.
Aber ich bin mir da nicht so sicher. Die Tür zum Arbeitszimmer meiner Mutter ist zu. Er bringt es nicht fertig, ihre Sachen auszuräumen. Ich weiß nicht, was schlimmer ist, die geschlossene Tür oder ein neu eingerichtetes Zimmer. Es ist still im Haus. Ich mache überall Licht. Die Holzdielen knarzen unter meinen Füßen. Ich wollte, ich hätte eine Schwester oder einen Bruder. Lieber eine Schwester. Zu der könnte ich jetzt ins Zimmer und mit ihr kuscheln. Ich könnte ihr von der Dichterin erzählen. Wie sie schreibend an ihrem Tisch saß, mitten im dunklen Wald. Meine Schwester würde sehnsüchtig sagen, ich wollte, ich könnte auch Gedichte schreiben. Darauf ich: Warte, ich hol’ was. Ich würde in mein Zimmer hüpfen und ihr meine Gedichte bringen. Hab’ ich geschrieben, würde ich stolz sagen. Du? Sie wär’ blass vor Neid, würde sie lesen und ganz super finden. Du wirst bestimmt noch berühmt, würde sie sagen. Noch berühmter als die hinten im Wald. Stattdessen schaue ich nun allein auf meine Verse. Einen lese ich laut, aber meine Stimme hallt, und mir geht eine Gänsehaut auf. Ich hab’ mir vorgestellt, ich wär’ eine Blume auf dem Grab meiner Mutter. Ich beschreibe, wie es auf mich regnet, wie die Sonne auf mich scheint. Wenn ich das meinem Vater vorlesen würde, würde er weinen. Ich kann ihm nicht alles sagen. Ich muss auf ihn aufpassen. Mein Handy klingelt. Es ist Kathi. Weißt du, fragt sie laut, was mein Vater über sie erzählt hat? Du kennst doch den Heini vom Ulmerhof? Er hat sich einen Hund vom Tierheim geholt und an die Kette gelegt, und da ist sie hin und hat sich vor Heini aufgebaut und gesagt: Wenn du deinen Hund nicht frei laufen lässt, zeig’ ich dich an. Ist zu dem Köter hin und hat ihn abgemacht. Hat sich ihren komischen Hut fester auf den Kopf gedrückt und ist davonmarschiert. Das ganze Dorf kocht. Nur schade, dass wir den Stein nicht in ihr Wohnzimmerfenster geschmissen haben. Aber das kommt noch, kannst dich drauf verlassen. So schnell sind wir nicht mit der fertig. Und der Hund?, frage ich. Was ist jetzt mit dem? Der ist wieder angebunden, sagt sie. Wetten, dass sie die Polizei nicht holt. Ich bin mir da nicht so sicher. Judith?, fragt sie. Du bist doch dabei, wenn wir wieder losschlagen? Klar bin ich dabei, sage ich laut. Wusst’ ich’s doch, sagt Kathi zufrieden. Bernd hat gesagt, weil du so geheult hast … egal. Du denkst nicht, dass du was Besseres bist, bloß weil du ans Gymnasium gehst, oder? So ein Quatsch, sage ich. Bernds Mutter sagt, die Judith ist keine von euch. Sie macht eine Pause. Du weißt schon. Weil du zugezogen bist. Und weil dein Vater … und deine Mutter … Ich hab’ das Gefühl, auf einem dünnen Seil zu balancieren. Ich sage tapfer: Alles Käse. Ich sage, ich hätt’ auch gern ein Piercing im Ohr, deins sieht voll hübsch aus. Ich lass mir demnächst eins in die Nase stechen, sagt sie stolz. Toll, sag ich bewundernd. Das würd’ ich mich nie trauen. Und irgendwann, sagt sie, kommt eins in den Nabel. Geil, sag’ ich. Darfst du jetzt noch fernsehen? Klar, sagt sie. Ich guck’ noch ’nen Krimi. Ich sag’ ihr nicht, dass ich mich fürchten würde. Mein Vater erlaubt es eh nicht. Wir legen auf.
Am nächsten Tag seh’ ich die Dichterin in den Waldweg einbiegen, eine volle Einkaufstasche über dem Arm. Die Katze hat wie immer auf sie gewartet und schießt hinter einem Baum hervor und streicht mit hochgestelltem Schwanz um ihre Beine. Ein Auto kommt näher. In dem Augenblick, als es in Höhe der Abzweigung ist, stellt der Fahrer Technomusik so laut an, dass die Dichterin einen Satz macht. Äpfel kullern aus ihrer Tasche. Der Fahrer, es ist Fritz, der Sohn des Bäckers, lacht laut und fährt weiter. Sie bückt sich schweigend nach den Äpfeln und sammelt sie ein. Als sie sich wieder aufrichtet, sieht sie mich. Sie lächelt mir zu. Ich spüre, wie sich meine Mundwinkel heben, auch wenn ich es nicht möchte. Sie sagt: Diese jungen Leute. Nicht zornig, sondern traurig. Ein Apfel ist unter einen Busch gerollt, ich hebe ihn auf und reiche ihn ihr. Danke, sagt sie, lieb von dir. Sie betrachtet mich aufmerksam. Hast du noch Ferien? Ich nicke. In welche Klasse gehst du? Die fünfte, sage ich. Gymnasium. Sie lächelt wieder. Willst du mich mal besuchen?, fragt sie. Jetzt gleich?, bringe ich hervor. Wenn nun Kathi oder Bernd oder Tom mich sehen. Klar, sagt sie. Komm! Mir fällt ein, was Bernd über das Mädchen gesagt hat. Vielleicht lockt sie die in ihr Haus und macht dann was Schlimmes mit ihnen. Sie grinst amüsiert. Ich tu dir nichts, sagt sie. Ihre Stimme ist eigentlich gar nicht so laut. Ich zögere immer noch. Die Hutkrempe beschattet ihre Augen. Sie sagt, wir können auch im Garten bleiben, wenn dir das lieber ist. Ich hab’ einen Baum voller Zwetschgen. Ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll. Du kannst einen Eimer voll pflücken und mit nach Hause nehmen. Vielleicht backt deine Mama einen Kuchen davon. Ich sage ihr nicht, dass meine Mutter tot ist. Ich schaue den Waldweg hinter, der bei Tageslicht gar nicht angsteinflößend wirkt. Im Gegenteil, das Sonnenlicht fällt durch die Bäume auf den Boden und formt dort zitternde Lichtsprengsel. Schön sieht das aus, und es gibt den Ausschlag. Ich geh’ nur mit in den Garten und halte mich nah am Tor, sodass ich jederzeit davonrennen kann. Ich bin schnell, sie kann mich nie im Leben einholen. Die Katze springt immer ein paar Sätze vor uns her und wartet dann. Ein komisches Tier mit ganz langen Haaren und Bernsteinaugen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Die Dichterin schnauft ein bisschen, weil der Weg leicht bergauf geht. Sie wirkt eigentlich völlig normal, und ich entspanne mich ein wenig. Sie sagt: Ich hab’ heute früh ein Gedicht über den Wald hier geschrieben. Nicht das erste, aber wieder anders als die anderen. Wenn du willst, les’ ich es dir vor. Ich nicke geschmeichelt. Hör mal, sagt sie plötzlich und bleibt stehen. Dieses Lachen. Das ist ein Specht. Er beklagt sich, weil wir ihn aufgestört haben. Ich sag’ ihr nicht, dass ich das weiß. Mama hat mir oft die Vogelstimmen erklärt. Und dieses Keckern ist eine Elster, fügt sie hinzu. Die klauen alles, was nicht niet- und nagelfest ist. Am liebsten würde ich sie fragen, wie es ist, einen Zigeuner zum Vater zu haben. Ihre Haut ist ganz leicht dunkler als meine. Ansonsten merkt man nichts. Ich hab’ noch nie einen Zigeuner gesehen, aber ich weiß, dass sie in bunten Wagen leben und von Stadt zu Stadt ziehen. Wir sind an ihrem Haus angekommen, und sie stößt das Tor auf, das in den Angeln quietscht. Auch das Haus wirkt harmlos. Wilder Wein rankt sich über das Fachwerk. Aber reingehen kommt nicht in Frage. Ich bleibe stehen. Warte, sagt sie, ich bring’ schnell die Einkäufe in die Küche und hole dir einen Eimer für die Zwetschgen und mein Gedicht. Du kannst dich schon mal setzen. Unter einem riesigen Baum steht ein kleiner Tisch mit zwei Stühlen. Als ich sitze, springt mir das Katzenvieh auf den Schoß und beginnt zu schnurren. Das Fell ist weich und sonnengewärmt. Ich schaue auf den Schuppen. Der Stein liegt noch davor. Ich schäme mich und bin gleichzeitig auf der Hut. Vielleicht ist das ihre Masche, erst macht sie, dass man sich entspannt, und dann schlägt sie zu. Meine Güte, wenn Kathi mich hier sehen würde. Sie mag dich, sagt die Dichterin, als sie aus dem Haus kommt. Normalerweise ist sie sehr zurückhaltend. Sie heißt Emmi, übrigens. Eigentlich finde ich es schön hier. Es riecht gut, nach Moos und warmen Tannennadeln. Sie setzt sich mir gegenüber und holt etwas aus dem Eimer. Schokoladenkekse. Einen Moment lang denke ich: Und wenn sie vergiftet sind. Sie beißt selber in einen hinein. Na, wohl doch nicht. Als sie ihren Mund leer hat, fängt sie an zu lesen. Ich schaue auf ihre dünnen Haare, die an manchen Stellen grau sind. In ihrem Gedicht geht es um Wurzeln und Baumspitzen, alles verstehe ich nicht, aber den Klang verstehe ich. Und das Gefühl. Ich glaube, die macht keine Mädchen tot. Die macht auch sonst nichts Schlimmes. Als sie fertig ist, weiß ich nicht, ob ich klatschen soll oder was man sonst in so einer Situation tut. Es ist schön, sage ich. Danke, sagt sie artig. Ich geb’ mir einen Ruck. Ich schreibe auch Gedichte, sage ich und schaue auf den Boden. Aber das ist ja wunderbar, sagt sie. Bringst du mir mal ein paar und liest sie mir vor? Wirklich?, frage ich. Na klar, sagt sie und lacht. Dichterinnen müssen zusammenhalten. Ich freue mich, und gleichzeitig will ich nicht, dass sie so etwas sagt. Ich will vor den anderen damit prahlen, dass sie meine Gedichte lesen will. Oder aber ich erzähle gar nichts von dem hier, niemandem. Auch meinem Vater nicht.
Ich verlasse ihren Garten mit einem Eimer voller Zwetschgen. Besuch mich bald wieder, ruft sie mir noch nach. Ich dreh’ mich um und winke ihr zu. Sie ist aus dem Schatten des Baumes getreten und steht jetzt in der prallen Sonne. Ohne Hut sieht sie wirklich nicht wie ein Mann aus; eher wie eine alte Frau. Wieder schäme ich mich wegen dem, was wir am Vorabend getan haben. Ich steige die wenigen Stufen zum Waldweg hoch – und fahre zusammen. Nur wenige Schritte entfernt steht Tom, genauso erschrocken wie ich. Wir starren uns an. Sein rundes pickliges Gesicht verzieht sich zu einem schrägen Grinsen. Zwetschgen, sagt er. Voll krass. Wofür hat sie dir die gegeben? Dass du uns verpetzt hast? Ich schüttle den Kopf, ich bringe kein Wort heraus. Hinter mir klappt eine Tür. Die Dichterin ist im Haus verschwunden. Klar hast du uns verpetzt, sagt er. Sonst käm’ die doch nicht auf die Idee, dir was zu schenken. Du bist hin und hast dich eingeschleimt. Er steckt die Hände in die Hosentaschen. Breitbeinig steht er da. Ich erinnere mich an seine feuchte Hand und wie er gebibbert hat vor Angst. Ich tu so, als wär’ er nicht vorhanden und gehe weiter. Er greift in den Eimer und holt eine Zwetschge heraus und dreht ihre Hälften gegeneinander. Als er sieht, dass sie nicht wurmig ist, isst er sie. Wenn ich jetzt tot umfalle, bist du schuld, brummt er mit vollem Mund. Dann zieht er sein Handy heraus und wählt eine Nummer. Rat mal, Bernd, wenn ich vor dem Haus der Hexe getroffen habe, sagt er. Judith. Mit einem Eimer voller Zwetschgen. Verpetzt hat sie uns. Hab’ ich nicht!, rufe ich empört. Hör endlich auf, so einen Schwachsinn zu behaupten! Gute Idee, sagt Tom. Bis gleich. Sag Kathi Bescheid. Sie wollen auch was von abhaben, sagt er und grinst. Wir treffen uns am Raseneck. Sie sind in ein paar Minuten da. Schweigend trotten wir nebeneinander her. Als wir zu dem ausgetrockneten Bachbett kommen, sagt er: Mit der sind wir noch lange nicht durch. Lasst sie doch einfach in Ruhe, murmle ich. Sie tut doch keinem was. Tom tippt sich an die Stirn. Verhext, knurrt er.
Bernd und Kathi sind tatsächlich schon da und schauen uns erwartungsvoll entgegen. Endlich ist mal was los im Dorf. Da ist die Petze, sagt Tom. Ich hab’ euch nicht verpetzt, sag’ ich. Und was hast du dann bei der Hexe gemacht?, fragt Bernd. In seinen Augen glimmt Hass. Wag es nicht, sagen seine Augen. Denk bloß nicht, du seist was Besseres. Wer nicht für uns ist, kriegt genauso auf die Mütze wie die Alte dort hinten. Ich sage leise, sie hat mir ihre Katze gezeigt. Ach, höhnt Kathi. Einfach so. Du bist hinterhergelaufen und hast gesagt: Ich möchte gern Ihre Katze streicheln. Da hat sie dich reingelassen und dir Zwetschgen geschenkt. Das kannst du deiner Oma erzählen. Oder sonst wem. Uns jedenfalls nicht. Also spuck’s endlich aus, knurrt Bernd. Weswegen warst du dort? Ich spüre, wie mir Tränen in die Augen steigen. Oh Gott, jetzt fängt sie wieder an zu flennen, sagt Bernd. Aber weißt du was? Wir geben dir noch eine Chance. Heut Abend machen wir dort hinten ein Feuerwerk. Und du fängst vorher die Katze, dass wir ihr einen Kracher an den Schwanz binden können. Zufrieden schaut er von Kathi zu Tom. Die nicken begeistert. Ich schluchze auf. Ich muss heim, sag’ ich. Ich lass’ den Eimer stehen und renne los. Wir holen dich um sieben ab, schreit Bernd mir hinterher. Und wehe, du kommst nicht mit. Dann kannst du was erleben. Kathi ruft noch: Ohne uns hast du hier verschissen. Das ist dir klar, oder? Heulend laufe ich nach Hause.
Mein Vater ist nicht da, aber ich hab’ den Schlüssel. Das große Haus atmet laut, der Boden ächzt unter meinen Schritten. Mir ist übel, und ich renne ins Bad und beuge mich grade noch rechtzeitig über die Kloschüssel. Schokoladenstückchen schwimmen im Erbrochenen. Ich heule so sehr, dass Schleim aus meiner Nase tropft. Ich ziehe die Spülung und schnäuze meine Nase. Ich renne die Treppe hoch in mein Zimmer und reiße die Schublade auf, wo ich meine Gedichte unter der Unterwäsche versteckt habe. Ich zerfetze sie, immer noch laut weinend. Vielleicht hätten sie meiner Mama gefallen, aber meine Mama ist tot. Ich friere. Im Bett ist es warm. Ich warte, dass mein Vater zurückkommt. Ich muss eingeschlafen sein, denn ich höre ihn nicht kommen. Er sitzt an meinem Bett und fühlt mir die Stirn. Du hast Fieber, Häschen, sagt er bestürzt. Ich werfe mich in seine Arme. Papa, flüstere ich. Du hast doch gesagt, wir könnten in die Stadt ziehen. Bitte, bitte, such uns eine Wohnung. Er hält mich erstaunt von sich. Was ist passiert?, fragt er. Ich senke den Kopf. Nichts, flüstere ich. Ich hab’s mir nur überlegt. Er sagt, Willst du deinem alten Papa nicht erzählen, was geschehen ist?
Nichts ist geschehen, sage ich. Gar nichts.
Er umarmt mich fest. Ich kümmer’ mich drum, sagt er. Versprochen. Vielleicht hab’ ich schon was. Aber nun werd erst mal wieder gesund.
Bitte mach, dass es schnell geht, sage ich. Es klingelt. Es ist sieben Uhr.