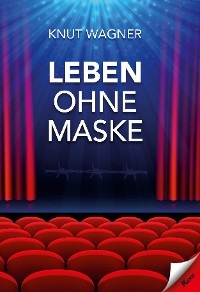Loe raamatut: «Leben ohne Maske»
Bibliografische Informationen der Deutschen Bibliothek: Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie, detaillierte Dateien sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.
Impressum:
© Verlag Kern GmbH, Ilmenau
© Inhaltliche Rechte beim Autor
1. Auflage, Oktober 2020
Autor: Knut Wagner
Layout/Satz: Brigitte Winkler, www.winkler-layout.de
Bildquelle Titelmotiv: © piai | stock.adobe.com
Foto Autorenportrait: Sascha Willms
Lektorat: Anke Engelmann
Sprache: deutsch
ISBN: 978-3-95716-328-8
ISBN E-Book: 978-3-95716-308-0
Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, Übersetzung, Entnahme von Abbildungen, Wiedergabe auf fotomechanischem oder ähnlichem Wege, Speicherung in DV-Systemen oder auf elektronischen Datenträgern sowie die Bereitstellung der Inhalte im Internet oder anderen Kommunikationsträgern ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Verlags auch bei nur auszugsweiser Verwendung strafbar.
Der Abdruck des Gedichtes „Sozialistischer Biedermeier“ erfolgt mit freundlicher Genehmigung von Irene Bartsch.
Knut Wagner
Leben ohne Maske

Dieses Buch ist unserem Sohn gewidmet.
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Prolog
Dank
Erster Teil (1965 - 1967)
Auftritte im Studentenkeller
Zweiter Teil (1967 bis 1969)
Eine Frau fürs Leben
Dritter Teil (1969 bis 1971)
Theatertraum I
Vierter Teil (1971 bis 1974)
Lebenskrise
Fünfter Teil (1974 bis 1976)
Nirgends zu Hause
Sechster Teil (1976 bis 1978)
Karriere wider Willen
Siebenter Teil (1978 bis 1980)
August Stillmarks Tod
Achter Teil (1980 bis 1987)
Zum Schreiben berufen
Neunter Teil (1987 bis 1989)
Theatertraum II
Zehnter Teil (Herbst 1989)
Rebellion und Aufbruch
Prolog
Dieser Roman ist keine historische Abhandlung. Aber er ist auch keine reine Fiktion.
Vieles beruht auf tatsächlichen Begebenheiten. So flossen die Auftritte als Student im Jenaer Rosenkeller, das Coburg-Gastspiel des Meininger Theaters 1988 und die Herbstereignisse in Schmalkalden 1989 in die Romanhandlung ein. Auch griff ich auf Sagenhaftes, heimatgeschichtliche Dokumente und ein Stück überlieferter Familiengeschichte zurück.
Manches ist ausgedacht; und anderes ist auf der Grundlage tatsächlicher Begebenheiten „weitergedacht.“
Dichtung und Wahrheit sind ununterscheidbar verwoben. Am Ende steht etwas, was man als „authentische Fiktion“ bezeichnen könnte.
Dank
Ich danke meiner Frau für das Verständnis, das sie mir und meinem Schreiben in den zurückliegenden Jahren entgegenbrachte. Denn sie war es, die mir den Rücken frei hielt, damit ich ungestört Vormittag für Vormittag an diesem Roman schreiben konnte.
Auch habe ich meiner Mutter zu danken, dass sie bereit war, mit mir nach Schlesien zu fahren und mir mein Geburtshaus zu zeigen. Ohne diese Erfahrung wäre es nicht möglich gewesen, über meine Herkunft und die Vertreibung zu schreiben.
Erster Teil (1965 - 1967)
1. Kapitel
Nach einem missratenen Abitur, einer Lehre als Autoschlosser und einem kurzen Gastspiel auf der Großbaustelle Schwedt war Wolfgang froh, dass er Germanistik und Geschichte studieren konnte. Und für ein gutes Omen hielt er es, dass die Uni, an der er mit seinem Lehrerstudium begann, Friedrich Schiller hieß. Denn sein Lebenstraum war es, Theaterdichter zu werden.
Wolfgang Bruckner war zwanzig Jahre alt, als er im Oktober 1965 in der Kaffeestube der Uni Jena der Dinge harrte, die da kommen sollten.
Er saß mit dem Rücken zur Fensterfront, die in den quadratischen Innenhof zeigte, und hatte die Tische, die Tür und den Kaffeeausschank im Blick. Gelangweilt rührte er in seinem zuckersüßen Kaffee und sah der breithüftigen Frau hinterm Ausschank zu, wie sie an der fauchenden Kaffeemaschine herumhantierte und einem alten Mann mit Baskenmütze und dicker Brille ein Stück Quarkkuchen auf einen Glasteller schaufelte. Bei diesem Mann, einem Literaturprofessor, wird Wolfgang drei Jahre später in einer Klassik-Vorlesung sitzen und Professor Müller wird keinen Hehl daraus machen, was er vom Einmarsch der Warschauer-Pakt-Staaten in die CSSR hält. „Ich bin gegen jede Art von Gewalt“, wird er sagen, und von diesem mutigen Bekenntnis wird Wolfgang so begeistert sein, dass er sich beim Beifallbekunden fast die Knöchel wund klopft.
Die Frau hinterm Tresen war freundlich. Und sinnlich ist sie auch, dachte Wolfgang. Dann gab er das Beobachten der Leute auf, griff nach seinem Campingbeutel, dessen Reißverschluss beim Aufmachen etwas klemmte und zerrte die Zeitschrift „Theater der Zeit“ hervor.
In der jüngsten Ausgabe stand ein ausführlicher Bericht über die 7. Arbeiterfestspiele, an denen er mit dem Arbeitertheater Schwedt teilgenommen hatte.
„Der Dramatische Zirkel des Erdölverarbeitungswerks Schwedt spielte im Frankfurter Kleist-Theater ‚Menschen in Bewährung‘. Uns tritt entgegen, was uns im Leben wie in der Kunst schon manchmal begegnet ist: der Arbeitsbummler und die gute Brigade, die nicht mit ihm fertig wird, das Neuerer-Kollektiv und einige verständnislose Mitarbeiter in der Betriebsleitung, die aus formalen Gründen und mangelnder Verantwortungsfreudigkeit eine technische Entwicklung boykottieren, und das liebende, strebsame Mädchen, das den Liebsten an eine andere, weniger wertvolle Dame zu verlieren droht.
So dargestellt, wäre es leicht, sofort über jede Figur den Stab der sozialistischen Moral zu brechen.“
Neu an der Geschichte sei, konstatierte der Theaterkritiker, dass den Beweggründen der „schwarzen Schafe“ nachgegangen würde und die Fäden so miteinander verknüpft seien, dass man von keiner Gestalt behaupten könne, sie sei absolut „weiß“ oder „schwarz“.
Jeder habe seine Bewährungsprobe, mancher bestehe die eine und versage doch bei der anderen, las Wolfgang, als plötzlich jemand „Mensch, Bruckner!“ sagte.
Es war Ulli, Ulli Flick, den er seit sieben Jahren nicht gesehen hatte. Im Februar 1958 waren Bruckners von Muldenburg in Sachsen nach Erfurt gezogen, und so lange war es her, dass sie sich nicht mehr gesehen hatten.
Wolfgang war hoch erfreut über diesen Zufall und schloss das „Theater der Zeit“. „Meine Lieblingslektüre“, sagte er und Ulli hockte sich neben Wolfgang an den runden Fünfer-Tisch: „Von hier aus habe ich die Tür am besten im Blick“, sagte er. Er studiere Jura und warte hier auf drei Weiber aus dem Ernteeinsatz, die er zum Kaffeetrinken eingeladen habe, fuhr er fort. „Es ist nämlich Sitte“, sagte Ulli, „dass die Erstsemester Germanistik/Geschichte mit dem Drittsemester Jura zusammen in den Ernteeinsatz fahren.“
„Da müssten die Weiber, auf die du wartest, ja in meiner Seminargruppe sein“, sagte Wolfgang. „Ich bin nämlich auch Erstsemester Germanistik/ Geschichte.“
„Und warum warst du dann nicht mit im Ernteeinsatz?“
„Weil ich mir beim Fußballspielen an der Ostsee den linken, kleinen Zeh gebrochen hatte“, sagte Wolfgang und erzählte Ulli ausführlich, wie es dazu gekommen war: „Wir waren ziemlich blau, als wir am letzten Urlaubstag Fußball spielten, und in meinem Besoffensein zog ich meine Schuhe aus. Ich spielte barfuß, und bei einer Fußabwehr als Torwart haute mir jemand, der den Ball nicht richtig traf und seine Lederturnschuhe angelassen hatte, den kleinen, linken Zeh weg. Erst beim Aufstehen merkte ich, dass es ein offener Bruch war. Nach einer Nacht im Rostocker Krankenhaus trat ich mit einem Gipsfuß die Heimreise an.“ Deshalb konnte Wolfgang weder an der feierlichen Immatrikulation Ende August noch am Ernteeinsatz teilnehmen.
„Sechs Wochen hinkte ich in die Unfallchirurgie und ließ den Zeh Woche für Woche röntgen“, sagte Wolfgang. „Das einzig Gute an dieser beschissenen Situation war, dass ich beim Röntgen Rehberg traf, den ich von der Oberschule her kannte. Er studierte Medizin in Jena und machte gerade ein Praktikum in der Unfallchirurgie. Er erzählte mir, dass er im Herbst von Jena nach Leipzig wechseln und seine Bude in der Mühlenstraße aufgeben würde. Und da ich noch keine Unterkunft hatte, fragte ich ihn, ob ich sein Zimmer kriegen könne. Er wusste zwar nicht, ob seine Wirtin das Zimmer wieder vermieten würde. Aber irgendwie bekam er sie rum.“ „Du kannst froh sein, dass du die Bude bekommen hast“, sagte Ulli. „Sonst wärst du in der ehemaligen Nudelfabrik mit acht Mann auf einem Zimmer gelandet.“
„Ich bedauere trotzdem, dass ich nicht mit im Ernteeinsatz war“, erwiderte Wolfgang. „Wir hätten viel Zeit zum Quatschen gehabt.“
„Aber das können wir ja nachholen“, sagte Ulli. „Am besten heute Abend in der ‚Weintanne‘. Oder hast du was anderes vor?“
„Nein“, sagte Wolfgang, und Ulli beschrieb ihm den Weg.
Dann beäugte er misstrauisch die Zeitschrift „Theater der Zeit“ und meinte: „Müsstest du nicht die ‚Lehrerzeitung‘ lesen?“
„Eigentlich ja“, sagte Wolfgang. „Aber darüber können wir ja heute Abend noch reden.“
Wenig später griff Ulli in seine Jackentasche und legte einen Stoß Fotos auf den Tisch. „Schnappschüsse aus dem Ernteeinsatz oben in Mecklenburg“, sagte er, und während er Wolfgang die Fotos zeigte, erklärte er: „Das ist Edda.“ Er deutete auf ein Mädchen mit langen Haaren und einem sinnlich-breiten Mund.
„Ein Kumpel durch und durch. Kein Kind von Traurigkeit, wenn du weißt, was ich meine“, sagte Ulli.
„Und das ist Doris. Sie ist eigentlich rothaarig. Auf Schwarz-Weiß ist das nicht zu sehen. Etwas slawischen Einschlag, ungemein ehrgeizig, und sie glaubt, sie könne einen verführen, indem sie ein Klein-Mädchen-Gesicht und Kulleraugen macht.“
Das ganze Gegenteil sei Christa, die alle nur Biene nennen würden, erklärte Ulli und tippte auf eine bildschöne, schwarzhaarige junge Frau, die zwischen den Kartoffelfurchen stand und direkt in die Kamera lächelte. Selbst in dem schlabbrigen Trainingsanzug sah sie noch verdammt gut aus, fand Wolfgang, und Ulli sagte: „Es ist unheimlich schwer, an sie ranzukommen. Total kühl, sag ich dir.“
Als die drei Studentinnen, die Ulli hinreichend beschrieben hatte, wenig später in der Kaffeestube auftauchten, wusste Wolfgang schon, wie sie hießen und wer sie waren. Eigentlich brauchten sich Doris aus Gera, Biene aus Karl-Marx-Stadt und Edda aus Potsdam gar nicht mehr vorzustellen.
Als Ulli sagte, dass Wolfgang zu ihrer Seminargruppe gehöre, staunten sie nicht schlecht, und Edda sagte: „Du bist also der Gesuchte.“
„Ein gebrochener Zeh hat ihn vorm Ernteeinsatz bewahrt“, sagte Ulli und zeigte den dreien die Fotos, die er von ihnen während der Arbeit auf dem Feld und beim Saufen am 7. Oktober gemacht hatte.
„Am Tag der Republik haben wir gesoffen wie die Löcher“, sagte Ulli.
„Mehr als das!“ Edda tat mächtig geheimnisvoll.
Doris fragte, ob sie mal das „Theater der Zeit“ haben könne, und vertiefte sich sofort in den Artikel über das Treffen der Studentenbühnen in Erfurt.
Als Wolfgang ihr eröffnete, dass er im Arbeitertheater Schwedt mitgespielt habe, sagte Doris: „Wir brauchen noch Männer für die Massenszenen.“
Biene, die einen äußerst vornehmen Eindruck machte, sagte: „Wir drei sind nämlich in der Studentenbühne“, und wedelte mit dem Probenplan, den sie sich gerade geholt hatten. Und Doris versuchte Wolfgang zu ködern, indem sie dem Stück, in dem sie die weibliche Hauptrolle spielte, Wichtigkeit verlieh: „Es ist die Geschichte eines Mannes, der sein Gesicht verliert. Doch mit der Erkenntnis seiner Selbstentwürdigung vollzieht sich in ihm eine grundlegende Wandlung.“
Das Stück, von dem Doris sprach, hieß „Die Lederköpfe“, und geschrieben hatte es ein gewisser Georg Kaiser.
Obwohl Wolfgang weder das Stück noch den Autor kannte, sagte er: „Ich werde’s mir überlegen.“
„Wir hoffen auf dich“, sagte Edda.
„Und ich erwarte dich heute Abend in der ‚Weintanne‘“, sagte Ulli.
Wenig später überquerte Wolfgang den Holzmarkt und holte seinen Koffer im Westbahnhof ab.
In der Mühlenstraße angekommen, klingelte er bei seiner Wirtin und ließ sich die Wohnungsschlüssel geben. „Sie haben noch mal Glück gehabt“, sagte sie. „Nach Ihnen werde ich das Zimmer nicht mehr vermieten“, und es schien, als habe sie ein schlechtes Gewissen, dass sie ihm eine Kellerwohnung anbot, die im Winter sehr kalt und sonst immer etwas feucht war.
Von einem kellerdunklen Treppenabsatz, der ebenerdig hinaus auf den Hühnerhof führte, ging links eine schmale, niedrige Tür ab, die in eine kleine Küche führte.
Die Größe der Küche schätzte Wolfgang auf etwa vier Quadratmeter. Mit schnellem Blick überflog er das Mobiliar: ein schmales Küchenbüfett, ein kleiner, schwarzer Kanonenofen, ein Kleinsttisch mit geschwungenen Füßen und zwei zierliche Stühle aus Holz.
Neben dem angerosteten Metallausguss mit dem schmucklosen Wasserhahn darüber, der einzigen Möglichkeit zum Waschen, befand sich ein schmales Fenster, unter dem es sich die Ameisen bequem machten.
Durch einen ausgeblichenen Türrahmen, bei dem die Tür fehlte, betrat Wolfgang das Wohn- und Arbeitszimmer.
Er stellte den Koffer und den Campingbeutel in der Mitte des Zimmers ab und schmiss sich in voller Montur übermütig auf die breite Kastenmatratze. Auf dem dicken, unbezogenen roten Federbett machte er Probeliegen. Er legte die Hände unter seinen Kopf und ließ das Zimmer auf sich wirken.
Vom Kopfteil der Liege aus konnte Wolfgang sehen, wie die Nachmittagssonne durch das Geäst der Obstbäume von nebenan schien und das warme Oktoberlicht durch zwei Fenster ins Zimmer fiel. Zwischen den sonnenbeschienenen Fenstern stand eine Kommode, und an der Wand über der Kommode hing ein leeres Bücherregal.
Mit dieser Aussicht beendete er sein Probeliegen. Er spürte, dass es sich nicht besonders bequem auf der harten Bettkante saß, und stellte fest, dass der kleine, braune Kachelofen, der das ganze Zimmer heizen sollte, nur einen reichlichen Meter vom Kopfteil der Kastenmatratze entfernt war.
Er starrte auf die gegenüberliegende Stubenwand: auf den dunkelbraunen Kleiderschrank, die bläulich gestrichene Holztür, die direkt in den Hühnerhof hinaus führte, und das Fenster, von dessen Rahmen der weiße Lack in großen Flocken abblätterte. Der einzige Stuhl, den es in diesem Zimmer gab, stand vor dem abgelederten, schwarzen, schweren Schreibtisch, den man genau hälftig zwischen die Tür und das Fenster gestellt hatte.
Wolfgang hätte sich überglücklich schätzen müssen, dass er eine eigene Bude hatte. Aber was er sah, fand er ziemlich beschissen. Dennoch begann er, sich häuslich einzurichten.
Er packte den Campingbeutel aus, in dem sich die Turnschuhe, der Trainingsanzug und fünf Bücher befanden: „Der große Duden“, „Wege zum Gedicht“, ein Bildband über Renoir und die Frauen, „Die deutsche Geschichte in einem Band“ und „Literatur im Überblick“.
Als Wolfgang den Duden mit dem blauen Einband auf das Hängeregal zwischen den zwei Fenstern stellte, die in Nachbars Garten gingen, musste er daran denken, wie er sich in der neunten Klasse von einer Fünf in Rechtschreibung auf eine Drei hochgearbeitet hatte. Mit dem Buchstaben A beginnend, schrieb er den Duden ab. Beim Wort Fatalismus angekommen, hörte er mit dem Dudenabschreiben auf, weil er es inzwischen auf eine Drei gebracht hatte. Und Wolfgang konnte sich gut daran erinnern, dass die Fünf in Rechtschreibung ihn nicht davon abgehalten hatte, zu erklären, dass er später einmal Schriftsteller werden wolle, und er führte Gerhart Hauptmann an, den großen Schlesier und Nobelpreisträger, der in Rechtschreibung auch eine Fünf gehabt haben solle. Zu jener Zeit las Wolfgang nur ungern, was ihm keinen Spaß machte und seinen gegenwärtigen Intentionen nicht entsprach. Er verehrte die Expressionisten und schrieb wirre und wilde Gedichte. Er schwärmte für „Baal“ und Hermann Hesse und alles, was vital und rotweintrunken war, zog ihn magisch an.
Wolfgang griff nach dem Buch „Wege zum Gedicht“ und musste daran denken, wie die Trommern ihn zur Teilnahme an einem Lyrikwettbewerb überredet hatte.
Nachdem Wolfgangs „Der Arbeiter“ in der Betriebszeitung abgedruckt worden war, hatte es sich bis in die Berufsschule herumgesprochen, dass Wolfgang Gedichte schrieb, und die dicke Trommern war von Wolfgangs Veröffentlichung so begeistert, dass sie ihn nach dem Unterricht zu sich bestellte.
Die Trommern, die Deutsch und Staatsbürgerkunde gab und – politisch gesehen – rot bis auf die Hosen war, meinte, dass er unbedingt am Lyrikwettbewerb „Jugend und Alltag“ teilnehmen müsse, der gerade für Schüler und Lehrlinge ausgeschrieben worden sei. „Ich arbeite in der Jury mit“, sagte sie. „Und es wäre unheimlich gut, wenn unsere Schule durch dich vertreten würde.“
Wolfgang schaffte es dank der Trommern auf einen der Podestplätze im Lyrikwettbewerb, und Peter Pollatschek, ein junger Schauspieler, trug Wolfgangs Gedicht auf der Abschluss-Matinee vor.
Am Ende des musikalisch-literarischen Programms wurden die Preisträger nach vorn gebeten. Kurt Steiniger, ein Lyriker, der sich mit Kindergedichten einen Namen gemacht hatte, gratulierte Wolfgang zu seinem Erfolg und drückte ihm das Buch „Wege zum Gedicht“ in die Hand. Als die Trommern nach Veranstaltungsschluss erfuhr, dass Wolfgangs „Arbeiter“ in der Anthologie „Das Lied des Volkes wird geschrieben“ erscheinen sollte, fiel sie ihm um den Hals. Sie vergaß, dass sie seine Lehrerin war, und drückte ihn eine ganze Weile liebevoll und innig an ihren fülligen Körper.
Als Wolfgang den Bildband über Renoir auf das oberste Brett des schmalen Wandregals stellte, flatterte ihm ein kleiner Zeitungsausschnitt entgegen, der ihm als Lesezeichen gedient hatte. Es war ein kleiner Zweispalter, der mit „Themen waren gut durchdacht“ überschrieben war und Wolfgang nochmals an seinen ersten literarischen Erfolg erinnerte.
Über die Matinee anlässlich des Lyrikwettbewerbs schrieb die Journalistin, die wie Nana Mouskouri aussah und während der Veranstaltung in der ersten Reihe neben Wolfgang gesessen hatte: „Dass nicht nur Erwachsene etwas von Gedichten verstehen, bewiesen die Teilnehmer einer Veranstaltung, die unter dem Motto ‚Jugend und Alltag‘ stand. Die Schüler und Lehrlinge zeigten in ihren Gedichten oft eine gedankliche Tiefe, die vom gründlichen Durchdenken ihrer Themen herrührte. Zu den wirklich vielversprechenden Begabungen, die sich vorstellten, zählt unbestritten Wolfgang Bruckner, ein 19-jähriger Autoschlosser.“
Wolfgang entschied sich, diesen kleinen Zeitungsartikel als Merkzettel an die Tür des hohen, schweren Kleiderschranks zu heften. Auf Augenhöhe, damit er nicht vergaß, warum er in Jena Germanistik und Geschichte studierte.
Als wolle er seinem Wunsch, Theaterdichter zu werden, Nachdruck verleihen, trennte Wolfgang aus dem Buch „Literatur im Überblick“ vorsichtig das Jugendbildnis des zwanzigjährigen Schiller heraus und brachte es mit einer Reißzwecke über der Erstrezension an, in der er als vielversprechende Begabung bezeichnet worden war.
Als Wolfgang die „Deutsche Geschichte in einem Band“ neben den Duden, die „Wege zum Gedicht“, und die „Literatur im Überblick“ stellte, erinnerte er sich daran, wie widerwillig er dieses historische Machwerk gelesen hatte, als er sich auf seine Aufnahmeprüfung an der Uni in Jena vorbereitet hatte.
Vom Geschichtsunterricht bei Doktor Landgraf wusste er, dass bei Leistungskontrollen immer die richtigen Allgemeinplätze und Schlagwörter gefragt waren, und so prägte er sich die Stellen ein, mit denen er auf jeden Fall punkten konnte: „Die Bürger der Deutschen Demokratischen Republik unter Führung der Arbeiterklasse, im Bündnis mit der Bauernschaft, der Intelligenz und allen anderen Werktätigen, haben den Weg gezeigt, der den realen Entwicklungsbedingungen entspricht. Das ist der Weg der demokratischen Herrschaft des Volkes. Das ist der einzige deutsche Weg, der den Interessen des Volkes entspricht.“
Als die Bücher, die Wolfgang mitgebracht hatte, den rechten Platz auf dem Hängeregal an der Fensterwand gefunden hatten, fiel ihm zu guter Letzt eine arg kastrierte Europakarte im DIN-A-3-Format in die Hand.
Unmittelbar nach dem 13. August 1961 war Wolfgangs Frust so groß gewesen, dass er sich die Karte gegriffen und die Ostblockstaaten, in die er hätte reisen können, weggeschnitten hatte. So waren auf der arg beschnittenen Europakarte nur noch die Länder zu sehen, die Wolfgang nicht bereisen konnte: BRD, Österreich, Italien, Griechenland, Jugoslawien und Albanien.
Wie eine schematische Darstellung eines Bergprofils, das stufenweise und gezackt von rechts unten nach links oben verlief, sah die Landkarte aus, die Wolfgang mit Reißzwecken an der Tür anbrachte, die zum Hof hinausging.
Am Schreibtisch sitzend, fiel der Blick ganz genau auf diese eigenartig zurechtgeschnittene Landkarte, und sie würde Wolfgang täglich daran erinnern, dass es ihm wohl nie vergönnt sein würde, sich die Welt anzusehen.
Schneller als gedacht war er mit dem Kofferauspacken fertig, schneller als gedacht hatte er seine Lieblingsschallplatten von „The Who“, den „Beatles“, Charles Aznavour, Esther und Abi Ofarim und Krugs „Jazz und Lyrik“ aus den Handtüchern und der Bettwäsche gewickelt und auf der Kommode abgelegt, auf der ein kleines Transistorradio und der Wecker standen, und schneller als gedacht hatte er seine Unterwäsche, den Schlafanzug, das Wechselhemd und seinen geliebten Rollkragenpullover im Kleiderschrank untergebracht.
Es schien, als habe alles seinen Platz gefunden. Aber Wolfgang fühlte sich beschissen, wenn er daran dachte, dass diese Kellerwohnung für vier Jahre sein Zuhause sein sollte, und er war froh, dass er sich mit Ulli in der „Weintanne“ verabredet hatte und nicht den ersten Abend alleine in dieser trostlosen Bude verbringen musste.