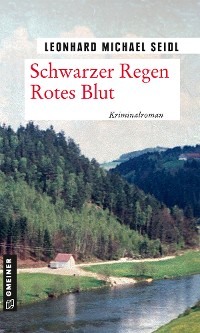Loe raamatut: «Schwarzer Regen Rotes Blut»
Leonhard Michael Seidl
Schwarzer Regen Rotes Blut
Kriminalroman

Zum Buch
Mai 1945 Im Mai 1945 kehren viele deutsche Soldaten in die Heimat zurück. Der Krieg hat den Männern jegliche Sensibilität geraubt. Vier von ihnen machen im Wirtshaus Pfanzelt im Dorf Schachtenstein im Zwiesler Winkel Halt. Sie essen, trinken viel Alkohol und werden gewalttätig. Schließlich belästigen sie die junge Wirtin und bedrängen sie. Es gibt Tote. Polizeikommissär Leo Klemm übernimmt den Fall. Kurz darauf tötet jemand die Kinder des flüchtigen Mörders Michael Dorn – aus Rache für den Tod der Wirtsfamilie? Klemm befragt die Bewohner des Dorfes und stößt dabei auf eine Mauer des Schweigens. Die amerikanische Besatzungsmacht verliert die Geduld. Sie entzieht Leo Klemm den Fall und beauftragt den beinharten Captain Malic, einen Deutschenhasser, die Mörder mit allen Mitteln dingfest zu machen.
Leonhard Michael Seidl, geboren 1949 in München, ist Autor und Musiker. Seine Werke umfassen Romane und Theaterstücke. Sie wurden mehrfach mit Preisen ausgezeichnet. Seidl lebt mit seiner Familie bei München. Mehr erfahren Sie unter: www.dreamcompany.de
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!



Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
© 2021 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
info@gmeiner-verlag.de
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Sven Lang
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Bildes von: © https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Viechtach1979_(3).jpg
ISBN 978-3-8392-6796-7
Zitat
»2016 Writer in Residence, Franz-Edelmaier-Residenz für Literatur und Menschenrechte, Meran«
Sonntag, dreizehnter Mai 1945
Generalfeldmarschall Wilhelm Keitel, der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht (OKW), wird in Flensburg von britischen Soldaten verhaftet. Generaloberst Alfred Jodl, bisher Chef des Wehrmachtsführungsstabes, wird zu seinem Nachfolger ernannt.
Am Waldrand lagerte es ruhig in der Maisonne. Ein etwas heruntergekommenes Gebäude, zweigeschossig, außen weiß getüncht, mit einem umlaufenden Balkon und grünen Läden an den kleinen, der Kälte trotzenden Fenstern. Den Hof zierte ein Brunnen, der schon lange ausgetrocknet war. Seitlich davon zwei kleine Nebengebäude für Traktor und Hänger. Beide leer.
Über der breiten Eingangstür hing eine verblichene Holztafel mit der Aufschrift »PFANZELT«. Mehr stand nicht darauf. Mehr brauchte es nicht, denn jeder wusste, dass das alte Wirtshaus mit guter Küche und süffigem Bier zum Besuch einlud.
Jedoch – von gutem Essen und süffigem Bier konnte im Augenblick nicht die Rede sein. Die Zeiten waren noch immer unruhig, das Bayernland ächzte unter den Folgen eines barbarischen Krieges, der erst vor wenigen Tagen zu Ende gegangen war.
Die einen hießen das Ende »eine Niederlage«, andere nannten es »die Befreiung«. Es war, wie es war, und das kleine Dorf Schachtenstein im Zwieseler Winkel wartete erschöpft auf die Zukunft.
Das Dorf Schachtenstein also. Unweit der Häuser bahnte sich der Schwarze Regen, ein schmaler Fluss, seinen Weg durch den Wald. Dreihundertelf Einwohner. Ein Wirtshaus. Die Kirche St. Sebastian, der Kramerladen und etliche Bauern. Dazu der Rosshändler Staubwasser. Der Rest Kleinhäusler und Landvolk. Die einen arbeiteten in den Glashütten, die anderen bestellten ein Stück Wald, hielten eine Kuh oder Geißen, vielleicht ein paar Hühner, verdingten sich ihren kargen Lohn als Holzrücker.
Im Augenblick gab es in Schachtenstein weder Vieh noch Hühner noch Rösser zum Holzrücken. Vielleicht hatte einer eine Sau versteckt oder das letzte Huhn gerade geschlachtet. Wo sonst bei den Bauern die Schweine im Kobel standen, sind diese jetzt leer gefegt, als wäre ein Sturm hindurchgetobt. So ähnlich war es ja auch: Der Krieg hatte die Stuben und Ställe ausgekehrt. Selbst Kirchenbänke und Wirtshaustische waren verwaist.
Einspurig war man geworden, einspurig im Denken und einspurig im Wollen. Das Denken richtete sich auf alles, was mit Essen zu tun hatte. Das Wollen gierte nach allem, was Frieden verhieß und Ruhe und ein gutes Auskommen mit den Nachbarn und der Welt versprach.
Das war nicht einfach. Krieg veränderte die Menschen nur für einen Lidschlag. Für ein paar Stunden, Tage, Wochen vielleicht. Dann nahm der Karren der Geschichte wieder Fahrt auf. Dann richteten die Menschen sich wieder ein in der Gegenwart. Dann ging es hinaus in die Zukunft, denn zurück in die Vergangenheit konnten und wollten sie nicht mehr.
Wer das Sterben überlebt hatte, war froh. Manch einer zitterte innerlich, aber man sah es nicht. Andere hatten mehr verloren, das erkannte man an den Krücken, den Prothesen und den zerschossenen Gesichtern.
Manchen waren keine Gliedmaßen abhandengekommen, dafür der Verstand. Viele von denen waren auf dem Felde der Ehre geblieben. Das waren die Glücklichen.
Diejenigen, die kein Glück hatten, hockten in einem Bergwerk in Sibirien oder stachen Torf am Ural. Bis sie zurückdurften, konnte es Jahre dauern.
An jenem sonntäglichen Vormittag stand die breite Eingangstür beim Pfanzelt weit offen, einladend und gemütlich. Wer hier einkehrte, sollte es gut haben, trotz der Misslichkeiten und der mageren Vorräte. Aber eine Brotzeit hatte Altwirt Maximilian Pfanzelt, ein gestandener Metzgermeister, noch immer auf den Tisch gebracht.
Offenbar wirkte das Angebot. Eine Handvoll Männer näherte sich zu Fuß dem Wirtshaus. Es waren abgerissene Gestalten, aber das musste nichts besagen. Kleidung war in diesen Tagen Glückssache. Man vernahm Lachen aus rauen Kehlen, einer warf seine Zigarette in den Hofbrunnen; dann betraten sie die Lokalität.
Im Dorf warteten die Frauen, die Kinder, die Alten auf ihre Ehemänner, Väter und Söhne. Sie hatten gelernt, Geduld zu haben. Jeden Sonntag besuchten sie die heilige Messe. Jeden Sonntag beteten sie das Vaterunser, das Ave Maria und den Rosenkranz. Jeden Sonntag vernahmen sie die Predigt von Pfarrer August Tecklenburg. Mit wohlgesetzten Worten sprach er von der Vergebung der Sünden, von der Bestrafung der Sünder und vom Tod Christi, der für uns am Kreuz gestorben war.
Das sollte es dann gewesen sein?, dachte mancher und ließ die Mundwinkel bis auf den Boden hängen vor lauter Wut und Verzweiflung.
Hätte Jesus doch bloß vorher etwas unternommen, bevor die braune Brut an die Macht gekommen war. Bevor sie die halbe Welt in einen mörderischen Krieg gezwungen hatte. Bevor sie unsere Männer verführte und dann verriet.
Jesus hätte ihr bloß die Gewehre, die Panzer und die Flugzeuge kaputt zu machen brauchen, das hätte er sicher geschafft. Schließlich hatte er bei der Hochzeit zu Kana das Wasser in Wein verwandelt. Aber er hat es nicht getan. Warum denn nicht, Herrgott noch mal?
Bei diesem heiklen Thema wusste selbst der Pfarrer keine Antwort. Stattdessen verlor er sich in Ausreden und Allgemeinplätzen. Aber am Pfarrer lag es nicht. Es lag an Jesus Christus, unserem Herrn. Der war schuld an dem Verhau.
Der Onkel könnte noch leben, und der Sohn und der Vater auch. Aber Jesus hatte nichts getan. Nichts hatte er verhindert. Es war eine Schande. Und der Pfarrer auf seiner wunderschönen Kanzel redete noch immer. Der redete sich leicht.
Inzwischen hockten die Männer beim Pfanzelt in der Gaststube am großen Bauerntisch und ließen auffahren, was Küche und Keller hergaben. Bier und Schnaps flossen reichlich. Elise Pfanzelt, die junge Schwiegertochter des Altwirtes, trug Teller um Teller herein, immer auf der Flucht vor den übergriffigen Soldaten. Denn um solche handelte es sich bei diesen Männern. Von weither waren sie offenbar gekommen. Jetzt wollten sie eine letzte Rast einlegen, bevor es zurückging zur Familie. Ein letztes Prosit auf die alte Kameradschaft und das Soldatenglück. Die Krüge hoch und saufen. Wieder und wieder eilte Bernhard Pfanzelt, Jungwirt und Elises Ehemann, in den Keller, um Nachschub zu holen.
Nach der Messe standen sie noch eine Weile beisammen, die Frauen mit den Kindern an der Hand, die jeden Tag fragten, wann der Vater aus dem Krieg kam. Sie redeten mit den alten Männern, die sich auf den Stock stützten, weil die knorrigen Hände zitterten. Die Menschen froren, obwohl die Maisonne ihre wärmende Kraft aussandte und vom Sommer kündete.
Auch der neue Bürgermeister stand bei ihnen; es war der alte und zugleich der neue, sozusagen. Rudolf Zingler könnte Bücher mit seiner Geschichte füllen. Aber er hatte es nicht mit dem Schreiben. Dafür konnte er organisieren, das hatte er immer können. Dafür haben sie ihn gewählt, wieder und wieder, obwohl er nicht der Partei angehörte und schließlich im Konzertlager verschwunden war. Keiner in Schachtenstein sprach vom Konzentrationslager, alle sprachen vom Konzertlager. Das klang eleganter.
Siebenundsiebzig war Bürgermeister Zingler jetzt. Hart war sein Gesicht geworden, in all der Zeit. Doch er trug das Kinn aufrecht, darunter den gewaltigen Kropf, der sein Markenzeichen geworden war. Die Leute redeten, dass er als junger Mann der Kommunistischen Partei beigetreten war, was keiner verstanden hatte, denn was taten die Kommunisten? Die enteigneten. Die wollten, dass alles allen gehörte, so hatte es der Herr Pfarrer gesagt und so hatte es Ortsgruppenführer Staubwasser bestätigt.
Die Amerikaner hatten Zingler aus dem Lager geholt und ihn in Schachtenstein wieder als Bürgermeister eingesetzt. Weil er die Leute kannte, ihre Sprache sprach und weil er unbelastet war. »Unbelastet« war das neue Zauberwort. Unbelastet.
Waren es früher Begriffe wie »Parteigenosse« oder »Führergeburtstag« oder »Endsieg« gewesen, so war es jetzt »unbelastet«. Das Wort strahlte eine unglaubliche Anziehungskraft auf bestimmte Menschen aus. Besonders auf solche, die nicht unbelastet waren.
Bürgermeister Zingler aber war unbelastet. Das war gut für ihn und gut für das Dorf. Die Zusammenarbeit mit den amerikanischen Behörden gestaltete sich ruhig und konstruktiv. Alle hatten ein gutes Gefühl dabei. Im Kramerladen von Hans Rahn gab es manchmal sogar echten Bohnenkaffee und hin und wieder eine Tafel Schokolade, gestiftet von den Besatzern.
Als der Kirchplatz sich leerte, erschien Emmi. Emilia Unruh, eine zierliche Person von fünfundzwanzig Jahren, ausnehmend hübsch. Im Augenblick verdingte sich die gelernte Hauswirtschafterin als Pfarrersköchin, seit sie als junge Witwe aus Berlin geflohen war und im Pfarrhaus eine Heimat gefunden hatte. Was die Leute redeten, interessierte sie nicht, und auch nicht, was sie nicht redeten und was stattdessen ihre Blicke sagten.
Dass sie was hatte mit Hochwürden Herrn Pfarrer. August Tecklenburg war katholischer Priester und damit dem Zölibat unterworfen. Dennoch dachte Emmi immer öfter daran, dass sie jeden Tag älter wurde und dass sie gerne eine Familie gründen würde. Mit einem Priester klappte das nicht. Männer waren knapp. Also hatte sie diesen Josef Schnaitz in die engere Wahl gezogen. Aber hinter dem waren auch andere Frauen her. Außerdem hatte Josef etwas an sich, was Emmi abstieß. Er schien ihr unfertig zu sein. Ein Mann von dreißig Jahren, so dachte sich Emmi, sollte eigentlich gefestigt genug sein, Weib und Kinder zu haben und sie ernähren zu können. Aber die Männer waren ein schwieriges Thema. Emmi seufzte. Jetzt wartete sie vor der Kirche auf ihren derzeitigen Brotgeber.
Noch jemand wartete. Langsam schlenderte er heran. Sein rotes Gesicht leuchtete.
»Na, Emmi, wie geht es dir?«, fragte er.
»Gut, Herr Ortsgruppenführer«, sagte sie.
»Warum so förmlich?«
»Ich bin es so gewohnt, Herr Ortsgruppenführer.«
Den »Ortsgruppenführer« betonte Emmi extra, obwohl sie wusste, dass der Titel nichts mehr wert, sondern geradezu gefährlich war. Sie mochte diesen Kerl nicht, der jahrelang das Sagen in Schachtenstein gehabt hatte. Dick und fett war er geworden mit dem Verkauf seiner Rösser an die Wehrmacht. Gefressen wie die Made im Speck hatte er mit seinen Parteigenossen in Zwiesel, in Passau. Sogar bis nach München hatten seine Beziehungen gereicht. Man munkelte, er habe den Führer persönlich getroffen. Aber Emmi glaubte das nicht. Was sie dagegen genau kannte, waren die ekelhaften Annäherungsversuche des verheirateten Mannes, der ein Nazi und Weiberheld war und den jeder im Dorf als einen solchen kannte und verachtete.
Seine Ehefrau Sofia war ebenfalls kein Ausbund an Frömmigkeit und Keuschheit, auch wenn sie in der Kirchenbank in der ersten Reihe saß und jeden Sonntag die heilige Kommunion empfing. Das eckige Weib, so redeten die Leute, beherrschte Konrad mit eisernem Willen. War etwas zu entscheiden, so entschied Sofia – nicht Konrad. Die Ehe war kinderlos. Warum das so war, wusste niemand im Dorf. Es gab zwar das Gerücht von einem Bankert, aber keiner traute sich offen darüber zu sprechen.
Konrad Staubwasser war achtundvierzig Jahre alt, schwer übergewichtig und hinter jedem Rockzipfel her. Das Alter der »Weiber«, wie er sie gerne nannte, spielte dabei keine Rolle. Emmi graute vor seinen dicken Fingern, vor seiner lauten Stimme, vor seinen Ausdünstungen.
Also machte sie einen Schritt in Richtung Sakristei, wo sich die Tür öffnete und Hochwürden heraustrat. Er grüßte Staubwasser mit einem knappen Kopfnicken und machte sich mit Emmi auf den Weg ins nahe Pfarrhaus, wo die Suppe auf dem Herd stand und der Braten im Rohr wartete.
Dass der Braten ein Geschenk vom Ortsgruppenleiter war, vergaß Emmi nicht. Aber das köstliche Gericht war ja nicht nur für sie, sondern auch und vor allem für den Gustl, wie sie ihn heimlich nannte.
Beim Pfanzelt ging es laut her. Lieder ertönten, derbe Witze machten die Runde, viel Geld lag auf dem Tisch. Der Anführer der abgerissenen Männer, ein gewisser Waller, hob ein ums andere Mal den Krug und die Stimme, um auf den Führer anzustoßen. Seine Kumpane fielen in das Gebrüll mit ein. Es war nur eine Frage der Zeit, bis ein Teller oder ein Bierglas zu Bruch ging.
Waller bestellte eine weitere Runde. Elise sollte das Geld, ein paar Münzen, entgegennehmen, während sie das Tablett mit den Getränken auf den Tisch stellte. Waller umfasste ihre Hüften, zog die junge Frau auf seinen Schoß. Elise war ganz in Weiß gekleidet; eine Farbe, die sie liebte, mit einer hochgeschlossenen Bluse unter dem Trägerkleid und flachen weißen Schuhen. Sie hatte ein blasses, nahezu durchscheinendes Wesen, rotes Haar umrahmte ihr Gesicht mit den großen schwarzen Augen, aus denen jetzt zornige Funken schlugen. Was bildete sich dieser Kerl ein?
»Tanz für uns, schönes Kind!«, rief er und griff ihr hart an die Brust.
Elise wollte sich aus seinem Griff befreien, schaffte es aber nicht. Noch nicht.
»Nein!«, sagte sie energisch und schlug Waller auf die Hand. Die anderen lachten.
»Warum denn nicht?«
»Weil ich nicht mag.«
»Sie mag nicht … sie mag nicht«, höhnte Waller und packte sie am Hintern.
»Vielleicht kann sie bloß nicht«, rief ein kräftiger Bursche mit Namen Michi.
»Vielleicht kann sie was anderes besser?«, sagte Waller und spielte an ihrer Brust. Da biss sie ihm in die Hand.
Wieder lachten die anderen. Es gefiel ihnen, wie das hübsche Mädchen mit ihrem Sturmbannführer kämpfte. Ein lustiger Zeitvertreib, bevor sie die karge Realität zu Hause bei den Familien einholte. In diesem Augenblick kam Bernhard Pfanzelt aus dem Keller. Mit einem Blick erfasste er die Situation und stürmte los.
Montag, vierzehnter Mai 1945
Die letzten deutschen Truppen in Ostpreußen (rund hundertfünfzigtausend Mann) ergeben sich der Roten Armee.
Kommissariat Zwiesel, Bayern
Außenstelle Schachtenstein
Polizeikommissär Leo Klemm
EINVERNAHME
Heute ist Montag, der 14. Mai 1945. Es ist 9.42 Uhr.
1. Vorbemerkung
Etwas abgelegen am Waldrand von Schachtenstein befand sich bis zur Brandlegung das bürgerliche Gasthaus von Anna und Maximilian Pfanzelt. Es galt, obwohl Anna Pfanzelt im vorigen Jahr plötzlich verstorben war, als solides Gasthaus mit fünf Zimmern, wo man zu vernünftigen Preisen essen und Quartier nehmen konnte.
2. Einvernahme des Zeugen Josef Schnaitz
Vor dem Unterzeichneten ist heute erschienen Josef Schnaitz, Küchenhilfe in Pfanzelts vormaligem Gasthaus. Josef Schnaitz ist Bürger des Dorfes Schachtenstein im Zwieseler Winkel und hat sich durch seine Kennkarte ausgewiesen.
Frage: »Ihr Name ist Josef Schnaitz. Geboren wann und wo?«
Antwort: »Geboren am achtzehnten April 1915 in Schachtenstein, Bayern. Meine Eltern Konrad und Emilia Schnaitz, Häusler dahier, und die sechs Geschwister sind eingegangen im Jahr 17 an Auszehrung. Bloß ich hab überlebt.«
»Wo befanden Sie sich nach dem Ableben der Familie?«
»War im Zwieseler Waisenheim. Ab sieben Jahr bin ich gewesen beim Pfanzelt. Seitdem bin ich da.«
»Schulische Bildung?«
»Wenig.«
»Was heißt wenig?«
»Drei Jahr Lesen und Schreiben. Und Religion. Ganz viel Religion. Im Heim Kartoffeln geschält. Jeden Tag. Das kann ich gut.«
»Rechnen?«
»Nicht so gut wie Kartoffeln schälen. Aber lesen kann ich.«
»Das ist in der Tat wenig. Sie tragen sehr starke Brillengläser. Ich gehe davon aus, dass Sie nicht gedient haben?«
»Jawoll. Nicht gedient, Herr Kommissär.«
»Sie sind nicht vorbestraft, haben keine Schulden und besitzen einen einwandfreien Leumund?«
»Jawoll, Herr Kommissär.«
»Soweit ist das also nun klar. Sie waren gestern, Sonntag, dreizehnten Mai 1945, in Pfanzelts Gasthaus damit beschäftigt, Gäste zu bewirten. Ist das korrekt?«
»Jawoll, Herr Kommissär.«
»Wie viel Uhr war es da?«
»Circa halb elf, glaub ich.«
»Vormittags?«
»Jawoll, Herr Kommissär.«
»Wie viele Personen befanden sich zu dieser Zeit im Gastraum?«
»Mit dem Austragswirt Max Pfanzelt, Bernhard, seinem Bub, und mir und den Soldaten waren es … ungefähr.«
»Schon gut. War Bernhards Eheweib Elise ebenfalls anwesend?«
»Jawoll, Herr Kommissär. Meine Elise hat die Getränke gebracht.«
»Herr Schnaitz, bitte schildern Sie nun aufrichtig und ohne Auslassungen, was Sie am Sonntag, den dreizehnten Mai 1945, in der Zeitspanne zwischen zehn und zwölf Uhr in Pfanzelts Gasthaus beobachtet haben.«
»Jawoll, Herr Kommissär. Richtig und ohne Auslassen. Der Max, was der Altwirt war, ist auf der Bank gehockt, am Kachelofen in der Gaststube. Draußen war ein grauslicher Sturm.«
»Stimmt. Ich erinnere mich.«
»Was der Altwirt war, der hat gesehen, wie der Bernhard und meine Elise die Gäste bedienen. Der Krieg ist ja gar. Die Soldaten wollen heim. Männer, die wo nicht einsehen, dass die Schlacht vorbei ist. Daran, Herr Kommissär, glaub ich ganz fest.«
»Sprechen Sie bitte weiter, während ich mir Notizen zu den Vorfällen mache. Was für Soldaten waren das?«
»Die waren von der SS. Haben noch die Uniform angehabt und dauernd vom Dirlewanger geredet.«
»Dirlewanger? Darauf kommen wir noch. Weiter.«
»Heim haben sie wollen. Das hab ich gehört. Sie haben unsere Wirtschaft gesehen. Lümmeln am Bauerntisch beim Bier und beim Schnaps und saufen den Fusel hinein, die groben Lackeln. Einer gefährlicher als wie der andere. Die Gewehre sind an der Wand neben der Tür gelehnt.«
»Einen Augenblick, Josef. Ich darf Sie doch Josef nennen?«
»Jawoll, Herr Kommissär.«
»Danke. Sie sagten soeben, die Gewehre lehnten an der Wand neben der Tür.«
»Jawoll, Herr Kommissär.«
»Trugen die Männer Pistolen?«
»Jawoll, Herr Kommissär. Alle, jeder.«
»Verstehe ich das richtig, Josef: Jeder dieser Männer war mit je einem Karabiner 98 sowie einer Luger Pistole 08 ausgerüstet?«
»Daran glaube ich ganz fest, Herr Kommissär.«
»Danke, Josef. Weiter.«
»Der Anführer hat ein Geld auf den Tisch geschmissen und noch eine Flasche Schnaps wollen. Der Bernhard hat das Geld eingeschoben.«
»Wo befand sich Elise Pfanzelt zu diesem Zeitpunkt?«
»Die Elise war hinten und hat zugeschaut. Die Elise ist immer weiß angezogen. Sie hat den Blasbalg von der Orgel gemacht, wo der Peterl, was unser Mesner ist, die Lieder vom Gebetbuch spielt.«
»Stimmt. Das hat mir Pfarrer Tecklenburg bestätigt.«
»›Nimm den Krug, Elise‹, hat der Bernhard gesagt. Ich glaub, die Elise hat ihn schwer mögen, obwohl er zu viel säuft. Dass der Bernhard säuft, hat auch der Altwirt gespannt, aber der hat schon lang keine Kraft nicht mehr gehabt gegen seinen eigenen Buben.«
»Erzählen Sie von Elise.«
»Meine Elise. Eine Schönheit. Nicht so eine kalkige oder graue Haut, sondern weiß wie der weiße Nebel. Rothaarig. Ich nenn sie mein Kupferdachl, Herr Kommissär. Verstehen S’ das?«
»Kupferdachl wegen ihrer roten Haare. Ich verstehe. Weiter, Josef, was geschah dann?«
»Sie ist wie so eine Rose. Sie hat sich leicht wie eine Feder bewegen können. Sie ist, war … wie soll ich sagen … mein Engel auf allen meinen Wegen. Und das Schönste ist, sie riecht gut. Nach Lavendel. Immer hat sie ein Lavendelparfüm.«
»Josef, könnte es sein, dass Sie in Elise, sagen wir mal, verliebt waren?«
»Ja. Doch. Daran glaub ich ganz fest, Herr Kommissär. Weil sie ist halt einfach … wunderbar … gewesen. Wie sind ihre Schritte so sanft in den Sandalen, und ihre Brüste sind wie Kitzlein, an ihr ist alles gut und rein. Es ist eine Sauerei, wie sie verreckt ist. Man muss den Kerl umbringen, der wo das gemacht hat.«
»Halt, Josef. Du sprichst von Brüsten wie Kitzlein. Das sind doch nicht deine eigenen Worte?«
»Hohelied, Kapitel sieben, Vers vier.«
»Die Bibel?«
»Jawoll, Herr Kommissär, daran glaube ich ganz fest. Hat mir der Herr Pfarrer in der Bibelstunde gelernt.«
Seltsam, dachte Klemm überrascht, ein Priester, der über Brüste wie Kitzlein spricht, als ob er Elises Busen gekannt hätte.
»Machen wir weiter. Was trug Elise an ihrem letzten Tag?«
»Ein einfaches weißes Kleid mit einem hohen Kragen und einem weißen leinenen Schurz.«
»Danke, Josef. Und weiter?«
»Die Elise nimmt die Flasche mit dem Schnaps und geht zu den Soldaten. Die Stimmung ist grob aufgeheizt und für eine ehrbare Frau wie die Elise gefährlich. Der Soldat, wo gezahlt hat, wartet, bis die Flasche auf dem Tisch steht. Dann hat er so eine kleine Spieluhr aus der Tasche gezogen, wo man überall kriegt. Die hat er neben den Schnaps hingestellt. Er zieht sie auf und sagt: Tanz für uns, schönes Kind!«
»Das hat er so gesagt: Tanz für uns, schönes Kind?«
»Genau so, Herr Kommissär.«
»Was hat Elise getan?«
»Meine Elise hat ganz fest den Kopf geschüttelt.«
»Was geschah dann?«
»Darauf zieht er die Elise auf seinen Schoß und packt sie an der Brust, die Sau. Aber die Elise hat sich wehren können. Es war ja nicht das erste Mal, wo einer frech geworden ist.«
»Was war mit dieser Spieluhr?«
»Das ist komisch, Herr Kommissär.«
»Was, Josef?«
»Die Spieluhr hat eine Melodie von dem Beethoven gespielt: Albumblatt für Elise. Sie müssen wissen, Herr Kommissär, der Beethoven war ein deutscher Komponist. Dem seine Musik hat der hochwürdige Herr Pfarrer nach der Bibelstunde auf dem Grammofon gespielt.«
»Ich kenne Beethoven. Was empfinden Sie als außergewöhnlich bei dieser Melodie?«
»Verstehen Sie nicht, Herr Kommissär? Die Musik heißt ›Albumblatt für Elise‹. Und dem Bernhard sein Eheweib heißt auch Elise.«
»Das ist in der Tat interessant, tut hier aber nichts zur Sache. Wie ging es nun weiter?«
»Warum tanzt du nicht für uns?, fragt der Soldat, wo sie gepackt hat. – Niemals nicht tanze ich, ruft meine Elise. Ich kenne ja nicht einmal deinen ganzen Namen, du Hackstock! – Hähä! Hackstock hat noch niemand zum alten Waller gesagt, plärrt der besoffene Soldat. – Das war schon lang fällig, sagt die Elise zornig. – Und wenn ich ihn dir sage?, wiederholt er stur. – Sag schon, sagt meine Elise daraufhin. – Ich bin der Sturmbannführer Ruppert Waller, der Anführer von diesen tapferen Männern, die heimgehen, sobald du getanzt hast.«
»Wie lautete der Name genau?«
»Waller, Ruppert, Herr Kommissär.«
»Waller trug einen Ehrendolch der SS. Der Mann ist unter den Toten.«
»Jawoll, Herr Kommissär.«
»Dirlewanger und Waller. Das passt zusammen. Erzählen Sie weiter, Josef.«
»Nein!, schreit meine Elise. Sie schaut nach dem Bernhard, aber der ist im Keller. Sie ist allein mit der besoffenen Bande.«
»Wo befand sich der Altwirt in diesem Augenblick?«
»Hat sich ganz schnell verdruckt, Herr Kommissär.«
»Und Sie, Josef, wo waren Sie?«
»Ich bin hinter der Kuchltür gestanden und war unfähig für eine Bewegung. Das müssen Sie mir glauben, Herr Kommissär.«
»Ich glaube Ihnen. Weiter.«
»Erst tanzen. Dann kannst gehen, sagt der Waller und drückt meine Elise. In dem Augenblick kommt der Bernhard aus dem Keller. Er rennt auf den Waller zu, wegen der Elise.«
»Was macht der Waller?«
»Erschieß ihn, Michi!, schreit der Waller.«
»Halt: Michi?«
»Ich kenn bloß den Vornamen, Herr Kommissär.«
»Moment, lassen Sie mich nachsehen. Hier. Hier habe ich seinen vollständigen Namen: Michael Dorn. Fünfundvierzig Jahre alt, gebürtig in Schachtenstein. Hat vier Jahre bei der Sturmbrigade Dirlewanger gekämpft. Zuletzt im Rang eines Sturmbannführers der SS. Hat eine Frau und drei Kinder. Hier ist ein Foto. Schauen Sie es sich genau an, Josef.«
»Das ist er, Herr Kommissär.«
»Weiter.«
»Der Michi hat gleich geschossen. Der Bernhard ist tot hingefallen. Der Waller hat gelacht. Noch einmal will der Waller die Elise packen. Aber er hat die Rechnung falsch gemacht. Mit einer Bewegung, wo ich ihr, ehrlich gesagt, nicht zugetraut hab, nimmt sie dem Michi die Pistole und schießt den Waller mitten in die Brust. Ich seh ihn noch vor mir, wie das Blut und das Bier aus seinem Mund kommen ist. Dann ist er tot vom Stuhl gefallen.«
»Möchten Sie vielleicht ein Glas Wasser, Josef?«
»Danke, Herr Kommissär, das wäre gut.«
»Immerhin sind Sie der einzige Zeuge dieses unglaublichen Massakers. Wenn Sie getrunken haben, sprechen Sie bitte weiter.«
»Der Waller ist tot. Aber die Elise schießt immer weiter in den Waller hinein. Die zwei anderen sind wie der Teufel davon.«
»Halt: Die überlebenden Soldaten sind … Augenblick … sind Friedrich Berner, gebürtig in Passau. Und Michael Dorn, gebürtig in Schachtenstein. Hier, die Fotos.«
»Genau. Das sind die Männer. Darf ich Ihnen was fragen, Herr Kommissär?«
»Ja.«
»Die Männer kommen vom Krieg. Wie können Sie da so schnell die Namen und privaten Sachen wissen?«
»Dirlewanger ist die Verbindung, Josef. Eine Anfrage bei der Volkskartei reichte. Waller und seine Kameraden Dorn und Berner gehörten zur SS-Sturmbrigade Dirlewanger und waren offenbar auf dem Weg in die Heimat. Und jetzt weiter im Text.«
»Die Elise schmeißt die Pistole weg. Die Gaststube ist leer. Auf einmal steht der Max in der Tür.«
»Maximilian Pfanzelt, der Altwirt?«
»Nach einer Pause, die wo mir unendlich lang vorgekommen ist, geht er zur Elise und hebt die Pistole auf.«
»Elise hat sich nicht gewehrt?«
»Nein. Ich glaub, sie hat einen tiefen Schock gehabt. Ihr Gesicht hat die Farbe von ihrem Kleid gehabt.«
»Was geschah dann?«
»In den Keller, sagt der Max. – Warum soll ich in den Keller?, fragt sie. Der Altwirt hat sie angeschaut und gesagt: Die kommen zurück, verlass dich drauf. Und dann Gnade uns Gott. Die brennen mein Wirtshaus nieder, wenn ich dich nicht hergeb. – Die Elise schaut in den Revolver. Der zeigt direkt auf ihre Brust, ich habe es gesehen. – Du willst mich hergeben?, fragt sie. – Ich muss dich hergeben, wenn mein Wirtshaus nicht brennen soll.«
»Was hat Elise darauf geantwortet?«
»Ich geh nicht in den Keller.«
»Und?«
»Sie hat mitgehen müssen. Es ist eine schlimme Zeit, Herr Kommissär.«
»Da mögen Sie wohl recht haben, Josef.«
»Im Keller hat es einen fensterlosen Raum, wo die Vorräte sind. An der Eisentür hängt ein schweres Schloss. Da kommt niemand hinein und niemand raus. Der Max hat gedacht, die Elise ist da sicher. Kommen die Soldaten, stellt er sich dumm und sagt, sie ist davon und er weiß nix. Vielleicht gehen sie dann wieder. Zwingen sie ihn aber, gibt er sie her.«
»Hat er das so gesagt?«
»Nein, Herr Kommissär. Aber ich glaub, das hat er sich gedacht.«
»Was geschah dann?«
»Ich hab nicht auf die Uhr geschaut, aber es hat keine Stunde gedauert, dann waren sie da. Der, wo den Bernhard erschossen hat, war jetzt der Wortführer. Jetzt mandelt der sich auf: Wo ist das Weibsstück, das unseren Ruppert abgeknallt hat?, schreit er. Der Altwirt steht vor der Haustür und schaut ihm zu. Der Soldat hebt die Pistole. Der Max hat aber keine Angst nicht gehabt. – Sie ist fort, sagt er. Der Soldat grinst. Dem haben die Schneidezähne gefehlt.«
»Wo waren Sie in diesem Moment, Josef?«
»Ich hab mich hinter dem Fenster verschanzt und alles gesehen.«
»Weiter, Josef.«
»Was soll das heißen, Alter?, fragt der Soldat. – Das heißt, sie ist fort, sagt der Max. Was verstehst denn da nicht? –Ich versteh, sagt der Soldat und spuckt auf den Boden, dass sie davon ist wie eine Hur. Aber das wird ihr nichts helfen. Sag mir die Richtung, und wir finden sie. – Der Max schaut ihn an und sagt: Ich weiß nix. – Da hat der Soldat, der Michi, geschossen. Der Altwirt ist umgefallen. Der war tot, Himmel Herrgott!«
»Wie ging es weiter?«
»Der Soldat hat sein Feuerzeug herausgetan. Er rennt in die Küche, packt einen Kübel mit Fett und schmeißt das Feuerzeug hinein. Ich hab es gerochen. Dann ist er raus. Gleich danach hat alles brennt.«