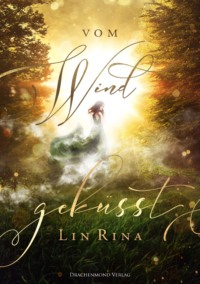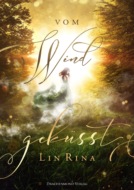Loe raamatut: «Vom Wind geküsst»
Vom Wind geküsst
Windkind-Dilogie - Band 1
Lin Rina
Copyright © 2020 by

Drachenmond Verlag GmbH
Auf der Weide 6
50354 Hürth
http: www.drachenmond.de
E-Mail: info@drachenmond.de
Lektorat: Tanja Selder
Korrektorat: Michaela Retezki
Layout: Michelle N. Weber
Umschlagdesign: Alexander Kopainski
Bildmaterial: Shutterstock
Karte & Stammbaum: Lin Rina
ISBN 978-3-95991-368-3
Alle Rechte vorbehalten
Für meine Schwester Rebecca.
Weil ich dich für immer liebe.
Und für Jazz.
Weil du die ganze Zeit dabei warst und dieses Buch bei jedem Schritt begleitet hast. Und das seit acht Jahren.
Inhalt
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Playlist
Nachwort & Danksagung


Prolog

Ich saß auf der Treppe vor meinem Wohnwagen und starrte in den langsam heller werdenden Himmel. Er war klar und wolkenlos.
Ein paar Vögel segelten im stetigen Wind, der sanft über mich wehte. Ich sah ihnen zu, wie sie sich von ihm treiben ließen, absanken und wieder aufstiegen, sich gegenseitig jagten und mich mit einem Gefühl der Sehnsucht am Boden zurückließen.
Der Wind kreiste um mich, fuhr mir in die Haare und streichelte mir die Wange. Ein leichtes Lächeln stahl sich auf meine Lippen, weil er mich aufzumuntern versuchte. Er schlich weiter um mich herum, zog spielerisch an meinen Kleidern und flüsterte mir Dinge ins Ohr. Erzählte von der Weite des Himmels, vom endlosen Blau des Meeres und von der Freiheit. Die Freiheit, die ich nur haben könnte, wenn ich mit ihm käme. Wie so oft lockte er mich und ich seufzte.
So lange hatte ich das Meer nicht gesehen. Und es würden noch sicher zwei Monate vergehen, bevor ich wieder dort sein konnte. Ich vermisste es, in die Endlosigkeit zu starren und mir vorzustellen, sie mit dem Wind zu erkunden. Mich einfach vom Boden aufheben zu lassen und wegzutreiben, hinaus über die weißen Schaumkämme der Wellen, zu den kleinen Inseln vor der Küste. Von oben die Schatten der großen und kleinen Meereslebewesen beobachten, mit den Vögeln spielen, versuchen, den Sonnenuntergang zu erreichen.
»Cate!«, drang eine bekannte Stimme an mein Ohr und ich schrak aus meinen Gedanken auf.
Augenblicklich krachte ich schmerzhaft auf die Holztreppe unter mir und schnappte bestürzt nach Luft.
Der Wind löste sich von mir, pfiff Justus heftig um den Kopf und kehrte empört zu den Vögeln zurück.
Ich hob den Blick, blinzelte irritiert zu dem großen Mann hoch. Es war mir gar nicht aufgefallen, dass er herangetreten war.
Stumm stand er da, die eine Hand fest um seinen Bogen geschlossen. In der anderen hielt er etwa ein halbes Dutzend Rebhühner, die er mit einem Stück Zwirn an den Füßen zusammengebunden hatte.
Aus dunklen Augen sah er vorwurfsvoll auf mich herab.
Er musste nichts sagen, ich wusste auch so, wie seine Worte ausfallen würden. Ich hatte sie bereits hundertmal gehört. Um ihm nicht in die Augen sehen zu müssen, wandte ich den Blick ab. Meine Wangen glühten.
Du passt nicht auf, Cate! Du bringst uns alle in Gefahr mit deinem Leichtsinn. Was, wenn jemand gesehen hätte, wie du fliegst!
Ich versuchte mühsam, den Kloß runterzuschlucken, der mir im Hals steckte. Wieso konnte ich mich nicht einmal zusammenreißen? Warum fiel mir das so schwer?
Es war früh am Morgen und daher mehr als unwahrscheinlich, dass mich ein Fremder gesehen hatte. Doch mit dieser Argumentation würde ich bei Justus nicht weit kommen.
»Es tut mir leid«, murmelte ich nur und sah wieder zu ihm auf. Hinter ihm am Himmel segelten noch immer die Vögel in ihren ruhigen Bahnen. Wie elegant sie waren … und wie frei.
Er folgte meinem Blick und als er sich erneut zu mir umdrehte, war kein Vorwurf mehr in seinem Gesicht zu sehen. Stattdessen kam er zu mir und ich machte ihm Platz, damit er sich zu mir auf die Stufe setzen konnte.
Das Holz knarrte heftig, als er sein Gewicht darauf absetzte. Freundschaftlich legte er mir den Arm um die Schultern und drückte mich sanft. »Mir auch«, sagte er und ich lehnte meinen Kopf bei ihm an. Beschützend zog er mich noch ein Stück näher an sich. Sein Körper war warm, viel wärmer, als ein Körper sein durfte, und mir wurde augenblicklich flau im Magen.
In letzter Zeit passierte das häufiger und es lag immer an Justus, dass mir so komisch wurde.
Früher war das nicht passiert, da war ich mir ganz sicher. Wir waren seit Jahren die besten Freunde, ja fast wie Geschwister, und so etwas Derartiges hatte ich da noch nicht gefühlt.
Ich wusste auch gar nicht genau, wann das angefangen hatte. Egal wie lange ich darüber nachdachte, ich konnte mich nicht erinnern, wann es zum ersten Mal passiert war.
Nur eins war klar: Dieses Gefühl war jetzt da und ging nicht mehr weg.
Ich war … nein. Nein. Wahrscheinlich war ich nur krank. Ganz sicher. Das sollte ich mal von Fin untersuchen lassen.
Wir saßen eine Weile da und sahen zu, wie die Sonne langsam über den Baumwipfeln aufging und die Schatten der Nacht sich in den Wald zurückzogen. Keiner sagte etwas. Wir blieben einfach nur hier und genossen die Stille.
Das hatten wir gemeinsam. Eine Eigenschaft, die in Justus’ Familie eher eine Seltenheit war. Doch wir beide konnten stundenlang zusammensitzen, ohne diese Stille stören zu müssen.
Das wäre den anderen nie passiert. Sie waren allesamt laute, temperamentvolle Menschen, die gern lachten, überall mitredeten und sich leidenschaftlich stritten. Aber sie waren auch gutmütig und warmherzig, und sie liebten einander so, wie es nur wenige Familien taten.
Als der erste Sonnenstrahl die Treppe berührte, schwang beim Wagen neben uns die Tür auf und zerriss damit unsere wohlbehütete Stille, als sie außen gegen die blau bemalte Holzwand krachte.
Marc stand im Türrahmen, war nur mit einer Leinenhose bekleidet, die ihm schief auf der Hüfte saß, und gähnte ebenso herzhaft wie unüberhörbar. Er streckte seine muskulösen Arme über den Kopf, sodass ich seine bläuliche Feuerclantätowierung deutlich erkennen konnte, und kratzte sich dann an Nacken und Bauch.
Justus ließ mich sofort los, zog ruckartig den Arm zurück und brachte so unauffällig wie möglich Platz zwischen uns.
Ich spürte einen Stich, der mich unerwartet im Herz traf. Trotzdem bemühte ich mich um ein einfaches Lächeln, tat, als wäre es ohne Bedeutung, dass er so plötzlich Abstand genommen hatte. Warum tat es mir so weh? Es war doch nichts Ungewöhnliches.
Justus zuckte nur mit den Schultern und erhob sich von den Stufen, die wieder herzerweichend knarrten.
»Guten Morgen, ihr Bagage!«, rief Marc uns zu, der uns gleich entdeckte, und grinste schief.
Und damit war es vorbei mit der Ruhe. Innerhalb der nächsten Minuten kam Leben in die Wagenkolonne. Die bunten Farben, in denen die Wagen bemalt waren, strahlten im Morgenlicht noch deutlicher, sodass man jede Unebenheit und jedes bereits abgeblätterte Muster erkennen konnte.
Justus nickte mir noch mal zu, hob die erlegten Rebhühner auf und ging damit zum lilafarbenen Wagen. Dort öffnete gerade Tanja, seine Mutter, die Fensterläden und kam anschließend heraus, um ihm die Hühner zum Rupfen abzunehmen. Hoffentlich würde sie daraus ihre Rosmarinsuppe zubereiten. Die liebte ich sehr.
Marc, der inzwischen ein Hemd und eine anständige Hose trug, scheuchte Dante lautstark vor sich her, damit sie anfangen konnten, die Stände aufzubauen. Van und Tai hatten schon den ersten aufgestellt und stritten sich über irgendetwas. Hanna, Mei und Ayo trugen die Waren fröhlich schwatzend zusammen, um sie fein säuberlich ausbreiten zu können. Garan und Elia kämpften mit Stöcken gegeneinander. Bree kämmte der strampelnden Sally die Haare. Tanja rief zum Essen.
Ich beobachtete sie alle. Jeder hatte seine Aufgabe und jeder Morgen lief auf dieselbe Art und Weise ab. Sie schwatzten, lachten und stritten. Siebenundzwanzig Menschen, die mit mir zusammen in den Wagen lebten. Sie waren eine große Familie.
Bis auf mich.
Ich war nicht wie sie und konnte es auch nie werden. Ich wusste das, und ich wusste auch, dass sie es wussten.
Nicht dass sie nicht versuchten, mich ständig und überall miteinzubeziehen. Die Wagenleute bemühten sich wirklich. Doch egal wie sehr, ich war nun mal keine von ihnen.
Langsam stand ich von den Stufen meines Wagens auf, verscheuchte die trüben Gedanken und ging zu den anderen, um mir etwas zu essen zu holen.
Es gab Haferbrei mit Honig, Obst und das Gebäck vom gestrigen Abend.
Justus saß bei Marc und Dante im Gras, lachte über etwas, das Marc gesagt hatte, und boxte ihm mit dem Ellenbogen in die Seite.
Sein Lachen war ansteckend und ich musste unwillkürlich lächeln.
Er sah gut aus. Sowohl wenn er lachte als auch wenn er nachdenklich war. Selbst rasend vor Wut, was durchaus vorkam, fand ich ihn noch immer faszinierend. Zumindest solange er nicht auf mich wütend war.
Er war ein großer Mann, selbst in einer Familie, in der alle ziemlich groß waren. Mit dunklem Haar, das in der Sonne glänzte und ein wenig zu lang war, sodass ihm einige Strähnen in die Stirn fielen. Sein Gesicht war schmal und kantig, das Kinn immer von groben Bartstoppeln bedeckt, was ihm etwas Verwegenes und Geheimnisvolles gab. Etwas, das einen unweigerlich anzog.
Vor allem die Mädchen aus den Dörfern.
Justus hob den Kopf, als er bemerkte, dass ich ihn ansah, lächelte er und winkte mich heran. Mein Herz schlug schneller und mir wurde augenblicklich wieder flau im Magen. Warum war ich in letzter Zeit so leicht aus der Ruhe zu bringen?
Ich setzte mich zwischen ihn und Dante ins Gras. Dante nickte mir nur mit vollem Mund zu und wandte sich dann wieder an die anderen.
Marc redete und aß gleichzeitig. Er sah Justus kaum ähnlich, obwohl sie Brüder waren. Sie hatten nur das gleiche dunkle Haar, doch die Gesichtszüge waren völlig unterschiedlich. Marc hatte einen breiten Kiefer, einen vorwitzigen Zug um den Mund und eine laute Stimme, die er möglichst oft benutzte.
Er hatte wohl gerade irgendeinen anzüglichen Witz erzählt, denn in Dantes Ohren pulsierte das Blut und er verschluckte sich vor Lachen so sehr, dass ich ihm auf den Rücken klopfen musste.
Ich mochte die Jungs. Sie waren einfacher als die Mädchen. Sie sagten wenigstens, was sie meinten.
Natürlich war ich auch mit den Mädchen befreundet. Am besten verstand ich mich wohl mit Justus’ jüngster Schwester Mei. Hanna war herzlich, aber wir konnten meist nicht so viel miteinander anfangen. Ayo war sehr nett, jedoch auch schnell eingeschnappt. Und von Bree wollte ich erst gar nicht anfangen. Allem Anschein nach hasste sie mich.
Wir hatten gestern unweit eines Dorfes auf einer Lichtung im Wald haltgemacht. Ab dem späten Vormittag kamen die Bürger herbei, um sich unsere Ware anzusehen, nach unserer Reiseroute zu fragen, um uns Briefe und dergleichen mitzugeben und sich nach dem Feuerspektakel heute Abend zu erkundigen.
Ich saß an einem der Stände und sah einem untersetzten Mann mit einem raffinierten Schnurrbart zu, wie er einige Perlenbroschen beäugte, die Hanna mit ihren geschickten Händen und endloser Geduld fertigte. Lachend redete er mit Ayo, die gerade dort verkaufte, und sie kicherte über seine Witze.
Er trug farbenfrohe Kleider aus teurem Tuch und eine weiße Schärpe spannte sich über den Wohlstandsbauch.
Der Wind war nah bei mir und spielte sanft mit einigen losen Haarsträhnen, die er aus meinem Zopf gezupft hatte. Leise wisperte er mir zu und erzählte von einem fliederfarbenen Haus in der Mitte des nahen Dorfes; groß, mit einem Stall voller Pferde.
Der Mann entschied sich für eine hellblaue Brosche und hielt sie zufrieden ins Licht. »Die ist für meine Frau«, teilte er uns begeistert mit.
Ich lächelte, weil ich nicht anders konnte.
Er betrügt sie, flüsterte der Wind neben mir. Er schläft mit dem Dienstmädchen und verprasst sein Geld mit Kartenspielen und leichten Mädchen.
Schockiert schüttelte ich den Kopf und scheuchte ihn mit einer unauffälligen Geste fort.
Auch wenn ich solche Dinge über die Menschen nicht wissen wollte, flüsterte der Wind sie mir trotzdem viel zu oft zu. Sobald ich jemandem zu lange meine Aufmerksamkeit schenkte, tat er es, weil er es konnte. Er wusste alles, war in jedem Land, in jeder Stadt und jedem Dorf, auf jedem Feld und in jedem Wald. Er war in jedem Zimmer mit offenem Fenster und erhaschte jeden Moment im Haus, wenn er durch den Kamin blies.
Und er gab sein Wissen an mich weiter.
Ich hatte schon vor Jahren aufgehört, es wissen zu wollen. Schnell hatte ich erkannt, dass die Menschen allesamt verdorben waren. Da machte ich mir keine Illusionen.
Aber manchmal wollte ich einfach glauben, dass ein Mann seiner Frau eine Brosche kaufte, weil es ihm Freude bereitete. Und nicht aus einem schlechten Gewissen heraus, weil er ein Spieler war und sie mit anderen Frauen betrog.
Als Ayo dem teuer gekleideten Herrn das kleine Broschentäschchen aus gefärbtem Leinen reichte und sich lächelnd bedankte, musste ich meinen Blick abwenden. Plötzlich fand ich das Lachen des Mannes gar nicht mehr so ansteckend und sympathisch.
Unauffällig stand ich auf und ging. Niemand hielt mich auf. Ich hatte sowieso keine Arbeit zu erledigen. Manchmal half ich beim Verkaufen. Doch ich war nicht gut darin, mit Fremden zu sprechen.
Jeder hatte seinen Platz. Auch ich. Allerdings anders als die anderen.
Ich gehörte nicht zu ihrer Familie, ihrem Volk. Ich war kein Kind des Feuers.
Ich war eine vom Windvolk. Das Mädchen, das der Wind geküsst hatte.
1

Es war mir, als würde sich das Licht der Sonne verändern, je weiter wir nach Süden zogen. Es war strahlender, heller und es schmeckte nach Wärme und Heimat.
Erst gestern hatten wir mit den Wagen den Nordfluss an der Südlichen Übergehung überquert und das Fürstentum Albahr hinter uns gelassen.
Nun lag Mari vor uns und ich fieberte dem Moment entgegen, in dem wir das Meer erreichen würden. Nirgendwo war die Luft schöner als in der Nähe des endlosen Wassers.
»Kommst du mit in die Stadt, Catie?«, rief Marc quer über die Lichtung, an der wir das Lager für den nächsten Tag aufgeschlagen hatten.
Angu und Tai bauten gerade die Stände auf und Hanna trug einen Korb mit Kleinigkeiten herbei.
»Ja, Cate, komm mit«, ereiferte sich Mei mit fröhlicher Stimme, legte ihrem Bruder lässig den Arm um die Schultern und zwickte ihn in die Seite.
Marc wich vor ihr zurück, sie setzte nach. »Schnell, Catie, bevor sie mich zu Tode kitzelt!«, keuchte er, und auch wenn es sich dabei wohl um einen Scherz handeln sollte, klang Marc doch ein klein wenig zu panisch.
»Vom Kitzeln stirbt man nicht«, behauptete seine Schwester und zwickte ihn wieder.
Ich gab nach. Das sah viel zu lustig aus, um nicht dabei zu sein, und hier war ich sowieso nicht hilfreich. Also legte ich das Kleid beiseite, an dem ich gerade den Saum hochnähte, und erhob mich.
Mei brach in Jubel aus und erwürgte dabei beinahe ihren Bruder, der sich von ihr zu befreien versuchte.
»Was brauchen wir denn?«, fragte ich und musste ebenfalls lachen, weil die beiden zu komisch aussahen.
Der Wind hatte beschlossen mit ihnen zu spielen und brachte Meis Haare zum Tanzen, in denen sich die blauen eingeflochtenen Bänder ihres Feuerclans langsam auflösten, weil sie sich weigerte, sie zu erneuern.
»Wir geben Briefe ab«, sagte Justus, der hinter mir auftauchte, und ein warmer Schauder lief mir über den Rücken.
Mein Herz machte einen kleinen Sprung, und ich war doppelt froh, mich entschlossen zu haben mitzukommen.
Ich ging wirklich selten mit in die Stadt oder auch nur in die Dörfer, an denen wir vorbeikamen.
Zum einen war es mir unangenehm, zu viele fremde Menschen um mich zu haben, da der Wind einfach zu viel über sie wusste.
Bei der Familie, die mich umgab, hatte ich ihn davon überzeugt, mir die Dinge nicht mitzuteilen. Keine Ahnung, wie ich das geschafft hatte, denn er plauderte zu gern auch über die Menschen, die mir nahestanden. Aber deren Geheimnisse wollte ich nun wirklich nicht wissen.
Zum anderen war es gefährlich. So viele Menschen auf einem Fleck machten mir Angst, auch wenn ich das ungern zugab. Ich war ein Mädchen vom Windvolk. Die Menschen hatten uns gehasst, weil sie auf unsere Kräfte neidisch gewesen waren, genauso wie sie sie gefürchtet hatten. Dabei waren wir keine Bedrohung. Ich konnte nicht verstehen, wieso man eine Gefahr in jemandem wie mir sah.
Erpicht war ich also nicht darauf, dass jemand erfuhr, wer ich war.
Das Feuervolk hielt es da anders. Es hatte sich von Anbeginn der Zeiten vor den Menschen verborgen und seine Fähigkeiten geheim gehalten.
Wenn schon das friedfertige Windvolk so gefürchtet wurde, wie würde man erst auf ein Volk reagieren, das das Feuer leiten konnte.
Es hatte eine eigene Stadt inmitten des Egralin-Gebirges, die über dicke Mauern verfügte und in die niemand hineinkam, der nicht zu ihm gehörte.
Ich war bisher die einzige Ausnahme seit Errichtung der Stadt. Man gewährte mir Asyl, aus dem einfachen und traurigen Grund, dass es das Windvolk nicht mehr gab und ich die Einzige war, die den Genozid vor zwölf Jahren überlebt hatte. Ich allein. Ich war die Letzte meines Volkes.
Doch würde es mir wirklich helfen, mich immer zu verstecken und mich meinen Ängsten nicht zu stellen?
»Bringt mir ein kleines Fass Butter mit!«, rief Tanja uns hinterher.
»Ja, Mama«, antworteten Justus, Marc und Mei beinahe gleichzeitig.
»Und fragt nach Koriander.« Sie kam auf uns zu und drückte mir einen kleinen gelben Seidenbeutel mit Münzen in die Hand. »Und Cate. Achte ja darauf, dass sich die drei gut benehmen. Man kann nie wissen, was sie anstellen, wenn du nicht ein Auge auf sie hast.« Um ihre warmen dunkelbraunen Augen bildeten sich Lachfältchen, als sie mir zuzwinkerte.
Justus’ Iris hatten genau die gleiche Farbe.
»Als ob wir so schlimm wären«, beschwerte sich Marc mürrisch und verpasste Mei einen letzten rächenden Knuff in die Seite.
»Gerade du solltest lieber den Mund halten. Wegen dir haben wir immer den meisten Ärger«, erwiderte Tanja mit ernster Miene und stieß ihm mit dem Zeigefinger gegen die breite Brust. »Wehe, du lachst dir wieder ein Mädchen an, das so dumm ist und sich von deinem Charme einwickeln lässt.«
»Mama«, empörte er sich und zog eine Fleppe. »Du tust grad so, als wäre ich ein Lüstling.«
Energisch stemmte Tanja die Hände in die Hüften und hob herausfordernd die Augenbrauen. »Was du nicht sagst.«
»Müssen wir nicht los?«, warf ich ein, bevor die Scherze zwischen den beiden zu ernst wurden und sie sich wieder heftig in die Haare kriegen konnten.
»Dann los«, bestätigte Justus, der sich bei den Streitereien zwischen Marc und seiner Mutter meistens raushielt, sich dafür aber immer darüber amüsierte. Auch Mei grinste etwas zu gemein und Marc zog ihr dafür an einem ihrer unzähligen langen Zöpfen. Sie streckte ihm die Zunge raus.
Der Weg zu Stadtmauer war nicht weit. Wir gingen durch eine kleine Tannenschonung zu einer gepflasterten Straße, die an einem kleinen Brunnen vorbei und dann direkt in den Ort führte.
Es war uns wichtig, nicht in Sichtweite der Siedlungen haltzumachen. Man konnte nie wissen, was bei uns spontan in Flammen aufging und dann hatte man lieber keine unerwünschten Zuschauer.
Nur ein paar wenige Menschen waren bereits auf dem Weg zu uns, um die Stände anzuschauen, die die anderen aufgebaut hatten.
Wir näherten uns der Mauer, begegneten mehr Leuten und der Lärm der Stadt war bereits zu hören.
Es war keine große Stadt, doch größer als die Dörfer, an denen wir in der letzten Zeit vorbeigekommen waren. Es gab bunte Tore und viele Straßen. Als wir auf den Marktplatz zukamen, wuselte es nur so von geschäftigen Menschen. Vor mehreren Ständen mit Obst und Gemüse drängten sich die Leute. Frauen tratschten am Brunnen und füllten ihre Krüge und Eimer. Kinder eilten mit ihren Schreibtafeln und Büchern zur Schule. Männer saßen vor ihren Geschäften oder gingen in der Morgensonne ihren Handwerken nach.
Justus und Marc waren die Ruhe selbst und bahnten sich zielstrebig ihren Weg durch die Menge. Ganz dicht blieb ich bei ihnen und versuchte mich zusammenzureißen und dem Unwohlsein keinen Raum zu geben, auch wenn es sich anfühlte, als könnte ich nicht atmen.
Überall waren Menschen. Sie gingen dicht an mir vorbei, rempelten mich an, traten mir auf die Füße.
Ich achtete darauf, keinen lang genug anzusehen, damit der Wind mich nicht mit Wissen überschüttete.
Doch sie alle sahen mich an! Oder bildete ich mir das nur ein? Ich konnte ihre Blicke spüren, auf meinem Rücken, meinen Händen, meinem Gesicht. Ich konnte sehen, wie sie meine helle Haut und meine im Wind tanzenden Haare betrachteten.
Nein! Ich schüttelte den Kopf, drängte die Gefühle zurück, die nicht echt waren und bloß meiner eigenen Panik entsprangen. Man konnte mir nicht ansehen, dass ich ein Windkind war. Oder doch?
Was, wenn sie zu genau hinsahen? Wenn sie den Windhauch, der mich immer begleitete, richtig deuteten? Wenn sie wussten, wer ich wirklich war?
Meine Heimat war nicht weit weg von hier. Es war eine Reise von höchstens vier Tagen in Richtung Süden, zum Meer. Dort war das Stück Küstenland, das einmal dem Windvolk gehört hatte.
Die Menschen hier in den Dörfern waren Teil der Aufstände gewesen. Hatten uns gefürchtet, uns gehasst und alle auf einmal in einem Akt sinnloser Gewalt abgeschlachtet.
Ich bekam keine Luft mehr, als sich die Menge um mich herum enger schloss, mich erdrückte. Panik schlug wild um sich, flutete meinen Kopf.
Wieso war ich nicht einfach im Lager geblieben? Wieso hatte ich mich meinen Ängsten stellen wollen?
Eine Hand legte sich auf meine Schulter und schickte Todesangst durch meinen Körper, wie ein harter Schlag gegen die Brust. Mir setzte das Herz aus, meiner Kehle entfuhr ein halb erstickter Schrei. Die Beine versagten mir den Dienst und der Schweiß brach mir aus.
Justus schlang mir in diesem Moment die Arme um die Mitte und hielt mich aufrecht. »Cate«, stieß er hervor und mein Schreck spiegelte sich in seinen Augen.
Bei allen Winden!
Zittrig holte ich Luft und klammerte mich an ihn. Denn es war kein Meuchelmörder, der mich angreifen wollte. Es war nur Justus.
Er zog mich an sich, so nah, dass ich die Hitze seines Oberkörpers durch den Stoff seines grob gewebten Leinenhemdes spüren konnte. Mein Herzschlag stolperte und mir wurde noch schwindliger.
Es war, als ob jemand die Welt hinter einem Vorhang verborgen hätte, trüb und unscharf verschwand sie und alles um uns herum wurde bedeutungslos.
Nur Justus existierte. Seine Hände an meiner Taille, die mich zurück auf die Füße hoben. Seine Wange war so nahe, dass sie meine leicht streifte. Eine dunkle Haarsträhne kitzelte mich am Ohr.
»Was ist passiert?«, fragte er bestürzt und der Augenblick fiel in sich zusammen. Ich blinzelte.
Justus steuerte uns auf eine Seitengasse zu, raus aus der Menge, und das Gewicht, das auf meinem Brustkorb lastete, hob sich.
Doch kaum hatte er mich losgelassen, knickten mir die Knie ein und ich landete auf dem staubigen Boden. Justus beugte sich sofort zu mir herunter, musterte sichtlich besorgt mein Gesicht.
Auch Marc und Mei tauchten von der Seite auf und wirkten nicht weniger betroffen.
Ich musste noch einmal blinzeln, um ganz zu mir zu kommen und die beißende Panik aus meine Lunge wegzuatmen.
Der Wind drehte sorgenvolle Runden um meinen Kopf.
»Äm, ja … ich denke, ich …«, stammelte ich und versuchte mich zu konzentrieren. »Es waren nur die vielen Leute. Ich wäre doch besser nicht mitgekommen«, flüsterte ich und meine Stimme klang immer noch zitterig. Mühsam probierte ich mich an einem Lächeln, das in einer schüchternen Grimasse endete.
Der Wind versteckte sich in meinen Haaren und zerzauste sie noch mehr.
Justus seufzte lautlos, eindeutig erleichtert, doch sein Lächeln sah genauso gequält aus wie meins.
»Sag vorher was, damit du uns nicht so einen Schreck einjagst, verdammt, wenn du einfach so umkippst«, warf Marc mir leise vor und es überraschte mich, dass er so sanft fluchen konnte.
Moment, was hatte er gesagt?
»Ich bin umgekippt?«, fragte ich verblüfft. Wann war das denn gewesen?
Auf dem Platz. Ich bin auch erschrocken, flüsterte der Wind und pustete mir eine Haarsträhne aus der Stirn.
»Justus hatte dich ja sofort«, versuchte Mei mich zu beruhigen, drehte aber nervös ihre Zöpfe auf dem Finger auf.
Sah ich so furchtbar aus, dass alle sich solche Sorgen um mich machen mussten?
Ich blickte zu Justus, der mich noch immer beunruhigt ansah.
Ich bin in Ordnung, sagte ich ihm mit den Augen und er nickte. »Lasst uns zuerst zum Haus des Stadtrates gehen«, entschied er mit fester Stimme. »Da müssen wir nicht wieder über die Hauptstraße.« Die Gelassenheit ihres älteren Bruders wirkte auf Marc und Mei offenbar gleichermaßen beruhigend.
Der Wind tanzte um meine Fingerspitzen, als jagte er sich selbst.
Ich ergriff die Hand, die Justus mir reichte, und genau in dem Moment, als ich seine Haut berührte, durchzuckte es mich, als würde ein Blitz in mein Herz einschlagen. Der Wind zerstob erschrocken in alle Richtungen. Justus half mir auf die Füße und ließ mich wieder los. Doch mein Herz wummerte weiter, entschlossen, aus meiner Brust auszubrechen.
Es war mir unbegreiflich, wie er es nicht bemerken konnte.
»Lasst uns die Straße da vorn nehmen. Ich denke, ich weiß, wo wir langmüssen«, sagte er jedoch ungerührt zu Marc und zeigte in irgendeine Richtung. Die beiden setzten sich in Bewegung und Mei hakte sich bei mir unter, um mich mitzuziehen.
Ihr Blick ruhte auf mir, als befürchtete sie, dass ich noch einmal umkippen könnte. »Cate?«
Ich sah zu ihr auf. Obwohl sie ein Jahr jünger war als ich, überragte sie mich schon fast um einen Kopf. Aber in ihrer Familie waren ja schließlich alle groß.
»Ja?« Ich legte einen festen Schritt vor, um ihre Sorgen zu zerstreuen, und versuchte mich auf anderes zu konzentrieren. Das Pflaster hier in den Gassen war uneben und rau. Überall spross Moos aus den Ritzen hervor.
»Geht es dir wirklich gut?«, wollte Mei wissen. Misstrauen schwang in ihrer Stimme mit, jedoch sehr viel weniger Sorge, als ich geglaubt hatte.
»Ich denke schon, warum?« Ich ließ den Blick schweifen und sah zu der Wäsche, die viele Meter über uns von einem Haus zum anderen gespannt in der Sonne trocknete. Zu den luftigen, hell bemalten Fensterläden oder den beiden Frauen, die uns schwatzend entgegenkamen. Bloß um nicht zu Justus zu sehen, der vor uns herging.
»Dein Gesicht ist feuerrot«, behauptete Mei und musterte mich argwöhnisch. »Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich behaupten, du bist ein glühendes Feuermädchen.«
Innerlich seufzte ich. Sie hatte recht. Zudem schwitzte ich, obwohl meine Hände eiskalt waren, und mein Herz raste immer noch, als wäre es vor mir auf der Flucht.
Der Wind war zurückgekommen und versuchte mir das Gesicht zu kühlen. Es half nichts.
Mei hatte sicher eine Erwiderung von mir erwartet, aber ich schwieg, wagte es nicht, den Mund aufzumachen, als sich mir langsam der Grund für all das aufdrängte.
Ich wusste es ja bereits, aber es mir einzugestehen war viel schwerer als gedacht. Justus war immer wie ein Bruder gewesen und die Tatsache, dass er etwas anderes für mich sein könnte, machte mir Angst.
Mein Blick wanderte nun doch zu Justus, der uns durch die engen Seitenstraßen des Dorfes um den Marktplatz herumführte.
Er sah im gleichen Moment zu mir, als wüsste er doch, dass ich an ihn dachte, und lächelte so, wie er es immer tat. Ruhig und frei von versteckten Absichten.
Es raubte mir den Verstand und zauberte auch mir ein Lächeln auf die Lippen, das ich nicht kontrollieren konnte.
Bei allen Winden, ich war nicht krank! Nein, ich war bestimmt verrückt. Und Justus war schuld daran.