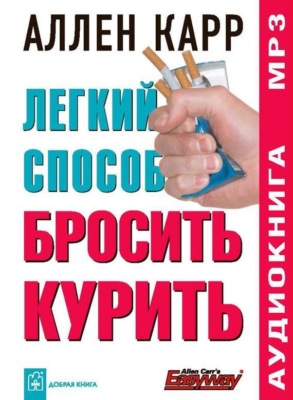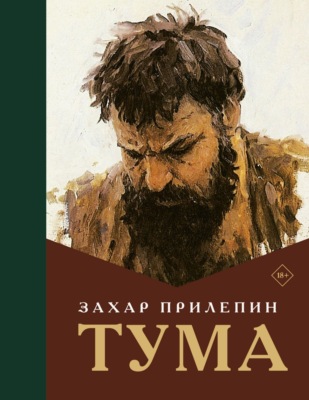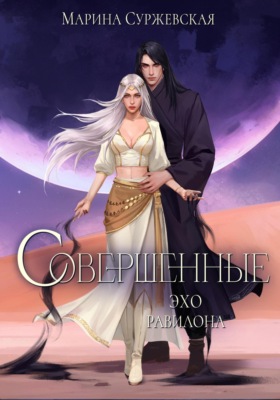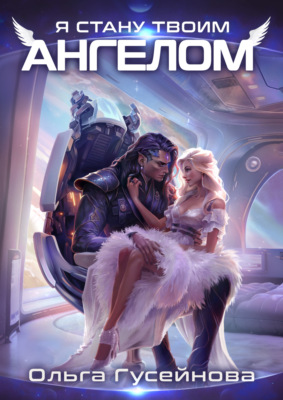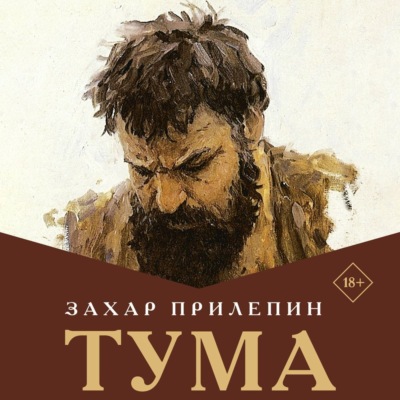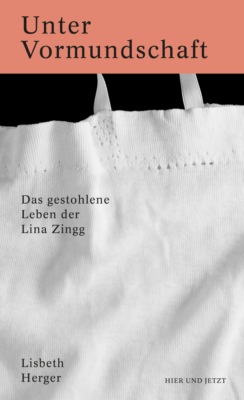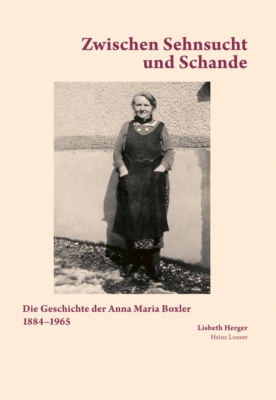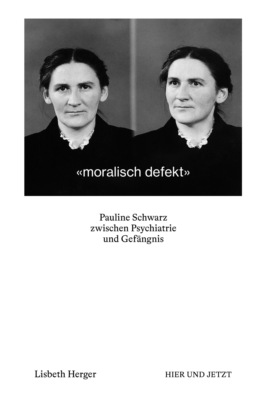Loe raamatut: «Lebenslänglich»

Lebenslänglich Briefwechsel zweier Heimkinder
Vorwort
Es gibt die Lauten. Und es gibt die Leisen. Das gilt für den Alltag. Für die Politik. Und auch für die Geschichtsschreibung.
In diesem Buch melden sich zwei Leise zu Wort. Zwei ehemalige Heimkinder, denen man das Reden früh abgewöhnt hat. Mit kalter Lieblosigkeit. Mit Drill und Strafen. Mit Gewalt. Sie standen eines Tages in meinem Büro, erzählten von ihrer qualvollen Kindheit und von den vielen posttraumatischen Belastungen, denen sie ein Leben lang ausgeliefert geblieben sind. Sie beklagten die Einseitigkeiten im aktuellen medialen Diskurs, zum Beispiel, dass die Heimkinder hinter dem bekannten Bild des Verdingkindes zu verschwinden drohen. Und bemängelten, dass man viel von schlimmen Kindheiten, aber wenig vom davon beschädigten Leben als Erwachsene zu hören bekomme. Genau darüber möchten sie schreiben, erklärten sie, und legten eine hochkomplexe Projektskizze auf den Tisch – ein von ihren Erfahrungen genährtes Fachbuch zu posttraumatischen Belastungsstörungen sollte es werden. Sie erzählten aber auch, wie sie sich, 51 Jahre nach ihrem Weggang aus dem schrecklichen Heim, nach einem langen, sehr unterschiedlich gelebten Leben – er als Hauswart, sie als Akademikerin – auf ihren Wegen wiedergefunden hatten. Bei der Suche nach ihren Akten. Dank eines aufmerksamen Staatsarchivars, der die beiden aufeinander hingewiesen hatte. Und sie berichteten von ihren regelmässigen Treffen danach, von ihrem intensiven Mailwechsel, von ihrer Einmischung in die politischen Prozesse der «Wiedergutmachung» und von ihrem Rückzug daraus.
Das war der Anfang zu diesem Buch. Diana Bach und Robi Minder mit ihren Erzählungen, am alten, vom Holzwurm gezeichneten Tisch meines Besprechungszimmers. Dann kam eine Menge Material dazu. Ein paar Kilogramm Akten zu ihrer behördlich verwalteten Kindheit. Über 600 Mails, die sie sich von 2013 bis 2016 geschrieben hatten. Dann davon unabhängige biografische Texte, eine Heimbiografie von Robi Minder, Fragmente zu ihrem Leben von Diana Bach und immer wieder lose, assoziative Nachträge. Und natürlich lange Gespräche.
Um all das Dokumentierte, aber auch das Fragmentierte und das Unsagbare in einen lesbaren Text zu bringen, brauchte es den ordnenden Blick von aussen. Der Materialberg wollte strukturiert, erzählerisch zusammengefügt, aber auch historisch kommentiert werden. So hat das Buch zu seiner Form gefunden. Ausführliche Porträts von Robi Minder und Diana Bach, nachgezeichnet bis ins Pensionsalter, unterlegt mit den Akten zu ihrer Kindheit und Jugend. Dann ein Porträt des Heims, das sich als wärmende Grossfamilie in einer Villa präsentierte, derweil hinter den Pforten die Angst regierte. Schliesslich ein Briefwechsel als komponierte Montage mit Originaltexten der beiden. Und begleitende Kommentare zur Einbettung des Geschehens in die jüngste Aufarbeitung der Geschichte um fürsorgerische Zwangsmassnahmen in der Schweiz.
Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes wurden – mit Ausnahme öffentlicher Personen – sämtliche Namen und Orte mit Pseudonymen versehen und nicht erkennbar gemacht. Diana Bach und Robi Minder aber gibt es wirklich. Sie sind im lebendigen Gespräch, wie die Fotografien auf dem Cover und im Buch illustrieren.
Der Bundesrat hat 2014 die Unabhängige Expertenkommission (UEK) Administrative Versorgung eingesetzt und 2017 das Nationale Forschungsprogramm «Fürsorge und Zwang – Geschichte, Gegenwart, Zukunft» beim Schweizerischen Nationalfonds in Auftrag gegeben. Diese wissenschaftliche Aufarbeitung ist wichtig und wertvoll, ihre Ergebnisse werden mit Zahlen und vertieften Analysen klären helfen, wie dieses Kapitel der Schweizer Sozialgeschichte verstanden werden kann. Das vorliegende Buch hat einen anderen Anspruch. Hier steht die Sicht zweier ehemals «administrativ Versorgter» im Zentrum, die ein ganzes Leben lang darunter gelitten haben. Ihre Erfahrung aber wird eingebettet in die Zeitgeschichte von damals und in die aktuelle Aufarbeitung der Vorgänge von heute. Umfangreiche Recherchen und Studien des Archivmaterials liefern die Koordinaten dazu. So wird Geschichte erleb- und hörbar. Damit man die Leisen, so Diana Bach, wie die zarten Geigen in einem mit Bläsern besetzten Orchester, nicht einfach überhört.
Lisbeth Herger, Sommer 2018
Robi Minder *1949
Diana Bach *1948
Das Kinderheim Villa Wiesengrund
Briefwechsel zwischen Diana Bach und Robi Minder, 2013–2016
Dokumente
Dank
Quellen und Literatur
Robi Minder *1949
Als Robi Minder in die Januarkälte des Jahres 1949 in Basel hineingeboren wird, steht eine fast normale Familie an seinem Bettchen. Seine Mutter Margrith war nach gescheiterter Ehe ins elterliche Haus zurückgekehrt, alleinerziehend mit zwei Kindern, liess sich dort von den Gitarrenklängen eines Zimmerherrn verzaubern und verliebte sich in den Untermieter Fritz Minder. Sie wurde bald schwanger, und zwar mit Robi. Die beiden heirateten. Fritz suchte als Hilfsarbeiter seine Jobs, sie arbeitete im Service, das Geld blieb knapp. Der Alltag zeigte sich borstig und die Liebe vergänglich. Denn Ehemann Minder ist doppelgesichtig, ein melancholischer Träumer, aber auch jähzornig, gewalttätig, depressiv. Robi war noch nicht geboren, als das Paar ein erstes Mal auseinandertrieb. Ein späterer Neustart missglückt – doch Mutter Margrith ist bereits wieder schwanger. Nur wenige Monate nach der Geburt von Robis Schwester Elisabeth entschliesst sich die verzweifelte Mutter zur definitiven Scheidung, die beiden Minder-Kinder muss sie, die Lohnarbeiterin, fremdplatzieren. Die Aufteilung und Trennung der Familie hinterlässt auch bei den Älteren Trennungsschmerz und Schuldgefühle. Silvia wird sich ein Leben lang verantwortlich fühlen dafür, dass ihre Halbgeschwister ins Heim gegeben wurden, schliesslich war sie es, die einmal die Mutter auf ihrer Arbeit abends in der Kneipe aufsuchte und damit, so nimmt sie fälschlicherweise an, das behördliche Augenmerk auf die Familie zog.
Die nächsten Etappen der Minder-Geschwister sind nur mit Eckdaten dokumentiert, zu finden in einer sehr viel später angelegten Rumpfakte des Waisenhauses Basel: Abgabe der beiden Kinder Anfang Mai 1952 im Diakonissenhaus in Riehen durch Mutter Margrith, Robi ist gerade mal drei, Elisabeth ein Jahr alt. Umplatzierung noch im selben Herbst auf den Hasliberg im Berner Oberland, in ein religiös geführtes Heim, wie es sie viele gibt, damals, in der ländlichen Schweiz. Die Kinder sind also weit entfernt von den inzwischen getrennten Eltern. Robi und Elisabeth bleiben dort drei Monate. Es fehlen Informationen über das Heim und die Kinder zu jener Zeit. Einzig eine blasse Erinnerung an eine Klage seines Vaters ist Robi geblieben. Dieser habe sich nicht an die offiziellen Besuchszeiten gehalten und sich dadurch Konflikte mit der Heimleitung und dem Jugendamt eingehandelt. Ob dies der Grund für die erneute Umplatzierung ist, nach nur drei Monaten, bleibt Spekulation. Jedenfalls steht die nächste Station an, das kleine Privatheim mit dem stilvollen Namen Villa Wiesengrund, noch weiter von Basel entfernt, in der Ostschweiz, genauer in Auwil. Die Fahrkosten dorthin sind noch höher. Dieses evangelische Familienheim will unter streng religiöser Führung milieugeschädigten und verwahrlosten Kindern Heim und Ersatzfamilie sein. So erklärt der erste Tätigkeitsbericht von 1954 die Ziele des wohltätigen Werks. Der Wiesengrund, wie die Heimkinder ihr Zuhause nennen, steht in Konzept und Führung anderen christlich orientierten Heimen dieser Zeit, etwa jenen der Bündner Stiftung Gott hilft, sehr nahe. Man lebt familiär als Grossfamilie und hofft, über religiöse Erziehung, Disziplin, Arbeit und über tiefe Liebe die milieugeschädigten Kinder von ihren Lasten zu befreien und sie zu lebenstüchtigen Menschen heranzuziehen (siehe Porträt des Heims Villa Wiesengrund).
Im Kinderheim Villa Wiesengrund
Im Januar 1953 werden die Geschwister Minder also aus den Hasliberger Schneehängen in die Rebberge bei Auwil versetzt und dort einer neuen Fürsorge übergeben. Anton und Rosmarie Furrer, die tief religiösen Heimeltern der Villa Wiesengrund, verstehen ihren Einsatz als Berufung Gottes und als Dienst in seinem Namen. Sie führen das Heim, seit seiner Gründung sieben Jahre zuvor, im Auftrag einer Stiftung. Die Villa Wiesengrund selbst ist ein herrschaftliches Haus mit grossem Umschwung. In der Wohnstube schart sich das Dutzend Kinder um die langen Tische, zwischen zwei und 16 Jahre alt sind sie, vorn an der Stirnseite sitzt das Heimelternpaar, zu dessen Rechter und Linker die beiden Söhne und die Tochter. Vater Furrer arbeitet tagsüber in einem Kontor ausser Haus, die eigentliche Erziehung obliegt seiner Frau, Rosmarie Furrer, sie ist die mächtige und prägende Mutter des Heims.
Robi ist nun vier Jahre alt, seine kleine Schwester zwei. Das neue Heim bedeutet für sie eine noch radikalere Trennung von den Eltern. Nicht nur wegen der grossen Distanz, sondern auch, weil im Wiesengrund noch strengere Besuchsregeln als auf dem Hasliberg gelten: Vier Stunden, periodisch alle fünf Wochen, sind erlaubt, und am Anfang, in der Phase der Eingewöhnung, wird für drei Monate ein totales Besuchsverbot verfügt. Darunter leiden nicht nur die Kinder, sondern auch Vater Minder. Sein Schmerz findet sich in mehreren seiner Bitt- und Erkundigungsbriefe, die alle korrekt im Archiv des Heims abgelegt und als dessen Teil schliesslich im Staatsarchiv St. Gallen gelandet sind. Dort fand Robi Minder die Klage seines Vaters, in seinem ersten Brief an die Heimeltern Furrer, in einer sanft fliessenden Schrift und ohne jeden Fehler: «[…] wie man mir sagte, ist während drei Monaten (bis Mai) keine Besuchszeit. Nun, ich schicke mich darein, obwohl ja diese Kindlein noch das einzige sind, das ich habe, für das ich lebe […].» Der erhoffte Ausnahmebesuch an Ostern wird wegen der Sperrfrist abgelehnt, Vater Minder muss sich mit der Korrespondenz mit den Heimeltern als Ersatz trösten: «Nun, wie geht es dem Robi und dem kleinen Bethli? Ich habe sehr lange Zeit nach ihnen.» «Sagen Sie doch bitte dem Robi und dem Bethli viele liebe Grüsse vom ihrem Pa, der ja so viel an sie denkt.» Erst vier Monate nach Eintritt wird ein erster Besuch möglich: «Ich besuche die Kinder definitiv am 1. Sonntag im Mai, denn ich habe sie seit Weihnachten nicht mehr gesehen und ich will auf gar keinen Fall, dass die Kinder sich von ihrem Vater entfernen», schreibt Vater Minder ungeduldig. Er hat damals auch ernsthafte Pläne, seine Kinder wieder zu sich zu nehmen, hochfliegende Träume eines Mannes, der seine Schuld verdrängt. Fürsorgerin Seliner, die per Mandat zu Robis Patin geworden ist, hat für die Pläne von Vater Minder nichts übrig und schreibt den Furrers einen warnenden Brief: «Der Vater erzählte kürzlich, er erhalte nun eine Kommunalwohnung im Hinblick darauf, dass er Robi und Elisabeth im Herbst zu sich nehme. Seine ehemalige Frau sei einverstanden. Ich hoffe nur, dies stimme nicht oder das Jugendamt sei dagegen. Hr. Minder hat ja aus der jetzigen Ehe ein Kind u. soviel ich weiss, hat seine Frau noch ein eigenes daheim. Sie wäre vermutlich der Erziehung nicht gewachsen und ausserdem würde vermutlich der Lohn nicht ausreichen. Vor allem aber glaube ich, dass Hr. Minder sich gegenüber den verschiedenen Kindern nicht recht verhalten würde […]. Er hat mir einmal erzählt, dass er einen Vorarbeiter geschlagen hat. Auch ist er ja eher bequem.» Fritz Minder gründete also mit seiner zweiten Heirat gleich auch eine neue Familie. Er wird Stiefvater von einem Kind, das seine Frau bereits in die Ehe mitbringt, und bald einmal Vater von zwei eigenen, die er abgöttisch liebt. Mit all diesen Vaterpflichten für insgesamt fünf Kinder ist der Hilfsarbeiter und Gelegenheitsschreiner schlicht überfordert. Und es ergibt sich von selbst, dass für die fern Platzierten am wenigsten Zeit und Geld übrig bleibt. Und dennoch, trotz der hohen Fahrkosten, lässt es sich Vater Minder nicht nehmen, die beiden regelmässig in Auwil zu besuchen. Und ebenso regelmässig treffen während der ganzen zehn Heimjahre Briefe aus Basel ein, die sich nach Röbeli und Bethli und etwa ihren Weihnachtswünschen erkundigen. Mutter Margrith hingegen ist mit den ihr verbliebenen Kindern und dem kleinen Serviertochterlohn vorerst in jeder Hinsicht überlastet, zudem wird sie später ebenfalls erneut heiraten. Sie schafft in den ersten sechs Heimjahren keinen einzigen Besuch bei ihren fernen Kindern.
Die Anfangszeit im Wiesengrund gestaltet sich für Robi und seine Schwester aber nicht nur wegen der Trennung von den Eltern schwierig. Der Wiesengrund nennt sich zwar «Kinderheim», ist aber alles andere als ein wärmender Hort für verlassene Kinderherzen. Die Geschwister werden selbstverständlich nach Geschlechtern getrennt untergebracht, Robi kommt als dritter zu den Buben im oberen Stock, Elisabeth im Parterre ins Mädchenzimmer.
Das Heimregiment ist fromm und streng, das Einhalten der vielen Regeln wird straff kontrolliert, freie Zeit gilt als Tor zur Sünde. Gegessen wird, was auf den Tisch kommt, oft schmeckt es widerlich für Kindergaumen, zum Frühstück gibt es rohes Sauerkraut mit Wacholderbeeren, in die Suppe kommt, wenn man Pech hat, löffelweise Lebertran, der Haferbrei wird aufgetischt, bis er gegessen ist, mehrere Tage, selbst dann noch, wenn er längst schimmlig ist.
Robi und seine kleine Schwester reagieren unterschiedlich heftig. Eine heftig juckende Neurodermitis, die den ganzen Körper und die Kopfhaut befällt, beginnt beide mehr und mehr zu plagen. Ob Rosmarie Furrer als ausgebildete Krankenschwester die Krankheit erkennt und um mögliche Therapien weiss, ist unklar. Auffällig ist, dass das heftige Leiden in der archivierten, sonst in Gesundheitsfragen präzisen Korrespondenz der Heimeltern mit allen massgeblichen Instanzen nie erwähnt wird. Jedoch kreiert Heimmutter Furrer eine hauseigene Methode, um das blutige Aufkratzen der befallenen Haut zu verhindern: Die Arme der Kleinen werden in Kartonröhren verpackt, die Hülsen zusätzlich hinten über den Nacken mit einem Bändel zusammengebunden, um so den Bewegungsradius weiter zu minimieren. Kratzen ist nun nur mehr über eine körperfremde Hand möglich, sie sind gänzlich vom Wohlwollen anderer abhängig. Sonst aber reagiert das kleine Bethli weit heftiger auf all die Wechsel und das lieblose Heimregime, mit Essensverweigerung während mehrerer Jahre, nur Flüssignahrung lässt es sich füttern, dann auch mit Krankheiten und Bettnässen. Gegen dieses Übel bekommt das Kind später eine Salzdiät verordnet: Brotscheiben mit viel Salz, das soll das Wasser im Körper binden und nachts die Leintücher trocken halten.
Robi, dem Älteren, gelingt es etwas besser, sich den neuen Umständen erst einmal anzupassen. Er hat bereits erste Sensoren ausgebildet, die ihm helfen zu erraten, was die Erwachsenen von ihm wollen. Er holt sich damit Brosamen in Form von Aufmerksamkeit und einen lobenden Eintrag in der Akte der Basler Jugendfürsorge: «Mit Robi geht alles gut, er ist lieb und ziemlich gut zu haben. Er scheint sich ganz normal zu entwickeln», kann der erwachsene Robi Jahrzehnte später über seinen Eintritt im Wiesengrund in einer Aktennotiz lesen. Diese Akte hat er schliesslich bei seiner hartnäckigen Suche nach Spuren im Basler Waisenhaus aufgespürt. Zwei eng beschriebene Bogen Papier, mit halbjährlichen Einträgen, in einer rückwärts gerichteten Handschrift geschrieben, von einer Basler Fürsorgerin, die sich telefonisch über das Wohl des Buben in der fernen Ostschweiz informiert hatte. Dies ist die Essenz von zehn Jahren Heimerfahrung, konserviert in 19 Kurznotizen, die erste datiert im Juni 1953, die letzte im Oktober 1963; es ist sozusagen das Kompendium einer Kindheit aus behördlicher Sicht, erzählt von den Heimeltern, übersetzt und verdichtet durch die zuständigen Behörden. Der grosse Aktenberg zu Robi Minders Kindheit jedoch, die Vormundschaftsakte, die sämtliche behördlich verwalteten Bewegungen seiner ersten zwanzig Lebensjahre dokumentiert hätte, die wurde geschreddert, wie er zu seiner grossen Enttäuschung erfahren musste.
Dafür aber ist das Jahrzehnt im Kinderheim Wiesengrund genauestens dokumentiert, in einem hauseigenen Archiv, das erst 2015 dem St. Galler Staatsarchiv übergeben wurde und in dem nebst den Akten zum Heim und der Stiftung fast alle Personenakten zu den Kindern aufbewahrt wurden. Ein Glücksfall für die Rekonstruktion dieser Kinderschicksale, auch wenn Robi Minder, das ehemalige Heimkind, zuerst einmal bitter enttäuscht war, als er das 2,4 Kilogramm schwere Aktenpaket, angeliefert aus St. Gallen, mit Herzklopfen öffnete. Denn schnell wurde dem unruhig Suchenden klar, dass in den Hunderten von Blättern, Berichten und Briefen herzlich wenig über seine eigene Entwicklung und die seiner Schwester zu finden sein würde, keine sorgfältig formulierten Entwicklungsprotokolle mit pädagogisch und psychologisch geschultem Blick auf das psychische Wohl der Kinder, mit all den Fortschritten und Sorgen darum herum. Der gewaltige Aktenberg ist kein Seelenspiegel kindlicher Entfaltung, sondern das Monument einer immensen Verwaltungsarbeit. Er illustriert eindrücklich den ungeheuren administrativen Aufwand, den die Heimeltern in der Zusammenarbeit mit den Behörden und Verwandten zu leisten hatten. Oder den sie meinten, leisten zu müssen. Damals bedeutete Kommunikation fast immer den Griff zum Stift oder zur Schreibmaschine, Telefonieren war teuer und für Notfälle reserviert, Internet und Mailverkehr gab es gar nicht. Alles wurde brieflich organisiert, erfragt, bestätigt, festgehalten, in umfangreichen Korrespondenzen mit der Basler Behörde, mit den Eltern, mit fernen Familienmitgliedern und den neu ernannten, den Kindern völlig unbekannten Fürsorgepaten. Es geht darin um Kostgeldabrechnungen für den Heimaufenthalt, aber auch um Kostengutsprachen für Krankheiten, für den Zahnarzt, für verbilligte Fahrkarten bei Reisetätigkeiten und weiter um Antworten zu Besuchs- und Feriengesuchen und um die Klärung von Geburtstags- und Weihnachtsgeschenken. Die Eltern, der Götti und die Gotte erfragen die Wünsche der Kinder, die Heimeltern antworten mit pragmatischem Blick auf den karg bestückten Kleiderschrank. Irgendwo im Brief versteckt sich stets ein obligater, stereotyper Satz zum Befinden der Kinder, die meist als «gesund und munter» beschrieben werden. Nur schwerere Krankheiten, die eine Arztvisite oder – wie bei Bethli wegen seines späteren chronischen Nierenleidens als Folge des ewigen Barfusslaufens – einen Spitalaufenthalt erfordern, werden erwähnt. Sonst geht es den Schützlingen offenbar immer gut, und die Kinder selbst bestätigen dies in ihren von den Heimeltern verordneten und kontrollierten und in schöner Schrift geschriebenen Dankesbrieflein, wie man sie im Heimarchiv zu Dutzenden abgelegt findet. Glückliche Vorzeigekinder also, gelegentlich belegt ein mitgeschicktes Foto, auf dem gestrahlt oder zumindest gelächelt wird, das festgeschriebene Kinderglück.
Der verwaltungstechnische Aktenberg mit seinen rund 400 Blättern dokumentiert also diese aufreibende Administration, ist aber gleichzeitig ein Berg des Verschweigens, überschichtet das Wesentliche im kindlichen Alltag der Geschwister. Die spärlichen kleinen Freuden. Und noch viel mehr die ganz grosse Verlassenheit der beiden, ihre Trauer und Wut. Und die qualvolle Hilflosigkeit in der Zwinge dieser evangelikalen Heimdressur, bei der Gewalt nicht als Ausnahme, sondern in der Regel eingesetzt wird. Die Heimeltern Furrer sind fest entschlossen, ihren dem Laster und der Sünde entsprossenen Zöglingen das Böse auszutreiben und sie zu gottesfürchtigen und nützlichen Mitgliedern der Gemeinde Gottes zu erziehen. Dazu sind viele Mittel recht. Zuallererst die religiösen Rituale, das tägliche Bibellesen, das Beten vor und nach jeder Mahlzeit, das abendliche Absingen frommer Lieder, die regelmässige Selbstbezichtigung begangener Sünden, jedes Kind vor seinem Stühlchen kniend, alles vor der ganzen Heimgruppe. Diese Tagesrationen frommer Zucht und Ordnung wirken. In Robi wächst ein Gespinst von Heilsversprechen und Versagen, von göttlicher Bestrafung und unlösbarer Schuld, das sich zu existenzieller Wirrnis und zu Ängsten verdichtet. Er fühlt sich von einem mächtigen Gott verfolgt, der ihn in jedem erdenkbaren Winkel zu jeder Tages- und Nachtzeit beobachtet und alles sieht. Personifiziert ist dieser mächtige Gott in der Heimmutter Rosmarie, der Herrscherin über Heim und Kinder, die von den Kindern mit Mueti angesprochen werden will. Rosmarie Furrer sieht alles. Und noch viel mehr. Sie setzt Regeln und kontrolliert. Ihr grosses Auge wacht nicht nur über die Ess- und Arbeitsdisziplin ihrer Zöglinge, sondern auch über die spärliche Freizeit und über das Geschehen unter der Bettdecke. Zudem belohnt sie intrigantes Verhalten, wenn sich die Kinder untereinander verpetzen. Erzogen wird im Wiesengrund vor allem mit Strafen. Die Strafmacht der Heimmutter aber ist brutal und grenzenlos, wird zudem mit undurchschaubarer Willkür eingesetzt. Es gibt vorhersehbare Strafen, etwa, wenn Robi verbotenerweise schwatzt, und solche, die völlig unerwartet auf ihn niederfahren, wie ein göttlicher Blitz. Dabei verlässt Rosmarie Furrer den damals üblichen Rahmen der gewalttätigen schwarzen Pädagogik. Im Wiesengrund werden Schläge zum täglichen Brot, für die Kinder, aber genauso für die züchtende Schlägerin. Ihr Blick wird dabei glasig, der Schritt stramm, die Hand ein hartes Schlaginstrument. Sie schlägt und schlägt, ins Gesicht, auf den Kopf, auf den nackten Po, holt den Teppichklopfer als Verstärkung, sie zerrt wild an den Haaren, manchmal kniet sie gar auf den schmächtigen Rücken des Buben, greift in sein Haar und rüttelt den Kopf, traktiert ihn gleichzeitig mit Fäusten und Fingernägeln. Auch Robis kleine Schwester wird von der Gewalt nicht verschont. Auch ihr werden Haarbüschel ausgerissen. Auch sie wird die Treppe hinuntergestossen, sie schlägt unten hart an einem Korpus auf, die Delle im Kopf bleibt lebenslanges Zeugnis. Wenn Mutter Furrer mit Schlagen anfängt, kann sie oft nur schwer wieder aufhören. Manchmal wird der Tatort auch diskret verlegt. In das Schlafzimmer ihrer Tochter. Oder, weit schlimmer, in die Waschküche im Keller. Dort wird «den kleinen Teufelchen» dann zünftig auf den Leib gerückt. Etwa wenn Übermut die Buben verführt, sie sich, erhitzt nach dem Völkerballspiel, mit dem Gartenschlauch abspritzen und dabei auch noch ihren Spass haben. Die Heimmutter greift sich den schmächtigen Robi, zerrt ihn nach unten, schlägt mit dem Dichtungsschlauch der Waschmaschine auf ihn ein, schlägt und schlägt, die Bestrafung gerät zum sadistischen Exzess, der erst aufhört, als der Bub ohnmächtig geworden ist.
Manchmal zeigt sich der Sadismus auch verdeckter. Zum Beispiel beim wöchentlichen Baden. Der heute bald siebzigjährige Robi Minder, noch immer feingliedrig und schlank, erinnert sich nur zu gut an das wöchentliche Ritual in der grossen Wanne: Die Kinder werden der Reihe nach abgefertigt, für jedes nächste Kind ist das Badewasser kälter, warmes Nachgiessen untersteht gänzlich der Laune der Heimmutter. Es gefällt ihr, Robi wieder und wieder mit kaltem Wasser zu übergiessen, so lange, bis ihm das Atmen schwerfällt. Ihr fester Griff erlaubt keine Flucht. Seife in den Augen muss ertragen werden, das spontane Reiben mit den Händchen ist untersagt. Und wenn Robi sich dem Prozedere nicht ganz und gar unterwirft, riskiert er anschliessend Prügel auf den Hintern. Sadistische Lust ist wohl auch dann im Spiel, wenn Heimmutter Furrer den kleinen Robi ins Stickzimmer beordert, zu den fleissig arbeitenden Mädchen, ihn dort auf einen Schemel stellt und ihn die Hose ausziehen lässt, um ihm vor aller Mädchenaugen einen seiner wiederkehrenden und arg schmerzenden Furunkel am Po aufzuschneiden. Auch das ein sich wiederholendes Ritual. Oder als sie den Buben in die Waschküche holt, ihn vor die Zaine mit den niedlichen Welpen der Heimhündin Dolly stellt, jener Hündin, die Robi innig liebt und bei der er sich etwas Zärtlichkeit holt, und ihm dann einen Haselknüppel in die Hand drückt und gebietet, den wuseligen Wurf, die süssen Welpen, einzeln mit Kopfschlag zu töten. Robi Minder weiss heute nicht mehr, wie er die Qual ausgestanden hat. Er erinnert sich einzig, dass er stammelte, er könne das nicht, dann steigt das grosse Blackout in seinen Kopf, und die Stimme wird zittriger, wenn er nach der Fortsetzung sucht. Und ihm stattdessen einfällt, wie er manchmal auch nur in die Verbannung in die kleine Dunkelkammer musste, in jene Montageöffnung direkt unter der Toilette, wo sich verschiedene Abwasserrohre kreuzten und wo es stank. Ein dunkler, feuchter, kleiner Zwinger, in dem auch kleine Kinder nur kauernd Platz fanden.
Heimmutter Furrer schafft es erfolgreich, ihre sadistischen, dunklen Seiten gegen aussen zu verbergen. Inwieweit sie ihren Ehemann täuschen kann, ist unklar. Was Anton Furrer von diesen Exzessen genau wusste, darüber rätselt Robi Minder bis heute. Bei einer späteren Konfrontation – Robi ist längst ein gestandener Mann – lässt der pensionierte Heimvater die unbequeme Frage stoisch unbeantwortet. Damals aber, während der Jahre im Heim, erlebt Robi seinen Vati als ruhigen, streng religiösen und äusserst disziplinierten Mann, der tagsüber ausser Haus und nur beim Essen und bei den religiösen Ritualen präsent ist und ihm recht fern bleibt. Schläge von ihm gibt es nur selten. Und Rosmarie Furrer selbst ist sichtlich darauf bedacht, ihre sadistischen Auswüchse vor ihrem Mann versteckt zu halten. Wenn eines ihrer Opfer nach den Misshandlungen noch immer heult, die Augen rot verquollen, just bevor die Heimkehr des Vaters erwartet wird, drängt die Heimmutter auf sofortigen Heulstopp, heisst die Kinder, Rotz und Tränen wegzuwischen und sich unauffällig, mit gesenktem Kopf, an den Tisch zu setzen.
Für Robi gibt es, wie für die meisten der Heimkinder, niemanden, mit dem er über die schrecklichen Misshandlungen sprechen kann. Im Dorf gehört das Ehepaar Furrer zu den Angesehenen, sie geniessen Respekt. Kindergärtnerin und Lehrer sind mit Furrers befreundet, einige von ihnen gehen, wie andere Dorfhonoratioren auch, als regelmässige Gäste bei Furrers ein und aus, versammeln sich dort im evangelikalen Hauskreis zu Gebet und Gesang. Sie schauen weg, wenn Schläge auf kleinen Körpern sichtbar werden oder ihnen böse Gerüchte über schlimme Kellerrituale zu Ohren kommen. Zudem gibt es in zeitgeistiger Selbstverständlichkeit auch in der Schule Schläge. Hausarzt Dr. Bacher ist ebenfalls nicht zu trauen. Das weiss Robi nur zu gut, spätestens seit jenem Tag, als er, als eifriger Briefmarkenverkäufer für das Kinderhilfswerk Pro Juventute unterwegs, vor des Doktors Haustür steht und die Hausherrin es nicht für nötig hält, ihre Hunde zurückzurufen, sondern einfach zuschaut, wie der Bub von den Boxerhunden attackiert und gebissen wird.
Robi bleibt mit seinen Schmerzen und Qualen, mit seinen Ängsten und seiner verdeckten Wut allein. Einzig die bereits zitierten halbjährlichen Notizen der Basler Fürsorgerin dokumentieren die Auswirkungen der Traumata auf Robi und seine Entwicklung. Die Ein-Satz-Berichte und Ein-Wort-Sätze lesen sich wie eine in Sprache übersetzte Fieberkurve eines Patienten, dessen Krankheit niemand erkennt. Bis in die Anfänge der Kindergartenzeit bleibt Robi das «gefreute, lustige Kind, das nicht aus dem Rahmen falle und sich durchaus normal entwickle», das sogar «vom Kindergarten begeistert sei», auch wenn es «das Leben von der gemütlichen Seite nehme» und «nicht viele Stricke zerreisse». Auch die Einschulung schafft der Bub «besser als erwartet, ist für den Stoff interessiert, macht nett mit». Dann aber, nach dem ersten Schuljahr, beginnen die kritischen Bemerkungen: «[…] arbeitet nicht immer fleissig», «[…] ist in der Schule oft in Gedanken abwesend», «[…] hat Mühe sich zu konzentrieren», und wenig später, als Drittklässler, kassiert er dann im Halbjahresrapport die ersten gröberen Vorwürfe: «Robi ist faul, leistet in der Schule zu wenig […] man muss ihn immer wieder ermahnen, im Übrigen häufig launisch.» In den Jahren darauf wandeln sich die Beobachtungen zu abwertenden Urteilen: «[…] hat in der Schule Mühe zu folgen», nun wird er als «Pflegma» und als «wahrscheinlich nicht sehr intelligent» abqualifiziert. Zudem wird eine «Lügengeschichte» als «hoffentlich einmalige Verfehlung» dominant in der Akte vermerkt. Sie ist zusätzlich in einem eigenen Untersuchungsbericht vom 28. Mai 1960 dokumentiert und im Heimarchiv abgelegt. Der Bericht erzählt, dass der elfjährige Robi bei einem Diebstahl mit einer Schadenssumme von zehn Franken mitwirkte und anschliessend seine Kumpels nicht verraten wollte. Die Sache war aufgeflogen, weil die drei Buben im Dorf beim Eisessen beobachtet wurden und alle wussten, dass Heimkinder kein Taschengeld besassen. Der Anführer des kleinen Coups hatte überdies schon einmal einen Fünffränkler stibitzt, nun galt es dringlich, unter Federführung der Heimmutter, mit Visitation des Tatorts und Befragung der Lehrerschaft und der Schulkameraden, die Sache aufzuklären. Es gab Verhöre und Verdächtige, und nach «langem, einzelnen in sie hineindringen» und dem Einsatz von Schlägen kamen schliesslich die erhofften Geständnisse: «Robi brach zuletzt, nach langem, hartnäckigem Leugnen und als ihn der Hausvater durchprügelte, innerlich zusammen und gestand alles», steht im Untersuchungsbericht. Zwei Jahre später wagt sich Robi noch einmal an einen kleinen Schwindel: Er verlängert eine Darmgrippe mit ein bisschen Schmerzsimulation und einer Manipulation des Fieberthermometers, um sich so einen zusätzlichen Tag Krankenfürsorge zu sichern. Die Inszenierung fliegt auf, Robi brütet anschliessend über einem fünfseitigen Aufsatz zur Frage «Warum ich lüge». Der Aufsatz ist ebenfalls im Archiv abgelegt.