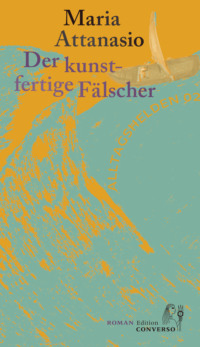Loe raamatut: «Der kunstfertige Fälscher»
MARIA ATTANASIO
Der kunstfertige Fälscher
Ausführliche Notizen über den kuriosen Fall des Paolo Ciulla aus Caltagirone
Aus dem sizilianischen Italienisch
von Michaela Wunderle
und Judith Krieg

Für Giovanni, den wachsamen und geliebten Wahrer meiner Schriften
»Wir wissen alle, daß Kunst nicht Wahrheit ist. Kunst ist eine Lüge, die uns die Wahrheit begreifen lehrt, wenigstens die Wahrheit, die wir als Menschen begreifen können. Der Künstler muss wissen, auf welche Art er die anderen von der Wahrhaftigkeit seiner Lügen überzeugen kann.«
Picasso, 1923
Inhaltsverzeichnis
Wie alles kam oder vom traurigen Ende der Lira.
PRÄAMBELEine Straße zwischen den Lavafeldern
ERSTER TEILDer Künstler schließt mit euch einen Pakt: findet sein Konterfei.
ZWEITER TEILRoman, das bedeutet nicht Lüge. Das Leben ist oft trügerischer als ein Roman.
DRITTER TEILVorsitzender: »Ich habe verstanden, jede Farbe …« Ciulla: »… jede Farbe hat ihren … Geschmack.«
EPILOGDie Mutter des Faschismus gebiert stets neue Kinder.
Anmerkungen
Kleines Glossar in alphabetischer Reihenfolge
Große und kleine Fälschungen und ein falscher und ein echter Prozess
WIE ALLES KAM
oder vom traurigen Ende der Lira
Im Jahr 2003 baten mich zwei Schriftstellerfreundinnen aus Kampanien, Antonella Cilento und Emilia Cirillo Bernabei, um einen kleinen Beitrag für eine Art literarisches Requiem auf das Ende der Lira, das als Sammelband mit dem Titel In fin di lira1 veröffentlicht werden sollte.
Da ich nicht wusste, was schreiben, sinnierte ich eine ganze Weile über eine passende Absage, als mit einem Mal Erinnerungen an allerlei aufgeschnappte Sätze aus meinen Kindertagen in mir zu rumoren begannen, darunter auch die vertraute Beschwörung des legendären Paolo Ciulla, Chiddu ri sordi farsi, »der mit dem Falschgeld«: zum einen Metapher für die wundersame Erlösung aus wirtschaftlichen Notlagen — und derer gab es in den Jahren des Wiederaufbaus nach dem Krieg zahlreiche und schwerwiegende —, zuweilen aber auch der Maßstab für einen rundum perfekten Betrug, eine makellose Täuschung.
Ich sagte meinen Freundinnen zu und machte mich auf die Suche nach Informationen über das private und öffentliche Leben des Fälschers Paolo Ciulla, im Archiv und in der Stadtbibliothek »Emanuele Taranto Rosso« in Caltagirone, seinem Geburtsort, sowie in der Bibliothek »Ursino Recupero« in Catania, wo er viele Jahre lang gelebt hat.
Ich verfasste einen Prosatext mit dem Titel Il curioso caso di Paolo Ciulla (Der kuriose Fall des Paolo Ciulla), der sich einige Monate später — infolge meiner Teilnahme an der Tagung zum Thema »Berühmte Strafverfahren«, zu der Professor Pasquale Beneluce an die Universität Messina geladen hatte — zu einem ausführlichen journalistischen Bericht über den spektakulären Prozess aus dem Jahr 1923 auswuchs, der den Fälscher auf der Anklagebank gesehen hatte.
Doch Paolo Ciulla trieb mich weiter um: Was ich über ihn geschrieben hatte, wurde weder seinem Leben noch meiner Einbildungskraft gerecht.
Ich setzte meine Recherchen im Staatsarchiv in Catania fort. Ein wahrer Glückstreffer war die Hilfsbereitschaft des Personals, dank dessen es mir gelang, die noch nicht systematisch archivierte fünfundachtzigseitige Begründung des Urteils, das die fünfte Strafkammer des Gerichts von Catania am 12. November 1923 verkündet hatte, ausfindig zu machen und zu fotokopieren.
Von diesen Dokumenten ausgehend, habe ich nach Belegen gesucht und Paolo Ciullas Lebensphasen rekonstruiert, obgleich sich die Überprüfung manches Mal als unmöglich erwies; auch den Inhalt der biografischen Rekonstruktion Paolo Ciulla, il falsario (Tringale, 1984) des Journalisten Pietro Nicolosi aus Catania, die mir zum Vergleich und zuweilen als Quelle diente, konnte ich nicht in allen Fällen verifizieren. Nicolosi ist ebenfalls Autor einer umfangreichen Chronik Siziliens (1900–1950), die eine Menge kurioser Meldungen aus den Lokalnachrichten, vorwiegend aus Catania, enthält. Eine davon, eine historische Notiz, reizte meine Phantasie besonders: Der »Gefreite Adolf Hitler« war als »Kriegsgefangener« in Sizilien, »interniert in Augusta und für den Bau eines großen Hangars für Luftschiffe eingeteilt«. Eifrig suchte ich in Geschichtsbüchern, in Monographien, im Internet nach Belegen dafür. Nichts. Es fand sich keinerlei Hinweis.
Und ohne objektive historische Belege konnte es weder imaginierte Begegnungen noch Berührungspunkte zwischen dem Ciulla meiner Vorstellungswelt und dem unglücklicherweise sehr realen Hitler geben.
Der Duktus der Erzählung wogt hin und her: von absoluter Faktentreue in der Präambel sowie im ersten Teil (die Figur des Cola ausgenommen) und im dritten Teil, über eine Mischung aus Realität und Phantasie im Epilog, bis hin zur vorwiegend fiktiven Rekonstruktion im zweiten Teil und bei den Figuren Masi und Juan.
Mit Sicherheit steht fest, dass Paolo Ciulla ein Zertifikat der Académie des Beaux Arts in Paris besaß, dass er als Kopist im Louvre arbeitete, dass er sich in Le Havre nach Südamerika einschiffte. Aber über sein Leben zwischen 1907 und 1910 ist weiter nichts Gesichertes bekannt.
Echte Dokumente also, und Berichte, häufig erfundener Art, die aber Ciullas Biographie immer als Möglichkeit einbeschrieben sind und sich auf plausible Weise mit historischen Daten und Fakten überschneiden.
Marguerite Yourcenar schreibt in Bezug auf Zenon, den Protagonisten des im 16. Jahrhundert spielenden L’Oeuvre au noir (dt. Die schwarze Flamme): Die Figuren historischer Romane sollten immer von Zeugnissen und Ereignissen gestützt sein, die den Fakten und Daten der Vergangenheit entstammen, also der kollektiven Geschichte, um der »fiktiven Figur diese besondere, durch Zeit und Ort bedingte Realität zu verleihen, ohne die ein ›historischer Roman‹ nur ein gelungener oder misslungener Kostümball ist«2.
Und nicht nur der fiktiven Figur, sondern bisweilen auch den schweigenden Leerstellen einer echten Lebensgeschichte, die durch ihre Verwandlung in Erzählung, wie alle Kunst, unweigerlich verfälschend, also ein Truggebilde ist.
PRÄAMBEL

Eine schwarze Wüste trat an die Stelle der wasserreichen Talsenke am Stadtrand, als am 9. Juni 1669 vor den Toren Catanias ein Vulkankrater ausbrach und sich von der Nesima-Hochebene gigantische Lavaströme hinabwälzten, das Castello Ursino, Trutzburg aus der Zeit Friedrichs II., am Meer umkreisten und ihren Weg fortsetzten. Und so kam es, dass sich das Schloss am Ende zwei Kilometer von der Küste entfernt befand.
Wenige Jahrzehnte später schon war auf jener kahlen Anhöhe ein Maultierpfad entstanden, der bald befahrbar werden sollte, und 1918 — längst drängte die Stadt über ihre Mauern hinaus — zu einer richtigen Allee geworden war, die der Bürgermeister Giuseppe De Felice Giuffrida dem einige Jahre zuvor verstorbenen Dichter Mario Rapisardi widmete, dessen Schöpferkraft auch in eine flammende Kontroverse mit Giosuè Carducci geflossen war.
An beiden Seiten der Allee standen vereinzelte Häuser, und einige Sträßchen zweigten von ihr ab, die sich schon nach wenigen Metern inmitten der Lavafelder verloren.
In einem dieser Häuser, rosa getüncht und etwas zurückversetzt, lebte am fast unbewohnten Ende der Straße ein seltsames Individuum: ein Mann mittleren Alters, der sich als pensionierter Lehrer ausgab, und bei allen als der »Mavaro«, der Hexenmeister, bekannt war. Keiner hatte je einen Fuß in sein Haus gesetzt, denn unter wüstem Geschimpfe verjagte er fahrende Händler, Bettler ebenso wie die Nachbarn.
Nicht weit entfernt, in einem Seitensträßchen mit dem phantasievollen Namen Pietra dell’Oro, Stein von Gold — verblasste Erinnerung vielleicht an alchemistische Betriebsamkeit und unter Lava begrabene Schätze — wohnte Elia Gervasi, einer aus der Regia Guardia, der Königlichen Garde im Dienste der öffentlichen Sicherheit, die dem Innenministerium unterstellt war.
Für einen Ordnungshüter vom Scheitel bis zur Sohle wie ihn war eine nicht zu entschlüsselnde Situation, anders gesagt, die Undurchschaubarkeit einer menschlichen Existenz eine echte Qual. Für ihn galt der kategorische Imperativ: Obskure Ereignisse sind im klaren Licht der Ermittlerräson zu bewerten.
Das unentwegte Gerede seiner Ehefrau über den »Mavaro« hatte ihn von Anfang an in Unruhe versetzt: Ein Meister der schwarzen Künste, der keine Kunden empfing, war nicht glaubhaft. Also begann er, seine ganze freie Zeit opfernd, dessen Tun und Treiben auszukundschaften. Er ermittelte den Besitzer des Hauses, die Höhe der gezahlten Miete, Name und Vorname des Mieters — alles in allem lächerliche Ergebnisse. Das Geheimnis jenes Hauses, aus dessen Rauchfang bisweilen übelriechende Schwaden wie von tierischen Fetten und gekochten Innereien quollen, und des nach außen hin gleichförmig und ereignislos verlaufenden Alltags des besagten Mannes blieb ungelüftet. Jeden Morgen, bei Regen wie bei Sonnenschein, verließ dieser pünktlich um acht Uhr sein Haus, bahnte sich mithilfe eines Stocks seinen Weg zwischen Basaltplatten und Lavaschlacken, und hielt dabei meist ein kleines Bündel in der Hand. Nach ein paar hundert Metern erreichte er die Piazza und verweilte dort einige Stunden am Tischchen einer gutbesuchten Bar, wo das Kommen und Gehen der Gäste eine Überwachung mehr als erschwerte. Bisweilen bestieg er eine Trambahn und entschwand in Richtung Stadtmitte, um dann Punkt halb elf wieder auf der Piazza aufzutauchen — ohne besagtes Bündel in Händen. Bedächtigen Schritts ging er die Allee entlang zurück zu seinem Haus, wo er sich einschloss und keiner mehr etwas von ihm mitbekam.
Dieses Bündel und die Rauchschwaden wurden für den Königlichen Sicherheitsbeamten zur fixen Idee. Ganze Abende verbrachte er zwischen dem Lavageröll, das an den Gemüsegarten hinterm Haus angrenzte, um den Mann auszuspähen. Dank eines unvorhergesehenen Ereignisses gelang es ihm, mehr in Erfahrung zu bringen. Die Nachricht, dass der »Mavaro« einen Schreiner — einen seiner Vertrauten — zu sich gerufen hatte, der die Fenster- und Türrahmen sowie die Schlösser verstärken sollte, verbreitete sich in der ganzen Nachbarschaft. Ein paar Tage danach suchte Gervasi diesen Handwerker auf und zwang ihn, das Haus und alles, was sich darin befand, mehrere Male aufs Genaueste zu beschreiben, vor allem die Gegenstände, angehäuft in dem größeren der beiden Räume, aus denen die Wohnung bestand: ein Durcheinander von Ampullen mit unterschiedlich gefärbten Flüssigkeiten, Papierrollen, Fotoapparaten und unbekannten, mit Tüchern bedeckten Gerätschaften. Besonders beeindruckt war der Schreiner vom Schlafzimmer, das sparsam und altmodisch eingerichtet war — zwei Truhen, ein Nachttisch, zwei Stühle, ein Bett. An den Wänden aber hingen zahlreiche seltsame Bilder. Eines war besonders merkwürdig: Zwei Gesichter, hohl wie Masken, schwammen auf einem tiefschwarzen Hintergrund, und beide trugen die Züge des professore, wenn auch jedes mit einem anderen Ausdruck: Das eine in Azurblau zeigte ihn mit spöttischer Miene, das andere bleich und mit unheilvollem Blick. »Er ist wirklich ein Hexenmeister«, schloss der Mann seinen Bericht, machte das Kreuzzeichen und fasste sich flüchtig an die Genitalien, um gegen die bösen Geister gefeit zu sein.
Die von dem Schreiner beschriebenen Dinge verstärkten Elia Gervasis Verdacht, der eines Abends gegen Ende des Sommers zur Gewissheit wurde. Entgegen seiner Gewohnheiten hatte der Mann länger als sonst das Fenster seines Schlafzimmers offengelassen, als er mit der Lampe in das andere Zimmer ging, dessen Fenster Tag und Nacht fest verriegelt blieben. Mit einem Sprung setzte darauf der Königliche Gardist über das Mäuerchen des Gemüsegartens und schlich sich unter besagtes Fenster: In dem abgedunkelten Zimmer waren auf halber Höhe von der einen zur anderen Wand Schnüre gespannt, an denen mit Wäscheklammern befestigte Papiere hingen. Obwohl er die einzelnen Blätter nicht gut erkennen konnte, war er sich doch unmittelbar sicher, dass es sich um Fälschungen handelte: um Coupons oder wieder aufbereitetes Stempelpapier. Oder um Geldscheine.
Gervasi beeilte sich, den Kommissar Taddeo Gulizia über seinen Verdacht in Kenntnis zu setzen. Der konnte es kaum fassen, endlich einen neuen Tatverdächtigen in die Finger zu bekommen. Schließlich wurde er tagtäglich von den Zeitungen wegen angeblicher Untätigkeit angegriffen und musste noch dazu die Schikanen des Polizeipräsidenten und des Präfekten ertragen. Dass in Catania, zwischen Cibali und Ognina, eine Werkstatt zur Herstellung gefälschter Hundert-Lire-Scheine ihren Sitz haben musste, das stand für alle — von Palermo bis New York — außer Frage. Dennoch waren Wochen verbissener Nachforschungen bislang vergeblich gewesen.
Sorgfältig und mit äußerster Diskretion bereitete Gulizia den Zugriff vor. Um die Gewohnheiten des Mannes eingehend zu studieren und den Zeitpunkt des Eindringens festzulegen, schickte er Polizisten in unterschiedlichen Verkleidungen los, damit sie das Haus Tag und Nacht überwachten, und schließlich gab er Petralia — dem besten Ermittler in Sachen gefälschter Papiere — den Auftrag, koste es, was es wolle, dort einzusteigen.
Eine Verkleidung als Frau, so sein Vorschlag, würde dabei sicherlich von Nutzen sein.

Als die aufwendige Verkleidung dann recht und schlecht saß, bat der Ermittler Petralia einen Kollegen um seine Meinung. »Hässlich und ordinär«, lautete das entmutigende Urteil. Sich im Spiegel betrachtend, wie er sich ein leichtes Wolltuch über die Schultern drapierte, musste er ihm Recht geben. Er hängte sich noch ein Kästchen um, aus dem Bänder, Nadeln, Scheren und Garnröllchen hervorschauten, und verließ, über die Angemessenheit seiner Ausstaffierung unschlüssiger denn je, das örtliche Kommissariat durch einen Nebeneingang.
»Was ich mir alles antun muss, bloß um über die Runden zu kommen«, dachte der Polizist, während er sich langsam zu seinem Einsatzgebiet auf den Weg machte. Das war aber nur sein übliches Gemurre bei der Arbeit; in Wirklichkeit hielt er sich für privilegiert gegenüber seinen Kollegen, die ständig wegen der Angriffe der politischen Schlägertrupps, welche sich in den letzten Monaten immer dreister aufführten, gerufen wurden — und zwar weniger um einzugreifen, als um die Faschisten zu decken, indem sie Arbeiter und Gewerkschafter mit Überfällen in deren Häusern und Schießereien in Schach hielten.
»Befehl ist Befehl, und Brot ist Brot«, sagte sich der Hüter der öffentlichen Sicherheit schließlich resigniert. Aber aus dem hintersten Winkel seines Gedächtnisses, wohin er sie abgedrängt hatte, erschallten ohrenbetäubend die Schreie der Männer und Frauen an den blockierten Türen des Teatro Sangiorgi. Die Pistolenschüsse, die Gewehrsalven auf die im Theater versammelte Menschenmenge, die wegen des Massakers an neun Arbeitern aufbegehrte, das sich zwei Tage zuvor, am 28. Juli 1920 in Randazzo ereignet hatte.
In den Haufen schießen, den Protest unterbinden, so lautete der Befehl.
Und geschossen hatten sie, und ob! Blutspritzer auf dem weißen Stuck, auf den Jugendstilblumen des Eisengitters: Tote und Verletzte überall, und ein Kind mit weit aufgerissenen Augen, sich die Ohren zuhaltend, das sie gewaltsam unter einem Sessel hervorgezerrt hatten.
Einen Monat später war er endgültig in die Fahndungsabteilung gewechselt und hatte fortan — von einer wahren Last befreit — ausschließlich gegen Geldfälscher, Diebe, Betrüger aller Art zu ermitteln; das war nun zwei Jahre her.
Das Leuchten eines Kakibaums, der sich sonnenbeschienen und in vollem Fruchtstand vor der unbeschwerten Klarheit des Oktobermittags abhob, verwischte diese Bilder. Er konnte wieder tief durchatmen, während er das Stimmengewirr der Innenstadt hinter sich ließ, auf dem Weg in den abgelegenen Teil der Allee, dorthin, wo sich die Häuser umringt von der riesigen schwarzen Wüste der Lavaschlacken lichteten.
Um seine Verkleidung zu erproben, blieb er vor jeder Tür stehen, seine Waren im Falsett den Frauen des Hauses feilbietend, von denen ihm gar eine in weiblicher Vertraulichkeit innerhalb einer Viertelstunde ihr ganzes Leben erzählte — der schwächliche Ehemann, die prügelnde Schwiegermutter, der undankbare Sohn — und ihn am Ende um seiner Unversehrtheit willen beschwor, einen großen Bogen um das Haus des »Mavaro« zu machen.
»Gott steh uns bei«, sagte sie und wies auf das Haus, »er liest das Libro del Cinquecento4 und nachts ruft er die Geister an.« Die Verkleidung tat ihren Dienst.
Entschlossen legte er die rund hundert Meter zurück, die ihn noch von der Hausnummer 431 trennten. Zu dieser Zeit musste der Mann daheim sein, wahrscheinlich im Bett fürs Nachmittagsschläfchen. Lange klopfte er an die Tür. Vergebens. Er klopfte lauter, heftiger. Endlich öffnete sich das Fenster, ein verschlafener Mann im Unterhemd zeigte sich voller Zorn. »Was ist das denn für eine Art, mich zu stören! Hau ab, ich habe geschlafen«, und als er die Silhouette einer Frau erblickte, setzte er hinzu, »Weiber gibt es hier im Haus keine!« Und damit schloss er das Fenster mit solcher Wucht, dass es fast aus den Angeln fiel.
Alles in allem kaum eine Minute, vielleicht weniger. Dennoch hatte der Ermittlungsbeamte Petralia sofort die Bügelbrille und den Spitzbart des mysteriösen Don Paolo wiedererkannt. Im Oktober vor zwei Jahren hatten er und sein Kollege Alparone ihn vom Haus des Falschgeldhändlers Chiarenza bis zur Hälfte der Via Etnea beschattet, wo der Mann, sich verfolgt fühlend, eine Kutsche genommen hatte, mit der er auf Nimmerwiedersehen inmitten der zweihunderttausend Einwohner der Stadt untergetaucht war.
Don Paolo war Chiarenzas Lieferant, daran gab es für die beiden Polizisten keinen Zweifel. Sie hatten, als Bettler verkleidet, beobachtet, wie er jeden Donnerstagnachmittag immer zur selben Stunde das Haus des Händlers betrat, wo sich bereits ein paar Leute eingefunden hatten. Nach einer Viertelstunde ging er wieder weg, und nach ihm alle anderen, einzeln, so wie sie gekommen waren. Den Namen jenes Mannes hatten sie von einem Vertrauensmann erfahren, der in derselben Straße lebte. Um das Kommen und Gehen der Leute zu rechtfertigen, hatte Chiarenzas Frau gegenüber den Nachbarn behauptet, dass Don Paolo ihnen jede Woche die Zahlen für das Lottospiel überbrachte.
Doch der Zahlenlieferant wurde nicht mehr bei diesem Haus gesehen, und zwei Monate Ermittlungen und Nachstellungen lösten sich in Rauch auf.
Und da, plötzlich hatte er ihn wiedergefunden, diesen Bastard.
Petralia vergaß, seine Gangart der Verkleidung anzupassen, und traf mit Riesenschritten und strahlendem Gesicht im Kommissariat ein.

Schlurfend, doch geschickt Gegenständen und Mobiliar ausweichend, bewegte sich der Mann voller Unruhe zwischen Bett und Fenster hin und her. Er öffnete das Fenster. Die Nacht tauchte die Lavafelder in ein noch tieferes Schwarz.
Zurück im Bett versuchte er, wieder in den Schlaf zu finden, aber vergebens. Vielleicht in dunkler Vorahnung dessen, was ein paar Stunden später mit ihm geschehen und ihn aus der Anonymität jener ruhigen Stadtrandlage auf die Titelseite der Zeitungen katapultieren sollte.
Auch die große Geschichte vollzog sich in jener Nacht. In Mailand arbeitete Mussolini — zusammen mit Balbo, Bianchi, De Bono und De Vecchi — Punkt für Punkt den Marsch auf Rom aus, infolge dessen wenige Wochen später seine Regierung gebildet wurde und zwanzig Jahre lang Regime blieb.
All das war in jenen Stunden vor dem Morgengrauen des 17. Oktobers 1922 noch bloße Virtualität von Ereignissen, die auch gar nicht hätten geschehen müssen, beispielsweise wenn der schlaflose Mann in jenem Haus inmitten der Lavafelder Papiere und Apparate zerstört hätte und nach Caltanisetta abgereist wäre, wie es einige Monate zuvor noch seine Absicht war, die er dann plötzlich aufgegeben hatte. Oder wenn am darauffolgenden 27. Oktober der König die Empfehlung des Ministerpräsidenten Luigi Facta aufgegriffen hätte, nämlich den Belagerungszustand auszurufen und mit militärischen Mitteln auf den Marsch der Faschisten auf Rom zu reagieren.
Auf der Grundlage des Wenn/Falls der jeweiligen Wahlmöglichkeiten sind die individuellen wie die kollektiven Ereignisse zu beurteilen: Was geschehen ist, hätte genauso gut auch nicht geschehen können.
Aber der König verwarf Factas Vorschlag. Und der Mann in dem Haus bei den Lavafeldern brach nicht nach Caltanisetta auf, sondern tappte in jener Nacht weiter schlaflos zwischen Bett und Fenster hin und her.