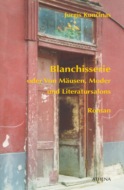Loe raamatut: «Die Grünen»
Marius Ivaškevičius
Die Grünen
Aus dem Litauischen von Markus Roduner
ATHENA
Literatur aus Litauen
Band 14

This publication is published in cooperation with »Books from Lithuania«
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation
in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten
sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.
Die litauische Originalausgabe erschien 2002 bei
Tyto Alba, Vilnius, unter dem Titel »Žali«
E-Book-Ausgabe 2014
Copyright © der Originalausgabe
by Marius Ivaškevičius and Tyto Alba
Copyright © der deutschen Print-Ausgabe
2012 by ATHENA-Verlag,
Mellinghofer Straße 126, 46047 Oberhausen
www.athena-verlag.de
Lektorat: Heiko Stullich
Satz und Layout: Anja Lapac
Umschlagabbildung: © Stefan Gräf – Fotolia.com
Alle Rechte vorbehalten
ISBN (Print) 978-3-89896-522-4
ISBN (ePUB) 978-3-89896-850-8
Einleitung
Egal, wo man anfängt, es ist und bleibt verworren. In der Natur existieren unzählige Farben und Farbtöne. Und es gibt keine einzige Farbe, um die noch nie Krieg geführt worden wäre. In diesem Krieg nun kämpften – ganz allgemein gesagt – die Menschen für Grün. Die Farbe unserer Wälder. Am heftigsten bekriegten sie Rot. Die Farbe des Blutes unserer Feinde. Obschon manchmal auch Gelb gegen Grün verteidigt wurde. Auch das kam vor.
Außerdem führten sie noch Krieg für ihre Überzeugung, dass sie die Freiheit verdient hätten, gegen die Überzeugung der anderen, dass dem nicht so sei. Doch das ist zu weit gefasst.
Das Ganze begab sich um die Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts. Auch als goldenes Zeitalter bezeichnet. Doch auch wenn die Oberfläche eines Dings schmuck glitzert, ist dessen Inneres nicht selten verrottet. Sie lebten tief im Inneren dieses »Dings«, des zwanzigsten Jahrhunderts, und wussten nichts von dessen Glanz.
Am Anfang war die Geografie weiträumig. Denselben Krieg führte eine große Anzahl Menschen von der Ukraine im Süden bis nach Estland im Norden. Doch schließlich waren sie allein.
Sie waren ganz einfach von der fixen Idee besessen, ihren eigenen Staat haben zu wollen. Sie hatten ihn zwanzig Jahre lang zwischen den beiden Weltkriegen gehabt, überdauerten den Zweiten Weltkrieg geduldig und waren an dessen Ende ganz erstaunt, dass man ihnen ihren Staat nicht zugestand.
Das war dasselbe, wie den Wellen beim Überfluten der Brücke zuzusehen. Man weiß doch, sie würde, wenn die Wellen sich zurückziehen, noch da sein.
Genau gesagt waren sie Litauer – ein Volk nördlich von Polen und südlich von Riga – und machten alles verkehrt. Sie ergaben sich, wenn sie kämpfen sollten. Und als die Zeit kam, um Frieden zu schließen, griffen sie zu den Waffen.
Der Charakter des Krieges ist vertikal. Normalerweise führen die Menschen so Krieg: Sie stellen ihre Einheiten unter ihrer Farbe auf und schicken sie gegen die andere Farbe, die anderen Einheiten. Doch das ist ein horizontaler Krieg. Wären diese Einheiten in einem Wolkenkratzer, sagen wir mal vom dreißigsten bis zum achtundfünfzigsten Stock aufgestellt, entdeckten die feindliche Fahne zwischen dem ersten und dem neunundzwanzigsten Stock und erhielten darauf den Befehl zum Angriff – das wäre ein Krieg, den man vertikal nennen könnte. Die Gefechte fänden im Treppenhaus statt.
Sie hatten keine Wolkenkratzer. Die Armeen waren dennoch auf zwei verschiedenen Stockwerken aufgestellt. Die feindliche Armee war auf der für Armeen üblichen Höhe stationiert, wo die Menschen ihre Felder bebauten, zu Verabredungen gingen, sich liebten, wenn gerade kein Bett frei war. Die Litauer hatten ihre Armee da aufgestellt, wo man sich niemals liebte, nicht spazieren ging, und begab man sich dahin, dann nur ein einziges Mal und für alle Ewigkeit – wenn der Sarg unten aufgeschlagen hatte.
»Vertikaler Krieg« ist ein selten verwendeter Begriff. Viel häufiger wird dazu Partisanenkrieg gesagt. Doch dieser Begriff ist zu weit gefasst.
Im Sinne der Evolution des Krieges war er ein Rückschritt. Das von den besten Strategen und den neuesten Waffen verwöhnte Europa hätte wohl kaum gedacht, dass an seinen Rändern ein veralteter Krieg ausbrechen könnte, in dem man auf die neuesten Erfindungen pfiff. Die liegengebliebenen leichten Waffen sämtlicher durchmarschierter Armeen wurden sorgfältig eingesammelt. Darauf wurde mit ihnen noch ein gutes Jahrzehnt erbittert Krieg geführt. Den Krieg leitete ein Mann, der in Europa Artilleriewissenschaften studiert hatte. Er soll über keine einzige Kanone verfügt haben. Von ihm handelt dieses Buch.
Was erhofften sich jene Leute? Anfangs hegten sie vielleicht noch die Hoffnung, selbst etwas gewinnen zu können. Dann hofften sie, unter der Erde ausharren zu können, bis ein anderer käme und ihnen helfen würde, den Krieg zu gewinnen. Die größten Hoffnungen ruhten natürlich auf Amerika. Schließlich machten sie sich wohl kaum mehr Hoffnungen, es gab einfach kein Wohin mehr.
Keiner dieser Menschen würde der Auffassung zustimmen, der zweite Weltkrieg habe mit einem Sieg geendet. Bestenfalls wurde irgendwo in der Ferne ein Unentschieden erreicht, hier jedoch, wo sie ihre Bunker aushoben, gab es nicht einmal dieses Unentschieden.
Zu so einem Krieg könnte man auch Bürgerkrieg sagen. Kein Staat führte mit einem anderen Staat Krieg, ein großer Staat führte Krieg mit sich selbst. Und es war allein seine ganz persönliche Angelegenheit, welches Medikament er anwenden wollte, um den Bandwurm loszuwerden.
Es war der Schmerz des großen Fisches nach dem Verschlingen des kleineren Fisches, den er jetzt bei lebendigem Leib verdaute. Beziehungsweise der Schmerz des kleinen, während er mit den Magensäften kämpfte.
Am einfachsten wäre die Aussage, dass die Litauer mit den Russen Krieg führten. Aber die Russen waren nicht reinrassig, es waren auch Litauer unter ihnen. Auch in den Reihen der Litauer gab es den einen oder anderen Russen, den einen oder anderen Deutschen und noch den einen oder anderen. Die Welt war durchtränkt mit Verrat und Verbrechen, deshalb wurde für viele Bürger der Krieg zur einzig möglichen Lebensweise. Und es war ihnen egal, wofür und mit wem sie Krieg führten.
Doch allgemein gesagt führten die Litauer Krieg mit den Russen. So war es schon im dreizehnten Jahrhundert, im vierzehnten, im fünfzehnten, hin und wieder auch im sechzehnten und später gewesen. Dies war die vorläufig letzte ernsthafte Schlacht.
Zehn Jahre – das war sogar für einen Krieg eine ernsthafte Herausforderung. Obwohl es in der Geschichte auch dreißigjährige und noch angegrautere Kriege gab. Anfangs war es ein ziemlich intellektueller, wenn auch vertikaler Krieg. Geleitet von gebildeten Offiziere, Studierten, Dichtern, Ärzten, all denen, die nicht in den Westen geflüchtet waren – in der Hoffnung, dass der Westen selbst einmal hierher kommen würde. Darüber wurden Gedichte verfasst. Allmählich brachte der Krieg die Dichter, Ärzte und gebildeten Offiziere um und die neuen Intellektuellen waren zu gebildet, als dass sie ihr Leben für eine Farbe geopfert hätten. Und der Krieg wurde allmählich immer gemeiner. Es zogen Burschen vom Land in den Kampf, die nur wenig von Ehre und Menschlichkeit verstanden. Nach und nach übernahmen sie Methoden und Strategien ihrer Feinde. Der Krieg wurde auf beiden Seiten grausam.
Jemand lag mit von Granatsplittern aufgerissenem Bauch da und brüllte fürchterlich. Andere führten ein hungriges Schwein herbei. Und jenes beschnüffelte, da es von Krieg und Menschlichkeit nichts verstand, den aufgerissenen Bauch und fraß alle Innereien auf.
Das ist nur ein winziges Detail dieses Krieges, zugegeben, eines, das den Verstand eines Menschen erschüttert, der sein Leben an der Oberfläche des goldenen Zeitalters zugebracht hat.
Wer immer man war in diesem Krieg, einfacher Kolchosarbeiter oder Leiter einer ganzen Kolchose, loyal gegenüber einer der Kriegsparteien oder auch nicht – der Krieg würde einen finden. Denn alle, die nur friedlich den Boden bearbeiten, sich keinen Deut um Überzeugungen scheren wollten, bewohnten in Wirklichkeit die Treppenhäuser dieses Hochhauskrieges. Und manchmal fanden da Kämpfe statt.
Nur die Städte standen da wie unerschütterliche Festungen. Der Krieg drang nicht bis dorthin, denn in den Straßen löste der Belag die Vertikalität auf.
Städte gab es jedoch nur wenige.
Auf litauischer Seite kämpften ungefähr zwanzigtausend. Bald so viele, bald weniger. Nicht ein einziges Mal aber hatten sie sich an einem Ort versammelt, nicht ein einziges Mal getroffen, sie hausten unter Öfen, unter Altären in Kirchen, sogar auf Friedhöfen gab es Bunker.
Und doch war dies ein Krieg, wie seltsam auch immer er aussehen mochte. Der größte Krieg der Litauer im goldenen Zeitalter.
Und die Menschen, die in diesen Krieg zogen, waren einst Auto gefahren, hatten Belgien und die Schweiz gesehen, Geld auf der Bank gespart und viele Dinge getan, die man ihnen keinesfalls zutraute, wenn man sie so unter der Erde sah.
Von der Oberfläche des goldenen Zeitalters aus gesehen war es ein interessanter Krieg, obwohl er keine entscheidenden Auswirkungen hatte – wie auch die anderen Kriege.
Es war eine interessante Zeit, soviel ist dazu zu sagen. Und dieses Buch handelt gar nicht vom Krieg und den Litauern, es handelt vom goldenen Zeitalter in den Augen eines Menschen, der des Öfteren durch sein Zielfernrohr einen Blick darauf werfen durfte.
Jonas Žemaitis – so heißt dieser Mensch. Obwohl alles, was hier geschrieben steht, erstunken und erlogen ist.
Und noch etwas. Die Perspektive ist völlig verkehrt.
Ein ganz gewöhnlicher Mensch, nicht schuld daran, als Russe zur Welt gekommen zu sein, obwohl das mehr als nur die Zugehörigkeit zu einem Volk bedeutete, hatte vier Jahre lang als Kanonen- und Panzerfutter gedient. Und da ist er nun, dieser Russe, dieses Futter und will wieder Mensch sein! Er hat den größten Krieg der Welt gewonnen, er geht durch seine Stadt, er hat diese Stadt verteidigt. Und plötzlich kommt ihm zu Ohren, dass es irgendwo am Rande seines Landes Ausgeburten geben soll, die noch Lust auf Krieg haben.
Anstelle dieses Russen, aber nur wenn ich wirklich Russe wäre, würde ich meinen Rucksack packen und zu diesen Ausgeburten fahren, um sie fertigzumachen. Der Russe tut genau dies. Doch er findet einen ganz anderen Krieg vor. Einen trägen, langsamen, seine Geduld auf die Probe stellenden – so ist nun mal der Charakter der Litauer.
Und plötzlich verspürt dieser unschuldige Russe, das ehemalige Kanonenfutter, eine enorme Müdigkeit. Doch dieselbe quälende Müdigkeit spüren auch die Ausgeburten, die den Russen herausgefordert haben. Und das gemahnt sehr an einen Boxkampf zweier Schwarzer in der zwanzigsten Runde. Die Schwierigkeit ist nicht das Zuschlagen, sondern das Aufstehen von seinem Platz in der Ringecke.
Auch davon handelt dieses Buch. Von der außergewöhnlichen Müdigkeit. Vom letzten und entscheidenden Sprung aus der eigenen Ringecke.
Anstelle dieses Russen würde ich nirgendwohin fahren, anstelle jenes Litauers das goldene Zeitalter durch ein schmutziges Milchglas betrachten. Aber so spreche ich nur, weil ich ruhig und sicher außerhalb des goldenen Zeitalters stehe.
Krieg, Litauen, 1950. Was gibt es da noch mehr zu sagen. Das Leben ist vertikal. Die Gefühle – horizontal.
1
Stellt euch einen Wald vor, scheinbar menschenleer. Oder eine Kuckucksuhr. Wie der Kuckuck plötzlich seinen Kopf herausstreckt. Und jetzt eine Uhr – ohne Kuckuck. Und euer friedliches Leben, begleitet vom Ticken dieser Uhr. Und euer Staunen, wenn in diesem durch und durch bekannten Mechanismus plötzlich ein Kuckuck auftaucht.
Auch wir dachten manchmal im Scherz, das müsse einem Unbeteiligten wie die Hölle vorkommen. Er hatte natürlich von einer seiner Großmütter davon gehört, wie sich die Hölle auftut, und hatte jetzt, im August 1950, selbst die Gelegenheit, sich davon überzeugen. Juozas Kasperavičius kroch absichtlich immer als erster aus dem Bunker, stieß den Deckel auf und steckte seinen Kopf so rasch durch die Öffnung, als ob das alles wirklich von dem Unbeteiligten beobachtet würde, dem seine Großmutter erzählt hatte, wie sich die Hölle auftut.
Was suchen wir da?
»Still wie nach der Sintflut«. Das ist Bartkus. »Juozas hat allen einen Schreck eingejagt.«
Wir leben.
»Und heiß, man könnte direkt die Pickel trocknen.«
Nach oben kriechen wir jeweils, um zu überprüfen, ob dem auch wirklich so ist.
»Ich werde dem gehören, der mich herauszieht«, sagt Molkerei. »Ich werde auch die Pickligen nicht verachten.«
Die Hand gibt ihr Bartkus, denn Kasperavičius sucht noch immer nach demjenigen, dem die Großmutter erzählt hat, wie sich die Hölle auftut. Doch Molkerei wird nie Bartkus oder Kasperavičius gehören, sie gefällt sich darin, allen zu gehören. »Molkerei« heißt sie wegen ihrer Brüste. Die sind riesengroß. Und werden nur selten nicht zweckentsprechend gebraucht. Wie viele Kinder sie hat? – ich weiß es nicht. Von wem und wann sie schwanger wird – ebenfalls für alle ein Rätsel. Niemand weiß, was sie vor dem Krieg so machte, wahrscheinlich gebar sie Kinder. Dasselbe im Krieg. In der übrigen Zeit ist sie als Verbindungsfrau tätig. Soll mich Gottes Zorn dafür treffen, dass ich eine missratene Mutter lobe, aber als Verbindungsfrau ist sie gar nicht von Pappe.
Mozūra ist ein stiller Berg. Er kriecht schnell heraus. Und hartnäckig, geduldig. Allein sein riesiger Wuchs könnte ihn daran hindern, in den Schulbüchern der Zukunft als Beispiel für einen Landwirt aus der Zwischenkriegszeit herzuhalten. Im vorigen Krieg brachte er mit bloßen Händen drei Deutsche zur Strecke. Als sie seine Kuh holen kamen. Er begrub sie in zwei Meter Tiefe und pflanzte das Tier darauf. Seit jenem denkwürdigen Ereignis gräbt er besser als alle anderen Bunker.
»Und wer gibt mir die Hand« … Das ist Palubeckaitė.
Sie streckt die Hand durch die Öffnung, in der vergeblichen Hoffnung, unter diesen Soldaten einen Mann mit höfischen Manieren zu finden.
»Steig hoch«, treibt sie ihr waschechter Bruder an. »Vorwärts, es warten Leute.«
»Leute«, das sind er, Palubeckas, dann noch ich – Jonas Žemaitis. Teilweise auch Zigmas, ein Schuster, der keine Beine mehr hat. Nur dass Zigmas nicht wartet, er bleibt.
»Wenn du Schritte hörst«, warne ich. »Bschsch«, imitiere ich Schweigen mit dem Finger an den Lippen.
»Bschsch«, wiederholt Zigmas.
Fraglich, ob er etwas begriffen hat.
»Wenn du nicht bschsch sagst, dann macht’s bumm.«
»Bumm«, lacht er zufrieden.
»Für sie auf dich – ein einziges puh. Bschsch, damit es nicht bumm macht. Wiederhole.«
»Bschsch, damit es nicht bumm macht. Puh puh puh«, wiederholt er. »Rums«, sagt er noch zu sich selbst, während ich den Deckel scheppernd zuschlage und ihn von den anderen trenne.
Ach so, ich habe euch nicht gewarnt, ich bin der Anführer.
Doch Zigmas bleibt kaum genug Zeit, sich das Gesagte zu merken, denn die Schritte nähern sich, noch bevor sie sich entfernt haben. Da sind wir wieder. Wir kriechen zurück wie die Mäuse.
»Wir warten ein Weilchen«, antworte ich auf den erstaunten Mäuseblick des Schusters. »Wir setzen uns noch ein wenig, bevor wir uns auf den Weg machen«.
Ich fühle mich, als ob ich eine halbe Stunde mit meiner Liebsten herausgeschunden hätte. Denn draußen vor dem Fenster regnet es in Strömen. Doch vor dem Fenster sticht die Sonne, und ich rechtfertige mich vor dem Schuster:
»Genau genommen, Zigmas, haben wir dich im Gestank zurückgelassen.«
Fraglich, ob er etwas begreift.
»Genau genommen stimmt das«, antworte ich an seiner Stelle.
Und zeige auf den Eimer in der Ecke. Seit zwei Tagen steht er da ohne geleert zu werden. Und darin unser aller Gestank, Frauen- und Männerjauche, deren wir uns schon lang nicht mehr schämen.
Wir sind draußen gewesen, deshalb beißt uns der Gestank in den Augen, genau genommen wird uns sogar übel davon, nur Zigmas beißt er nicht in den Augen und ihm wird davon nicht übel, denn er ist eins geworden mit ihm, wie ein Hund, der die Pantoffeln seines Herrchens unter sich vergräbt wenn niemand zu Hause ist.
»Tut gut, so dazusitzen, nicht wahr?«, versuche ich dies auch den anderen schmackhaft zu machen, doch ich bekomme keine Antwort.
Wenn der Kuckuck aus der Uhr kommt, in der gar nie einer war, dann kommt mit ihm die Beklommenheit. Denn rundherum wimmelt es von Menschen, die wissen, wie sie sich zu verhalten haben, wenn sich die Hölle auftut. Gegen die führen wir Krieg.
Ich schickte alle zurück, als ich diese seltsame Beklommenheit fühlte. Besser tausend Mal wegen der eigenen schamlosen Beklommenheit fehl gehen, als einmal eine solche Vorahnung zu ignorieren und in Gefahr geraten.
Sie denken da anders.
Aber ich habe Sie ja schon gewarnt, ich bin der Anführer.
»Aufgestanden!« Ich springe auf. »Palubeckas, bring diesen Gestank raus!« Ich zeige zum Eimer. »Wenn du siehst, dass sie dich umzingeln, dann leer ihn aus. Den Gestank werden sie nicht ›durchbrechen‹«.
Wir kriechen erneut hinaus, diesmal in anderer Reihenfolge. Zuvorderst Palubeckas, unser »Fahnenträger«.
»Wie verabredet, Zigmas,« ermahne ich ihn. »Wenn Schritte, du bschsch – und kein bumm.«
Palubeckas entfernte sich weit genug von uns und verteilte unsere Exkremente in kleinen Häufchen im Wald. Damit niemand auch nur den leisesten Verdacht hegte, dass dieses Vermögen von acht Höllenbewohnern angehäuft worden war.
»Und kein bumm«, pflichtet mir Zigmas bei und fordert mich auf, mich zu bücken.
Ich muss sowieso da runter. Palubeckas hat mir den Eimer gebracht und ich werde ihn an seinen Platz zurückstellen.
»Nur schnell, Zigmas, sag schon.«
Aber Zigmas drückt statt es zu sagen die Augen zu und hebt eine Backe seines armen Hinterns, mit dem sein Körper endet. Dann ist ein Furz zu hören.
Ich steige schnell die Leiter hinauf.
»Kein bumm«, wiederholt er zufrieden. »Sei nicht böse, Chef, wir haben gescherzt.«
»Idiot«, sage ich zu mir selbst und schlage den Deckel scheppernd zu.
Heute ist Sonntag, der einundzwanzigste August.
Ich gehe mit Bartkus an der Spitze. Er reicht mir bis zur Schulter. Er putzt seine Brille und setzt sie auf. Er erinnert an einen fleißigen Wissenschaftler. Einmal, als wir ihn in anständigen Kleidern nach Klaipėda schickten, da klatschte sogar Molkerei in die Hände und strich ihm sanft über die Kleider. »Bartkus, mein Kind«, sagte sie, »zu einem wie dir würde ich auf Knien angekrochen kommen. Ich pfeif auf den Krieg, hörst du?«
Doch man muss Molkerei kennen.
»Ich und Bartkus sind die Ziellinie«, rufe ich den anderen, den Zurückgebliebenen zu, obwohl ich sie erst vor einer Viertelstunde zurück in den Bunker getrieben habe. »Irgendwas passt mir hier nicht«, sagte ich zu ihnen. »Wir sind die Ziellinie, verlieren will niemand. Ihr wisst ja, was den Betreffenden am Montag erwartet, wenn heute wirklich Sonntag ist. Wäschewaschen und Kaffee – jedem einzeln ans Bett. Und der Eimer.«
»Der Eimer ist leer.«
»Den kriegen wir schon voll.«
Das ist unser Morgentraining.
Die beiden Palubeckas sind in Führung. Palubeckas, etwas über dreißig, schwarzes Haar, dichte Augenbrauen und kreideweißes Gesicht, als ob er an einer unheilbaren Krankheit litte, daneben mit einem ebensolchen Gesicht Palubeckaitė, nur ohne Anzeichen von Krankheit, zehn Jahre jünger als ihr Bruder. Es folgt Mozūra. Ein großer Blonder, mit vorstehenden Backenknochen, läuft so, als ob er einen Ball dribbeln würde. Dreht sich um und verlangsamt den Schritt. Er wird nicht verlieren.
Molkerei rutscht aus und kann gerade noch Kasperavičius zu Fall zu bringen. Sie steht auf und läuft in unsere Richtung los, ihre großen Brüste stampfen wie Zylinderkolben unter der Armeejacke, das Hemd ist schamlos aufgeknöpft. Sie ruft:
»Molkerei hat noch nicht verloren.«
Das ist unser Krieg. Die versammelten großen Kriege würden ihn an den Schandpfahl stellen. Und dann würden ihn noch die versammelten Leben anspucken.
»Ich hätte nicht verlieren sollen«, sagt Kasperavičius.
Er hält an der Ziellinie nicht an, geht an uns vorbei. Gleich wird er uns ein Fuhrwerk organisieren. Wir setzen uns und warten unter den letzten Baumreihen. Vor uns – nur großes weites Feld.
»Hört mal, und wo ist die Seife?«, fasst sich Bartkus. »Haben wir die Seife vergessen?«
»Die Seife ist dort«, sagt Molkerei.
»Wo dort?«
»Im Loch, bei mir, eingenäht. Wo dort? … Unter den Bäumen ist die Seife. Beim Stauwehr.«
»Gut«. Er beruhigt sich wieder. Er zieht eine Zigarette aus der Tasche und raucht. »Gut, dass sie unter den Bäumen ist, nicht wahr?« Er dreht sich zu mir um.
»Hervorragend!«, erwidere ich.
Wir warten und schweigen. Was sollten wir auch sonst tun. Wir sitzen da, als ob sich vor uns eine große Pfütze befände. Oder ein Sumpf. Kein Feld. Ja, etwas wie ein Meer. Und schauen dem sich entfernenden Kasperavičius nach. Wird er nicht einsinken?
So pflegte der Graf dazusitzen. Im Frühling zwölf bis fünfzehn, im Sommer und manchmal im Herbst, wenn der Wind nicht zu stark blies. Vor 1912 war er durch die Welt gezogen, ab 1915 war er krank. Und im Frühling zwölf bis fünfzehn, im Sommer, im Herbst und manchmal auch im Winter liebte er es so dazusitzen. Manchmal kam er allein her, manchmal mit seiner Frau, doch stets brachte er einen Schaukelstuhl mit. Und rauchte gute Zigarren. Niemand anderer in unserer Umgebung rauchte solche Zigarren. Der Stuhl schaukelte im Sand bis er stecken blieb. Dann blickte der Graf starr vor sich hin. Doch vor ihm befand sich das Meer, vor uns – im besten Fall ein Feld.
Kasperavičius hat es offenbar mehr als einmal erfolgreich ohne Einsinken durchquert.
Möchte ich ein Graf sein, so komme ich hierher und setze mich hin. Nur ging er zwölf bis fünfzehn ganz allein zu allen Jahreszeiten hin, um sich als »Randmensch« zu fühlen. »Randmensch« im Staat – den er vor dem Meer schützte. Mein Wunsch ist es, ein ganz Gewöhnlicher zu sein. Ich komme hierher, zu diesem Feld, um mich mit eigenen Augen davon zu überzeugen, dass das Land mich schützt.
Dann brüstete sich Graf noch gern mit seinem neuen Landungssteg. Ein langer Landungssteg, der sich ins Meer gebohrt hatte. Wie ein adliger Finger, der der nichtadligen Natur zeigte, wer hier wem untertan ist. Ich habe keinen Landungssteg. Und nichts könnte bezeugen, dass manchmal Leute aus dem Wald zu diesem Feld kommen. Darauf achte ich genau.
Dann organisierte der Graf, um das Meer zu übertönen, auch noch gerne Konzerte. Eine gewaltige Symphonie plärrte dann so laut, dass das Wasser verstummen musste. Manchmal konzertieren auch wir. Wir plärren scheußlich verstimmt irgendein Lied daher. Dies passiert aber nur, wenn es stürmt, donnert, Bäume ausreißt, mit einem Wort, die Natur darf ihr Herumtollen nicht unterbrechen. Dann kann man in seiner Höhle nach Lust und Laune blöken und brüllen.
Der Graf ist der, der am Anfang von alledem stand. Der Mensch, der seine Bürger nicht vor dem Meer schützte. Die Natur hat sich über uns erhoben.
Es geschah an einem Sommernachmittag 1915, einem ganz normalen Geburtstag des Grafen. Als das Orchester ankündigte, zu wessen Ehren Mozart gespielt werde. Einen Fuß weit vom Meer sitzend blätterte er in seinen Partituren und verkündete: »Mozart – für den Grafen«. Und vom Meer – kein Wort.
Damals hockte ich in den Dünen, überflog mit den Augen das Meer, wog die Kräfte des Grafen ab und kam mit meinem kindlichen Verstand zu dem Schluss: das Meer wird die Ouvertüre über sich ergehen lassen, dem Grafen aber droht das Finale.
Ich war sechs. Ich beobachtete das Meer, das Orchester, die Familie des Grafen, den Baumstamm und Kasperavičius. Und Elena – ein Mädchen im Badekleid, unter dem es noch nichts zu verbergen gab. Darunter war genauso nichts wie in der Ankündigung, das Orchester spiele jetzt Mozart für den Grafen. Außer etwas vielleicht, was das Meer verärgern sollte.
Sie zog hier Kreise im Sand. Nur das konnte sie wirklich. Mit dem großen Zeh einmal um sich selbst – das war ihre Erfindung. Ein Bein bewegt sich nicht, das andere – wie ein Zirkel. Sie – Elena.
Und all das hat der Graf nicht für die Zukunft bewahrt, indem er einen einzigen Fehler beging, zu sehr an sich glaubte.
Deshalb komme ich jetzt hierher und sitze am Rand dieses Feldes – um jenen Fehler zu vermeiden.
Juozas Kasperavičius, der jetzt mit dem Fuhrwerk zurückkehrt, war damals nur ein namenloser Rotzbengel mit unbedecktem Vorder- und Hinterteil. Er stieg gern auf vom Meer angeschwemmte Baumstämme. Breitete die Arme aus wie ein Meerhuhn und bohrte sich kopfüber in eine Pfütze, die ein Sturm hier zurückgelassen hatte. Stand wieder auf, stieg auf den Baumstamm, die Arme wieder weit von sich gestreckt und noch einmal kopfüber auf Grund. Ein Meerhuhn – das war Kasperavičius. Als ob er die Pfütze durchstoßen und dann umgehend hier auftauchen könnte – am einundzwanzigsten August 1950 am Rand eines Feldes, durch das zu waten um nichts einfacher war als übers Wasser.
Ein nackter Rotzbengel mit unbedecktem Vorderteil … Doch schon ist er hier und wir stehen auf und wollen einsteigen.
»Was gibt’s Neues?«
»Schüsse«, antwortet Kasperavičius mit dem ernsthaftesten Gesichtsausdruck der Welt. »Und koreanische Flüche. Stellt euch vor, was für eine Stille. Man kann dem Krieg in Korea zuhören.«
»Worüber fluchen sie?«, fragt Molkerei, während sie auf den Wagen klettert.
»Kein Wort über dich.«
»Über Molkerei nur Gutes oder überhaupt nichts.« Sie macht es sich in der Mitte des Wagens bequem, ihr Gesicht wendet sie Kasperavičius zu.
»Deshalb erzählen sie ja auch nichts … Hast du denn auch nur einem einzigen Schlitzauge zu spüren gegeben, wie gut Molkerei ist?«
»Den Koreanern werde ich das niemals erlauben.« Sie knöpft ihr Hemd zu, als ob die, die in Korea Krieg führen, sie von dort aus sehen könnten. »Man sagt, die seien für nichts zu gebrauchen.«
»Wer sagt das?« Kasperavičius lässt die Peitsche knallen. »Nach Korea?«, dreht er sich zu mir um.
Bartkus und Mozūra nehmen auf der linken, die beiden Palubeckas auf der rechten Seite Platz. Ich setze mich hinten in den Wagen.
»Nach Korea«, gebe ich Kasperavičius zur Antwort, »falls es dort ein Stauwehr und ein Stück unter den Bäumen versteckte Seife gibt.«
»Dort ist wirklich Krieg«. Er lässt die Peitsche noch ein paarmal knallen und das Pferd trabt los. »Nach Korea«, wiederholt Juozas.
»Ja«, sage ich, »nach Korea.«
Wir sind unterwegs zum Baden im Fluss.
An eines der Wagenräder hat aus irgendeinem Grund jemand einen Motorradreifen angenagelt.
»Schönling«, sagt Molkerei voller Bewunderung, den Blick auf irgendetwas weiter vorne gerichtet.
»Das Pferd?«, frage ich nach.
»Ja, das.«
»Ungezähmt«, erwidere ich ihr.
»Ungezähmt«, wiederholt sie geheimnisvoll.
Sie sagt noch etwas, doch ich höre ihr nicht zu.
»Ich habe nicht zugehört«, sage ich.
»Den Pimmel, oder den Feind«, wiederholt sie.
»Schrei doch nicht so«, bittet sie Bartkus, denn Molkerei brüllt und wir fahren über das Feld, das Kasperavičius überquert hat, während wir ihm beobachteten, ob er nicht einsinken würde.
Doch das treibt Molkerei nur noch mehr an.
»Pim-mel«, skandiert sie im Stehen.
»Sie ist ein hartes Weibsstück«, sagt Kasperavičius.
Als ob er sagte: »Sie wird für uns alle kämpfen, wenn wir wegen ihr in die Klemme geraten.«
»Sollen die harten Weiber sich doch nach dem Krieg versammeln und aus vollem Halse grölen«, entgegnet Bartkus.
Und das ermutigt Molkerei zum Mottowechsel.
»Fe-eind«, skandiert sie jetzt und was könnten wir gegen sie unternehmen? »Einen Feind mit so einem Pimmel«, sagt sie und zeigt mit dem Finger auf das Pferd.
Wir sind machtlos.
Dann fällt sie auf den mit Heu bedeckten Wagenboden.
»Und Sie?«, fragt sie mich und schaut mir dabei direkt in die Augen.
»Ich?«, erwarte ich ihre Frage.
»Werden Sie sich am Fluss vor mir ausziehen?«
Ihr Kopf liegt im Schatten meines Ellbogens. Da sind immer welche, die sich von ihrem unreinen Mund beleidigt fühlen. Doch dann gibt es auch immer welche, die ihren perfekten Körper verteidigen. Sie ist ein Kuckucksweibchen, das seine Kinder aus dem Nest geworfen hat, bellt wie das allerletzte Schandmaul von Hund und »trägt« Kuhzitzen mit sich herum. Doch mancher Mann begehrt sie mehr als die anderen Frauen, ihre Brüste – groß und stramm – entfachen die Leidenschaft, so wie die Freiheit, über die man spricht, die man aber nicht berühren darf. Ihre Worte sind roh und unrein – und ansteckend.
Und jetzt fragte sie mich, ob ich mich heute ausziehen würde. Als ob wir nicht jeden Tag vor den Augen der anderen auf demselben Eimer hocken würden.
»Du wärst enttäuscht«, antworte ich ihr, während ich bald sie, bald das Ding da vorne anblicke, das sie »Schönling« nennt.
»Nein«, antwortet sie schelmisch. »Und wissen Sie warum?«
»Nein.«
»Weil ich schon so viele gesehen habe und nicht ein einziges Mal war ich enttäuscht.«
In Fontainebleau 1938 kannte ich eine andere Molkerei, Natalia, meine Friseurin.
»Sie kommen schon seit einem Jahr zu mir zum Haareschneiden, Žemaitis«, pflegte sie zu sagen. »Hat das etwas zu bedeuten?«
»Noch immer nicht.«
Dasselbe sagte sie zu unserem Dozenten für Artilleriegeschichte. Der Zufall wollte es, dass ich oft gleich nach ihm an der Reihe war.
»Monsieur Juvaly, seit drei Jahren bringe ich Ihr Haupt in Ordnung, ich und keine andere. Für Sie sind drei Jahre ein Pappenstiel, doch ich bin erst 21. Ein Siebtel meines Lebens, Monsieur Juvaly.«
Sie war Molkerei, nur naiv und jünger. Und subtiler, denn sie lebte in Frankreich und erinnerte sich nicht an den Krieg.
»Jahr um Jahr wühle ich in ihren Scheiteln herum, klappe die Ohren um, um sie nicht mit der Schere zu treffen, bade in ihren Haaren, und das alles bedeutet noch immer nichts.«