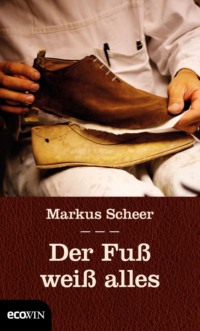Loe raamatut: «Der Fuß weiß alles»
Aufgezeichnet von Wojciech Czaja

Sämtliche Angaben in diesem Werk erfolgen trotz sorgfältiger Bearbeitung ohne Gewähr. Eine Haftung der Autoren bzw. Herausgeber und des Verlages ist ausgeschlossen.
© 2016 Benevento Publishing,
eine Marke der Red Bull Media House GmbH,
Wals bei Salzburg
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags, der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen sowie der Übersetzung, auch einzelner Teile. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Medieninhaber, Verleger und Herausgeber:
Red Bull Media House GmbH
Oberst-Lepperdinger-Straße 11–15
5071 Wals bei Salzburg, Österreich
Satz: MEDIA DESIGN: RIZNER.AT
E-Book-Konvertierung: Satzweiss.com Print Web Software GmbH
Fotos Bildteil 1, 2, 4, 6-13: © Peter Rigaud Shotview
Bildteil 3: © k. u .k. Hofatelier Pietzner
Bildteil 5: © KURIER/Martin Gnedt
ISBN 978-3-7110-5180-6
„Ein guter Beobachter sieht am Zustand
der Schuhe, mit wem er es zu tun hat.“
Honoré de Balzac
1.
Woher kommt der Schuh?
Und warum verhüllen wir eigentlich unsere Füße?
Eine Geschichte auf leisen Sohlen
Den Urschuh gibt es nicht. Denn entgegen dem weitläufigen Glauben wurde der Schuh nicht erfunden, sondern ist das Resultat einer sehr langsamen, Tausende Jahre langen Entstehungsgeschichte. Zu Beginn wurde der Fuß, um ihn vor Hitze, Kälte, Eis, vor heißem Sand und vor schroffem Gestein zu schützen, in Blätter gehüllt. Diese Methode war freilich nicht sehr effizient. Sobald also der Mensch sesshaft geworden war und begonnen hatte Tiere zu jagen, wurden die Blätter durch Tierfelle ersetzt. In der Regel wurden die Felle um Füße und Waden gehüllt. Ich nehme an, dass die ersten Schuhe nicht besonders schön waren.
Wann das Zuschneiden und Verschnüren von Schuhen und Lederbekleidung begonnen hat, ist schwer zu sagen. Dazu gibt es keine zuverlässigen Quellen. Die einzige verlässliche Auskunft liefern uns die Werkzeuge, die in unterschiedlichen Teilen Europas gefunden wurden. Die älteste Ahle eines Schuhmachers, die zum Vernähen der Lederteile nötig ist, stammt aus der Neandertalerzeit und ist rund 120.000 Jahre alt. Ich finde diese Zahl sehr beeindruckend. Im Vergleich dazu kommt mir die 200-jährige Geschichte meiner Schuhmacherfamilie wie ein kurzer Wimpernschlag der Welt vor.
Was mich an dieser Entstehungsge-schichte besonders fasziniert: Seit der Steinzeit schon verwenden wir für unsere Schuhe das Material Leder. Während sich Form, Funktion und Produktion des Schuhs in all den Jahrtausenden verändert und weiterentwickelt haben, ist das Material stets gleich geblieben. Das Töten von Tieren, das Verwenden der Tierhäute, das Umwickeln unseres eigenen Körpers damit ist ein Urinstinkt. Und so sehr wir uns heute, in Zeiten von Vegetarismus und veganem Leder, dagegen sträuben, so schwer ist es, diesen Trieb, diese Sehnsucht, diese archaische Lederlust in uns allen zu leugnen. Sie ist Teil der Menschheit.
Schon damals wurden die Tierhäute durch Gerben haltbar gemacht. Während die Männer auf der Jagd waren, haben die Frauen die Häute stundenlang gekaut. Danach wurden sie mit Urin, Salzen und Ölen behandelt. Zum Schluss musste das tierische Material in der Sonne getrocknet werden. Damit war das Leder haltbar. Wir Menschen sind also von Natur aus Gerber. Ziemlich gute sogar, wie ich meine. Am Fuß wurde das gegerbte Leder dann festgezurrt – je nach Witterungsverhältnissen und Bedarf mal mit dem Fell nach innen, mal nach außen. Dieses Festzurren zu einem Fußsack lieferte übrigens die Designgrundlage für jenen Schuh, den wir heute als Mokassin bezeichnen.
Mit der Entwicklung der Häuslichkeit wurde der Schuh, der ursprünglich einzig und allein dem Schutz diente, mehr und mehr zum ästhetischen, bewusst gestalteten Objekt. Es gibt Schuhe aus der römischen und griechischen Antike, die einen schwer beeindrucken! Manche Designer lassen sich auch heute noch von der Machart dieser meist recht luftigen Sandalen beeinflussen und interpretieren das historische Vorbild auf eine zeitgenössische Weise. Manche Modehäuser beherrschen dieses Spiel in Perfektion. Allein schon die Behandlung der Oberfläche, der Nähte und der Stöße erscheint wie ein Anachronismus, der uns beweist, wie sehr wir die Geschichte unentwegt unterschätzen. Auch die Stiefelette mit ihren seitlich angebrachten, elastischen Gummizügen – der sogenannte Chelsea-Boot – ist viel älter als wir glauben. Das Design reicht ins auslaufende Barock, also rund 200 bis 300 Jahre zurück.
Das ist auch jene Zeit, in der mein Interesse, in der meine ganz persönliche Leidenschaft für Schuhe einsetzt. Bis Mitte des 18. Jahrhunderts, muss man wissen, waren der linke und der rechte Schuh redundant, also absolut identisch geformt. Erst ab dem 18. Jahrhundert hat man begonnen, linke und rechte Schuhe zu unterscheiden und spiegelgleich auszuführen. Und damit beginnt eine ganz neue Ära der Schuhkultur, die sich mehr und mehr an der Geometrie des Fußes orientiert und sich den Gegebenheiten im Alltag, auf der Straße und bei Hofe anpasst.
Nicht zuletzt wird der Schuh auch zum Statussymbol. Ich bin jedes Mal beeindruckt, wenn ich mir ein Gemälde oder ein Reiterstandbild von Prinz Eugen anschaue. Die Reitstiefel verleihen dem Prinzen eine gewisse Mächtigkeit. Damit scheint er mit dem Pferd verankert und absolut unrunterschmeißbar. Und das ist kein Zufall. Denn die Reitstiefel wurden damals so gestaltet, dass sie ihre volle Wirkung entfalten, wenn sie sich dem Betrachter im Profil zeigen. Auf allen Bildern, die in die Geschichte eingegangen sind, sieht man den Reitstiefel immer nur von der Seite. Das ist ein Formen- und Proportionsspiel, das bis zur Perfektion getrieben wurde.
Im Gegensatz dazu wurde der Halbschuh so geformt, dass er seine wahre Schönheit beim Anblick von vorne entfaltet. Auf historischen Gemälden sieht man immer wieder Könige und Kaiser mit Halbschuhen, die eine auffällig große Schnalle und einen ziemlich hohen Absatz haben. Dies waren Schuhe, die dem Herrscherhaus vorbehalten waren. So etwas wie Protzhausschuhe fürs Image. Bürgerliche Menschen hingegen trugen damals halbhohe Schuhe und Stiefeletten zum Knöpfen und Schnüren. Meistens reichten die Schuhe bis zur Hälfte des Unterschenkels. Zum einen nämlich war der Schuh damals, mehr noch als heute, ein klimatisches Wärmedämmmittel, zum anderen war nackte Haut sowohl bei Männern als auch bei Frauen verpönt.
Im Vergleich zum Herrenschuh jedoch, der bis in die Barockzeit ein ziemlich kleines Formenrepertoire abdeckte, war der Damenschuh auch damals schon ausgefeilter und vielfältiger. Beim Damenschuh war man experimentierfreudiger und arbeitete nicht nur mit Leder, sondern auch mit Stoffen aus Satin, Samt und Seide. Jedes Lederteil, jedes Stück Stoff, jeder Schnitt, jede Naht, jede Schnürung, ja sogar jeder einzelne Knopf saß einfach perfekt. Die Feinheit, die Akribie, diese Detailgenauigkeit, mit der Damenschuhe damals schon hergestellt wurden, ist großartig!
Wir haben in unserer Scheer-Galerie eine ziemlich große Auswahl an historischen Damenschuhen, denn während die meisten Herrenschuhe zur Zeit der russischen Besatzung gestohlen wurden, haben die Alliierten, als sie unser Geschäft nach dem Zweiten Weltkrieg ausgeräumt haben, für die Damenmodelle keinen Bedarf gehabt. Der Anblick dieser alten Pumps, Keil- und Plateauschuhe, Ballerinas und Sandaletten ist für mich wie eine Reise zu den Ursprüngen meines Handwerks. Gelegentlich gehe ich in den Keller hinunter, wo sich unser kleines Museum befindet, und nehme die alten Modelle in die Hand. Manche Schuhe haben eine Ausstrahlung, die ich kaum in Worte fassen kann. Manchmal scheine ich die alten Gedankengänge, die im Kopf des Schuhmachers vorgegangen sein müssen, lesen zu können. Das ist wie eine seelische Verbindung mit meinen Ahnen.
Im Lauf der Geschichte hat man diese zarte und feine Verarbeitung, mit der man den Damenschuh klassischerweise assoziiert, immer wieder auch dem Herrenschuh angedeihen lassen. Das ging sogar so weit, dass man in manchen Epochen im Rückblick – abgesehen von der Größe – kaum mehr sagen kann, ob es sich bei einem bestimmten Schuh um ein Damen- oder Herrenmodell handelt. Und manche Modelle, die heute als typisch männlich oder typisch weiblich gelten, waren zum Zeitpunkt ihrer Entstehung dem jeweils anderen Geschlecht zugeschrieben. Der Budapester beispielsweise, ein aus heutiger Sicht typisch männlicher Schuh, wurde ursprünglich für Damen entwickelt.
Die Entstehung der charakteristischen Lochstanzung hat, was die Wenigsten wissen, äußerst pragmatische Gründe. Wenn der Schuhmacher aus einem Stück Fell einen Herren- und einen Damenschuh zu bauen hatte, hat er in der Regel mit dem Herrenschuh begonnen, denn dafür brauchte er ein deutlich größeres Lederstück. Der kleinere Frauenschuh wurde daraufhin aus den Resten des Herrenschuhs ausgeschnitten. Sehr oft hatten diese Reste jedoch Fehler, Löcher, diverse Verletzungen, die es geschickt zu verbergen galt. Und so hat ein cleverer, sparsamer und effizient denkender Schuhmacher die Lochung erfunden, indem er die Fehlerstelle ausgestanzt und das Stanzloch in der seriellen Wiederholung zu einem ästhetischen Muster weiterentwickelt hat. Das war die Geburtsstunde des Budapesters. Oder besser gesagt, der Budapesterin.
Diese Kombination aus ökonomischem Kalkül und ästhetischer Raffinesse ist ein wesentlicher Bestandteil des Schuhmacherhandwerks. Auch bei uns im Hause gab es über viele bittere Jahre einen Engpass an gutem Leder. Daraufhin hat mein Großvater seine Kunden bei der Wahl des Modells auch im Hinblick auf die effiziente Verarbeitung der bestehenden Lederstücke im Lager beraten. Eine Reihe neuer Schnittmodelle ist auf diese Weise entstanden – so wie etwa der Herrenhalbschuh mit gebuggter Mittelnaht, eine Tugend aus der Not, eine Erfindung aus dem Hause Scheer.
Und so hat jeder Schuh seine eigene Entstehungsgeschichte. Abgesehen von Mokassins und Sandalen, deren Wurzeln Jahrtausende zurückliegen, sind die meisten Schuhmodelle, die wir heute kennen, auf die eine oder andere Weise zwischen 1800 und den 1920er-Jahren entstanden. Sie sind das Resultat vieler unterschiedlicher Abwägungen zwischen Ästhetik, Funktionalität und Effizienz. Der perfekte Schuh ist so gesehen das Produkt eines gesamtkünstlerischen, aber auch ökonomischen Verständnisses.
Vor allem aber ist der Schuh Produkt der beabsichtigten Wechselwirkung mit dem Körper. Je nach Design und Ausführung kann der Schuh strecken oder stauchen. Er kann das Gehtempo beschleunigen und verlangsamen. Er kann Defizite kompensieren, Fehler korrigieren, Muskeln aktivieren. Ledermaterial, Sohlenaufbau, Schuhlänge, Absatzhöhe und die Höhe des Schuhschafts – all diese Parameter stehen in einem direkten kausalen Zusammenhang und beeinflussen am Ende die Statur des Schuhträgers. Das ist wie eine Gliederkette, die aus Muskeln und Winkelspielen besteht und den Körper auf diese Weise im Lot hält. Sobald man auch nur ein einziges Glied variiert, verändert man damit die gesamte Körperhaltung.
Eine Absatzhöhe von vier Zentimetern war bei Männern früher keine Seltenheit. Das Zusammenspiel aus gespannter Wade, nach vorne gekipptem Becken, erhobener Brust, aufrechter Wirbelsäule und lang gestrecktem Hals waren gern verwendete und bewusst inszenierte Instrumente, um etwa Stolz darzustellen, um letztendlich den sozialen Status zu visualisieren. Das alles sind Elemente, die im Damenschuhdesign auch heute noch eingesetzt werden. Während die Absatzhöhe bei den Herren seit 1900 deutlich zurückgegangen ist, hat sie bei Frauen mit der gleichen Deutlichkeit zugenommen.
Für mich persönlich liegt die maximale Absatzhöhe bei sieben Zentimetern. Fünf bis sechs Zentimeter sind schon hoch, aber damit kommt der Körper zurecht. Sieben Zentimeter jedoch übersteigen das erlaubte Maß. Sie setzen die physikalischen Gesetze außer Kraft und schädigen den Gehapparat. Wenn man allzu sehr mit dem Gleichgewicht kämpfen muss, wenn die Wadenmuskulatur am Anschlag verkürzt ist und der Ballen die gesamte Last tragen muss, dann kommt das de facto einer Zerstörung des Fußes gleich. Viele Frauen scheinen sich immer noch damit zu arrangieren, dass der Fuß im Alltag leiden muss. Das ist mir ein Rätsel.
Doch Frauen mit High Heels sind nicht die einzigen, die ihre Gehwerkzeuge malträtieren. Auch Männer mit engen, schlecht geschnittenen Schuhen tun ihren Füßen nichts Gutes. Kinderschuhe wiederum sind völlig falsch konstruiert und werden von den Eltern oft nur als modisches Accessoire eingesetzt. Und bei Jugendlichen regieren fast ausschließlich Sneakers, Turnschuhe und völlig deformierende Ballerinas ohne jegliche Dämpfung. Um mit solchen Schuhen zu gehen, bräuchte man fitte, gesunde und gut trainierte Füße. Doch das haben die Wenigsten. Das Gegenteil ist der Fall. Manchmal scheint es, als würden die Menschen nicht mit, sondern neben ihren Schuhen gehen. Wir sind auf dem besten Weg, in puncto Füße völlig zu versagen.
Bei mir werden Männer und Frauen, Kinder und Jugendliche, Traditionsbewusste und Mode-Junkies gleichberechtigt behandelt. Sie dürfen, ja sie müssen beim Tragen des Schuhs Lust, Genuss und Komfort empfinden. Die Grundfunktionen des Schuhs sind heute immer noch die gleichen wie vor Tausenden von Jahren: Schutz vor Hitze, vor Kälte und vor Verletzung sowie eine nicht zu vernachlässigende Stützfunktion durch Bodendruck und Seitenhalt. Hinzu kommen weitere Facetten und Einflussfaktoren wie etwa Mode, Marktangebot und Darstellung der eigenen Persönlichkeit. Der Schuh ist ein perfektes Mittel, um dem eigenen Charakter Form und Gestalt zu verleihen, um Anteile seines eigenen Ichs nach außen zu kehren.
Der Schuh ist ein sinnliches Objekt. Man opfert ein Leben und lässt es weiterleben, indem man den eigenen Körper mit der Haut des toten Tieres umhüllt. Wir sind das schöpferischste und zugleich zerstörerischste Lebewesen auf diesem Planeten. So sind wir nun mal gepolt. Mit dieser Verantwortung müssen wir leben lernen. Wo wären wir, wenn wir diese Lebendigkeit nicht mehr spüren würden? Wenn wir uns dieser martialischen Ader nicht mehr bewusst wären? Wenn wir diesen Kreislauf aus Leben und Tod nicht mehr nachempfinden könnten? Das wäre ein schlimmer kultureller Verlust.
Tasuta katkend on lõppenud.