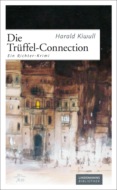Loe raamatut: «Die letzte Nacht»

Matthias Kehle
Die letzte Nacht
Erzählungen

Türkische Musik
„Wenn du Hundefleisch gegessen hast, machen Köter einen Bogen um dich“, erzählt mein Onkel Willi, „und zwar wochenlang.“
Ich sehe ihn vor mir, wie er mit seinem gewaltigen Bauch quer über die Wiese des Freibads lief, ihn nach oben hob und wieder nach unten fallen ließ. Er machte einen Schritt, lüpfte die Kugel mit Muskelkraft zehn, zwanzig Zentimeter in seinem Körper hoch, und beim nächsten Schritt plumpste sie wieder nach unten.
„Das gab eine gute Suppe“, erzählt er weiter von der Kriegsgefangenschaft. Wilhelm war in Straßburg in einem Lazarett untergebracht, in einem Hilfscorps, einer Arbeitsmannschaft für die französische Armee. „Wir haben eine Weile für eine Ärztin malocht, haben ihr Quartier sauber gemacht, den Boden geschrubbt und die Klamotten gewaschen.“
Die Kinder im Schwimmbad starrten meinem Onkel auf den überdimensionierten Ranzen. Er habe einen Fußball verschluckt, verkündete er einem Fünfjährigen mit blauer Plastikschaufel in der Hand. Der erschreckte sich vor dem hüpfenden Monstrum und fing an zu weinen.
„Die alte Schachtel hatte einen Hund. Aber nicht lange. Es war ein schöner Spitz, der vielleicht zwanzig Kilo auf die Waage brachte. Mensch, bis das Vieh hinüber war!“, lacht Onkel Willi, „mit einem Prügel haben wir auf ihn eingedroschen, und gejault hat der!“
Es sei alles dagewesen, erzählt Wilhelm, Not habe keine geherrscht. In der Kaserne gab es ein Lagergebäude, in dem sie sich bedienen konnten. „Für Kriegsgefangene gibt es keine Schlösser.“ Sogar ein Radio hatten sie, obwohl die Franzosen allen die Rundfunkgeräte abgenommen hatten. „Die meisten Radios im Lager funktionierten nicht, aber die besten standen bei uns im Quartier. Einer ist immer Elektriker.“ Was fehlte, besorgten sie sich. Wer einen Draht organisieren könne und ein wenig clever sei, bekomme jedes Schloss geknackt. „Ein Schneider ist auch immer dabei. Eines Tages hat die ganze Mannschaft weiße Hemden getragen aus Betttüchern des Städtischen Krankenhauses in Karlsruhe. Der Schneider hat Schnittmuster gezeichnet, die restlichen Gefangenen haben wie die Weltmeister genäht.“
Wie er den kleinen Jungen wieder beruhigte, war sein Geheimnis. Ich konnte ihn von meinem Liegeplatz aus nicht verstehen. Mit einem Mal stand der Junge da und lachte meinem Onkel ins Gesicht. Meine Mutter wühlte in ihrer Tasche und suchte die orangefarbenen Schwimmflügel, während ich an einer der Gummiblüten ihrer Bademütze zog, um sie abzulösen.
„Für einen Hund brauchst du nichts, außer einem Kochtopf, und den kann man auch organisieren“, sagt mein Onkel und erzählt von den Kitteln der Gefangenen, an denen ein Haken angenäht war. Daran hing der Fressnapf, eine billige Blechbüchse, ein Fünflitereimerchen, befestigt mit einem Draht. „Darin hast du gekocht, darin hast du gewaschen.“
Wilhelms Bauch schwebte in Kopfhöhe des Jungen. Dem lief der Rotz, aber er lachte. Wenn Wilhelm über die Wiese stolzierte, sein Fußballbauch auf- und abhüpfte, musste er alle zwanzig Schritte eine Pause einlegen, um sich die Badehose wieder nach oben zu ziehen. Mein Vater kam vom Schwimmbecken zurück und ließ sich von meiner Mutter eine trockene Badehose geben. Er verschwand in der Umkleidekabine, die mitten auf der Wiese stand, eine kreisrunde spanische Wand aus schwerem Tuch, nach oben hin geschlossen, von Vaters Beinen sah man die unteren zwanzig Zentimeter. Er kam zurück und warf die nasse Badehose zum Trocknen auf den Sonnenschirm.
„Eigentlich war es ein Lazarett für Geschlechtskranke“, erinnert sich Wilhelm, „teilweise umfunktioniert zu einem Armeeverpflegungslager.“ Weil deutsche Gefangene nicht über den Rhein durften, war Willi mit seinen Kameraden an die Französische Armee und an das Krankenhaus übergeben worden. Im April Fünfundvierzig, einen Monat vor Kriegsende, wurden sie noch erwischt.
Ich ging gerne mit meinem Onkel Willi schwimmen. Wenn beide Familien im Schwimmbad waren, durften nie alle gemeinsam ins Wasser. Mindestens einer musste auf die Sachen aufpassen, auf die Kühltaschen, den Sonnenschirm und die Handtücher, die unseren Liegeplatz markierten. „Wertvoll ist ja nichts, nicht mal die Armbanduhren“, sagte meine Mutter, „aber wenn etwas wegkommt, ist es ärgerlich. Der Teufel ist ein Eichhörnchen.“
„Die haben alle türkische Musik am Frack gehabt, die Kerle“, erzählt Onkel Willi weiter, „Tripper, Schanker, Syphillis, das Gießkännchen verbogen. Mit türkischer Musik bist du scharf wie eine Rasierklinge, und einige sind nachts immer in die Stadt abgehauen. Obwohl die Kaserne von einer Mauer umgeben und diese mit Stacheldraht gesichert war.“ Wenn der Wachmann mit seiner MP vorne war, konnte man hinten raus, vorausgesetzt, man war schnell genug.
Willi packte seine weiße Gummibademütze mit dem breiten schwarzen Streifen in der Mitte, ich sprang auf, folgte ihm, und sogleich rollte der Fußball in die Höhe, plumpste nach unten, hob sich erneut und stürzte wieder ab, bis Willi kurz stehenblieb, um die braune Hose mit ihrem orangefarbenen Muster hochzuziehen.
„Ein paar Tage später standen die Mütter mit ihren Töchtern auf dem Kasernenhof, tausend Kranke mussten vor ihnen antreten, bis es hieß: Der war’s! Der Täter bekam erst eine Tracht Prügel, anschließend dreißig Tage Einzelhaft. Zum Fressen gab’s Runkelrüben mit Salzwasser.“
Auf dem Weg zum Schwimmbecken schaute mein Onkel den Frauen nach. „Du darfst nicht nach ihnen pfeifen so wie die Italiener“, sagte er, „das mögen nicht mal die hässlichsten Frauen.“ Ich sollte es mir unbedingt merken, bis ich groß sei.
Weil ich nicht gerne über den heißen Asphaltweg ging, der am Kinderspielplatz begann und bis zum Wasserbecken führte, hob mich mein Onkel auf seine Schultern. „Ich kenne jemand, der so groß ist, dass er dir jetzt auf den Kopf spucken könnte,“ sagte er. Ich hoffte, nie so groß zu werden, denn wenn ich ein solcher Riese wäre, würde ich die Geldstücke auf der Straße nicht mehr sehen. Ich sammelte sie in einer speziellen Spardose, in der ich nur meine Fundstücke verwahrte. Mit diesem Geld wollte ich mir einmal etwas Besonderes kaufen, den Plüschhasen im Spielwarenladen vielleicht, der 37 Mark kostete. Als ich Onkel Willi davon erzählte, während ich auf seinen Schultern saß, meinte er, ich könnte ja eine rote Binse kaufen. Ich schwieg.
Ob ich überhaupt wisse, was das sei? Es sei nämlich etwas Ähnliches wie Horbelen. Weil ich wusste, dass mein Onkel die unsinnigsten Sachen erfand und er außerdem einmal zu meiner Mutter gesagt hatte, sie sei eine rote Binse, antwortete ich ihm nicht. „Wenn du weiterhin so still bist“, sagte er kurz vor dem Becken, „dann muss ich deiner Mutter Meldung machen, dass du krank bist.“
Einmal ging Wilhelm während seiner Kriegsgefangenschaft mit zwei Kumpels baden.
„Ab durch das Hintergelände der Kaserne und an den Stallungen vorbei, rein in die Ill,“ erinnert er sich. „Von der medizinischen Abteilung haben wir uns ein Suspensorium besorgt.“
Detailreich beschrieb mein Onkel eine Art gehäkelter Unterhose, die sehr stramm anliegt, um die männlichen Geschlechtsteile fest zu umschließen.
„Wenn du türkische Musik hast und alles hängt herunter, tut das nämlich höllisch weh.“
Dummerweise, so erzählt Onkel Wilhelm, sah man damit aus wie eine Madonna durchs Wasser gezogen. Und dummerweise fehlten beim Appell drei Mann. Die Wachmannschaft bestand auch dummerweise aus Marokkanern, die sehr schnell wussten, wo die Kameraden sich vergnügten. „Komm, komm Kamerad, haben sie gerufen und uns aus der Ill gescheucht, und zwar nicht hinten rein in die Kaserne, sondern die ganze Straße lang. Der Käpt’n stand da und hat sich den Bauch gehalten.“
Wir standen am Beckenrand für die Erwachsenen, ich wollte weiter zum Kinderbecken.
„Heute gehst du mit mir da rein!“, sagte mein Onkel.
Ich brüllte, schrie und fuchtelte, ich zuckte mit den Beinen, doch Onkel Willi verklemmte meine Füße fest unter seine Arme. „Nein“, schrie ich und zog das „i“ so laut ich konnte in die Länge, ich fühlte, wie mein Herz raste und mein Kopf heiß wurde.
„In deinem Alter muss man schwimmen lernen“, sagte er, schnappte sich plötzlich meine dünnen Arme, lüpfte mich vor seine Beine, stellte mich direkt an den Beckenrand und hob mich wieder nach oben.
Ich zappelte, brachte ihn dabei aber nur wenig ins Schwanken. Er setzte mich wieder ab und hob mich erneut in die Luft, dreimal, viermal, fünfmal, bevor er mich langsam ins Wasser senkte.
Er ließ mich los, und obwohl ich Angst hatte, sofort zu versinken, Wasser in meine Nase und meinen Hals zu bekommen, kriegte ich den Beckenrand zu fassen. Ich war erleichtert und atmete schnell, als mein Onkel direkt neben mir ins Wasser sprang. Die Druckwelle, die sein Bauch auslöste, riss mich vom Beckenrand.
Französische Kriegsgefangene brachten immer Eheringe mit, egal ob sie verheiratet waren oder nicht. Mein Onkel doziert: „Der 22er-Franc hatte nämlich einen hohen Goldanteil, und nachdem die deutschen Gefangenen frei gelassen waren, gab es in ganz Frankreich keine mehr. Du erhitzt die Münze, legst sie auf einen Stein, in dem ein Loch ist und treibst sie, bis ein Hütchen daraus geworden ist. Anschließend stumpfst du sie wieder, damit sie dicker wird, sägst und polierst sie, fertig.“
Ich ging nicht unter, denn ich ruderte mit den Armen, wie ich es bei den Erwachsenen gesehen hatte. Onkel Willi blieb unter der Wasseroberfläche verschwunden. Ich patschte in Richtung Beckenrand. Er war nirgends zu sehen. Ich zählte einundzwanzig, zweiundzwanzig, dreiundzwanzig und glaubte fast, dass er tatsächlich einen Fußball verschluckt hatte, nun die Luft aufbrauchte und nachher als schlanker Mann delfinartig über die Wasseroberfläche hinausschießen und losprusten würde. Ich hangelte mich am Beckenrand entlang, bis zu den Sprossen, um aus dem Wasser zu steigen. Gerade als ich nach der Stange greifen wollte, katapultierte Onkel Willi direkt hinter mir nach oben und packte mich an beiden Armen. Er atmete schwer und schnell, als Erstes sah ich seinen Fußballbauch.
Irgendjemand hatte damals nach Kriegsende behauptet, Onkel Willi sei bei der SS gewesen, weshalb er einmal ins Straßburger Stammlager verlegt und zu einem SS-Kommando gebracht worden war. Der Bereich war rot eingezäunt, jeden Morgen wurden die SS-Leute geholt.
„Aufräumkommando, Munition aus dem ganzen Elsass. Jeden Tag kamen ein paar weniger zurück“, sagt Wilhelm lakonisch.
In den alten Kasematten – Straßburg war eine Festung – wurde alles Kriegsgut gesammelt, das übrig war, zum Beispiel 115er-Haubitzengranaten. Eine wog 48 Kilogramm, der hintere Teil wurde abgeschraubt. Je hundert Stück wurden in einem Sprengloch gestapelt, das die SS-Leute vorher gegraben hatten. Anschließend platzierte man unter dem Haufen einen Zünder, die Gefangenen verließen das Loch, und das Ganze wurde gesprengt.
„Damit die Granaten besser und gleichmäßiger herunterrutschen, haben die Buben mit Wasser eine Art Rutschbahn gebaut und sie rückwärts heruntergelassen. Und wenn sie den Rappel hatten, ließen sie die Granaten vorwärts rutschen, es waren ja keine Zünder dran. Je nachdem, wie sie unten aufkamen, gingen sie doch los. Die dort unten haben keinen Hunger mehr gehabt. Von denen wurde nichts mehr gefunden.“ Wilhelm sagt, er habe am zweiten Tag Krach gemacht, damit er dort wieder wegkam.
Ich brüllte und hatte Angst.
„Du musst einfach nur die Arme bewegen wie ich auch“, sagte Willi. Er stand auf dem Grund, und plötzlich spürte ich seine Hand unter dem Bauch. Während ich mit den Armen ruderte, bewegte er sich mit mir durchs Wasser. Ich hörte auf zu schreien und konzentrierte mich darauf, mit den Armen und Beinen abwechselnd Schwimmbewegungen zu machen und nicht gleichzeitig, weil man das nicht durfte. Als Onkel Willi mich losließ, zappelte ich in Richtung Sprossen.
„Na also, du kannst schwimmen“, rief er, ohne mir zu folgen. Ich hatte Wasser in den Ohren und hörte ihn nur dumpf. Hastig floh ich aus dem Becken, meine kleinen Füße hinterließen sechs oder acht Abdrücke, die sich auf dem heißen Boden schnell verflüchtigten. Während ich abwechselnd hinter mich blickte und meine Spuren wahrnahm, kontrollierte ich, ob Onkel Willi mir folgte. Er war zwischen den vielen bunten Köpfen im Schwimmbecken verschwunden, doch plötzlich winkte er mir von der gegenüberliegenden Seite zu.
„Im Lager ging es uns blendend,“, erinnert sich Onkel Wilhelm „nachts haben wir im Privatquartier, in einer Scheuer, geschlafen. Irgendwo mussten wir ja nächtigen.“ Ein altes Männchen – mit 57 Jahren als Soldat eingezogen – wurde zu ihnen gesteckt. „Der alte Depp haut nachts aus der Scheuer ab, klaut dem Bauer einen Kittel, eine Mütze und ein paar Schuhe und marschiert los. Am nächsten Morgen fiel auf, dass er verschwunden war, mittags rückten die Franzmänner mit Maschinengewehren aus und abends brachten sie ihn. Zwei Mann hoben ihn zwischen Prellbock und Kuhpuffer. Der hat nicht mehr geschrien.“
Ich schlenderte zu unserem Liegeplatz. Überall roch es nach Sonnenmilch, wie die orangefarbenen Blüten der großen Pflanzen im Treppenhaus, die an Fasching an einem langen Stängel über die Blätter ragten. Meine Eltern und meine Tante bewachten das Gelände. Der Sonnenschirm lag auf dem Boden, mein Vater kam mit einer Bademütze voll Wasser. Er goss es vorsichtig in das Erdloch, in welchem der Schirmständer steckte. Als die Bademütze leer war, nahm er den Ständer, drückte ihn mit all seiner Kraft tief in den Boden und bekam dabei einen roten Kopf. Ich setzte mich auf Onkel Willis Decke. Daneben, auf der Kühlbox, lag seine Armbanduhr. Sie war bestimmt hundert Jahre alt, dachte ich, aber sie schien nicht richtig zu gehen. Ich schaute einige Sekunden aufs Ziffernblatt. Kein Zeiger bewegte sich, und das Datum war auch falsch. Plötzlich stand Onkel Willi neben mir. Er war riesig, ich fühlte mich ertappt. „Das ist die Uhr meines Vaters, also deines Großvaters“, sagte er und warf die nasse Badehose auf den Sonnenschirm. „Als Gustav gestorben war, hat Minna sie ihm abgenommen und jeden Tag frisch aufgezogen.“ Sie sei noch exakt einen Monat weiter gelaufen. Am gleichen Tag, einen Monat nach Großvaters Tod jedoch, sei sie kurz vor Mitternacht stehengeblieben und kein Uhrmacher habe sie jemals wieder reparieren können, kein Fachmann habe je herausgefunden, was kaputt gegangen war.
„Und euer Sohn“, sagte Onkel Willi zu meinen Eltern, „hat heute Schwimmen gelernt.“
Diaabend
Als Zwölfjähriger verliebte ich mich in ein Bild. Genauer gesagt in das Bild eines Mädchens auf einem Dia. Mein Vater besaß eine große Dia-Sammlung, vielleicht zweitausend Stück, auf denen die ganze Familiengeschichte festgehalten war und die an langen Diaabenden diskutiert wurde. Mutter und Vater frisch verlobt in Venedig, am Strand von Jesolo samt Leuchtturm und Segelschiffen, Vaters Geburtstag mit Weinflaschen und Bahlsen-Club-Salzgebäck auf dem Tisch, mein dürrer Großvater mit seinem Hitler-Schnauzbart, wie er vor seinem Geburtshaus in Schaffhausen steht. Das Gebäude sollte kurz darauf abgerissen werden und war schon von Holzstangen umgeben, welche die Abmessungen des neuen Gebäudes, eines Supermarktes, markierten. Das jedenfalls erzählte meine Mutter während eines Diaabends. Bilder von Gräbern alter Tanten, die 1892 oder 1904 geboren worden waren, und dutzende Aufnahmen von meiner Schwester und mir als Baby, im Kindergarten und mit Schultüte. Wie ich mit einem Holzhämmerchen auf Klötze einschlage, wie meine Schwester einen Spielzeugtelefonhörer aus rotem Plastik ans Ohr hält oder wie sie um die Stange des Sonnenschirms tanzt.
Wie alle Kinder wurden wir ungeduldig, wenn mein Vater meine Schwester und mich neben einem blühenden Strauch postierte und uns befahl, bewegungslos zu verharren, worauf er mindestens zwei Minuten lang seine Voigtländer einstellte. Am liebsten waren ihm deshalb jene Fotos, bei denen er mit Stativ und in aller Ruhe arbeiten konnte, wie er bei den Diaabenden sagte, Fotografien etwa von Mutters Wachsblume, Hibiskus oder Gloxinie.
Ich erinnere mich auch, dass er an einem Heiligabend das Stativ vor dem Christbaum aufbaute, die Kamera festschraubte, eine silberne Christbaumkugel anhauchte und gründlich polierte, um anschließend die verzerrte Spiegelung seiner selbst aufzunehmen.
Diaabende fanden selten statt. Jedenfalls bis zu jenem Zeitpunkt, an dem ich mich in das Mädchen auf dem Bild verliebte. Meist schauten wir die Bilder an, wenn meine beiden Onkel und Tanten zu Besuch waren oder wenn die Dias des letzten Urlaubs frisch entwickelt, geschnitten und gerahmt waren. Sonntags, am späten Vormittag, nachdem er einen Apfel gegessen hatte, machte sich mein Vater daran, die neuen Dias zu verarbeiten. Ein Teller, auf dem ein einziger endloser Streifen mit jener Schale lag, die er vorsichtig und kunstvoll vom Apfel geschält hatte, stand vor ihm auf dem Tisch, das Messer lag daneben. Allmählich färbte sich die Schale braun. Eine Quelle-Schachtel mit Dia-Rähmchen, eine fast dreißig Zentimeter lange Schere und ein leeres Magazin waren um meinen Vater drapiert. Ich saß ihm gegenüber, denn ich sammelte, wofür er keine Verwendung hatte: die verwackelten und misslungenen Dias, die überbelichteten ersten Aufnahmen eines Films oder das jeweils letzte Bild, das nur ein halbes war. Mein Vater hielt die Streifen ins Licht, schnitt vorsichtig Dia für Dia ab und platzierte jedes mit einer Pinzette in den Rahmen. Er drückte das Gegenstück an und fegte mit einem weichen Pinselchen für mich unsichtbare Staubkörnchen in die Luft. Wenn ein Dia im Rahmen befestigt war, ließ er es durch einen Schlitz in den „Gucki“ fallen, drückte das kleine graue Plastikgehäuse an ein Auge, schloss das andere und drehte sich in Richtung Fenster zum Licht, um einen ersten Eindruck vom neuen Bild zu bekommen. Dann reichte er mir den „Gucki“ und machte sich an den nächsten Rahmen. Meine Mutter nannte diese Sonntagvormittage eine Staatsaffäre, denn die Diasammlung war das Heiligtum meines Vaters.
Wenn er die Dias des letzten Urlaubs gerahmt hatte, freute ich mich auf den Diaabend; wenn es Bilder waren, die sich schon ein halbes Jahr oder länger in der Kamera angesammelt hatten, war es mir gleichgültig, denn das waren meist Aufnahmen von Blumen, von seinem neuen orangefarbenen Opel Ascona oder von seinen Kollegen mit Bierkrug in der Hand. Bei Diaabenden mit solchen Bildern wurde mir schnell langweilig, und ich ging früher ins Bett als sonst. Einschlafen konnte ich aber nicht, weil es laut wurde und meine beiden Onkel und mein Vater viel tranken. Onkel Willi kommentierte die Dias, wollte noch einmal zwei Bilder zurück, weil meine Mutter ein bestimmtes Kleid trug, als sie jung war oder weil mein Vater noch seinen alten, hellblauen VW-Käfer besaß. Mehrere Minuten diskutierte meine Familie über ein Bild, während ich aufs Klo musste, im Halbdunkel über den Teppich stolperte und mein Onkel sich einen Schnaps nach dem anderen eingoss, bis ihm meine Tante die Flasche wegnahm, worauf er sich eine Handvoll Erdnüsse griff und die Nusshälften mit spitzen Fingern in schneller Folge einzeln zwischen die Lippen steckte und mit einem Luftzug in den Mund sog. Je älter wir Kinder wurden, desto öfter sah sich meine Familie die Baby-Bilder an. Meine Haare waren inzwischen heller geworden, meine Schwester hatte keine Locken mehr, und meine Cousinen, die viel älter waren als ich, zogen im Schwimmbad den Bauch ein, während ich auf dem nächsten Dia im Sandkasten ein Loch grub, neben mir ein rotes Eimerchen.
Sehnsüchtig erwartete ich die Diaabende, nachdem ich mich in das Mädchen auf dem Bild verliebt hatte. Ich bettelte regelrecht darum, Dias anzuschauen, und oft gelang es mir sonntagnachmittags, meine Eltern dazu zu überreden. Mein Vater holte den Projektor aus dem Schrank und die Leinwand aus dem Keller, meine Mutter, meine Schwester und ich trugen die Küchenstühle ins Wohnzimmer. Wir bauten unseren privaten Kinosaal auf. Ich hatte Herzklopfen, als das blendend-weiße Rechteck auf der Leinwand aufleuchtete, bevor mein Vater das Magazin in den sirrenden Apparat schob und das erste Dia vor die Linse klackerte. Wir schauten uns Bilder vom letzten Urlaub an, Aufnahmen von Bergen, von Schloss Neuschwanstein und einigen Blüten, und ich überlegte schon, wie ich meinen Vater dazu bringen konnte, das richtige Magazin zu wählen.
„Was wollt ihr noch sehen?“, fragte er, als das Magazin fast durch war.
„Die Konfirmation meiner Cousine!“, schoss es beim ersten Mal aus mir heraus. Beim darauffolgenden Diaabend, an dem ich das Bild des Mädchens wiedersehen wollte, in das ich mich verliebt hatte, diskutierte ich mit meiner Mutter und Schwester, um keinen Verdacht zu erregen. Die Konfirmation kam erst als drittes Magazin, und vor Ungeduld schwang ich unter meinem Stuhl die Beine hin und her.
Ich hatte mich in ein Mädchen verliebt, das mit meiner Cousine konfirmiert wurde. Also war sie zwei Jahre älter als ich. Bei der Konfirmation selbst war sie mir nicht aufgefallen. Ich erinnere mich nur noch, dass neben meiner Cousine ein hübsches, hoch gewachsenes Mädchen die Kirche verließ, das viel größer war als alle anderen Konfirmanden. Als mein Vater die Dias rahmte und ich die Bilder der Konfirmation zum ersten Mal durch den „Gucki“ betrachtete, verliebte ich mich sofort. Mein Vater reichte mir den „Gucki“ mit dem Dia, ich starrte in das Gerät und hielt mir das zweite Auge mit der anderen Hand zu.
„Und, geht’s weiter?“, fragte mein Vater plötzlich.
Ich setzte den „Gucki“ ab, mein Vater hatte drei gerahmte Dias vor sich liegen. Dann nahm ich das nächste Dia, ohne ein Wort zu sagen. Was ich auf den anderen Bildern gesehen hatte, die mein Vater an diesem Sonntag rahmte, weiß ich nicht mehr. Ich hatte nur das Bild des schwarzhaarigen Mädchens vor Augen, das neben meiner Cousine in die Kamera lächelte. Über ihrer weißen Bluse trug sie ein schwarzes Jäckchen, das nicht zugeknöpft war. In ihrer rechten Hand hielt sie ein Blumensträußchen, das auf den Boden zeigte, so als habe sie es vergessen, weil sie für mich in die Kamera lächelte.
Einmal war es nach einem Diaabend spät geworden. Ich musste ins Bett und hörte noch eine Weile meinen Onkel, meine Tante und meine Eltern lachen, Gläser klirrten. Ich war wohl eingeschlafen, bevor sie aufhörten, Wein und Schnaps zu trinken. Doch während ich wach lag, beschloss ich etwas zu unternehmen. Es musste endlich etwas geschehen. Das Mädchen kennenlernen konnte ich nicht, denn meine Cousine und somit auch meine Geliebte wohnten in einer anderen Stadt. Vielleicht könnte ich meine Cousine nach dem Namen des Mädchens fragen, überlegte ich eine Zeitlang und sie anrufen. Doch was wäre, wenn ihre Eltern den Hörer abnähmen? Würde ich mich trauen, nach ihr zu verlangen? Was sollte ich sagen? Hallo, du bist mit meiner Cousine konfirmiert worden, erinnerst du dich an mich? Nein, sie erinnerte sich nicht, sie hatte mich wohl kaum wahrgenommen. Oder: Mein Vater hat dich fotografiert, und ich habe mich in dich verliebt. Es ging alles nicht.
Was ich mir ausdachte, war unmöglich. Ich rechnete: Sie war zwei Jahre älter als ich. Mädchen, die zwei Jahre jünger als ich waren, erschienen mir als Kinder. Wahrscheinlich war ich für das Mädchen, das ich insgeheim „meine Geliebte“ nannte, ein kleiner Bub. Ich ahnte, dass sich das beim Erwachsenwerden änderte, denn meine Mutter war fünf Jahre jünger als mein Vater. Doch wollte ich warten, bis ich erwachsen war, um sie kennenzulernen? Bevor ich einschlief, überlegte ich, ob ich eines Tages in jener Stadt, in der meine Cousine wohnte, studieren und mich auf die Suche nach ihr, meiner Geliebten, machen sollte. Auf alle Fälle, so beschloss ich, musste ich das Dia besitzen, wenn ich mich in ferner Zukunft auf die Suche nach ihr machen sollte. Während ich über ein gutes Versteck nachdachte, schlief ich ein.
Bis zum nächsten Diaabend vergingen Wochen, vielleicht sogar Monate. Ich hatte meine Geliebte ein wenig vergessen, denn das neue Schuljahr hatte begonnen, und ich saß einem Mädchen gegenüber, das mir gefiel. Anja, hieß sie, hatte dunkle Haare wie das Mädchen auf dem Dia und große braune Augen. Die Augenfarbe auf dem Bild konnte ich nur erraten. Nein, verliebt war ich nicht in Anja, dachte ich gelegentlich, verliebt war ich in das Mädchen auf dem Dia. Doch je mehr Zeit verging, desto seltener dachte ich an meine Geliebte.
Es war im Dezember, als ich bemerkte, dass dem Mädchen kleine Hügel unter dem Pulli wuchsen. Ich phantasierte, dass ich mit dem Mädchen schlief, ohne Vorstellungen davon zu haben, wie genau das funktionierte.
Während der Weihnachtsferien regnete es ununterbrochen, selbst im Schwarzwald war an Rodeln nicht zu denken.
„Dumm, dass wir mit den Kindern überhaupt nicht raus können“, sagte mein Vater zwischen Weihnachten und Silvester.
„Wir könnten Dias anschauen“, antwortete ich sofort. Schlagartig war mir meine Geliebte eingefallen, ich erinnerte mich kaum an ihr Gesicht, doch mein Herz schlug schneller.
„Viele neue Bilder haben wir ja nicht“, gab mein Vater zu bedenken. Doch das Wetter war trüb genug, um bei ihm Sehnsucht nach Urlaubsbildern zu wecken.
„Wir könnten eine Art Jahresrückblick machen“, fiel mir ein, um meinem Vater das letzte Argument zu liefern, den Projektor und die Leinwand aufzubauen.
Ich trug die Stühle von der Küche ins Wohnzimmer, mein Vater nahm die Magazine aus dem Schrank und schob vorsichtig den Weihnachtsbaum noch etwas näher ans Fenster, wobei das Glöckchen klingelte, das Lametta raschelte und einige Kugeln nahezu endlos hin- und her schwangen.
„Omas Geburtstag, Konfirmation, Mutters Geburtstag, Urlaub im Berner Oberland, Opas Geburtstag“, zählte er auf, „die Weihnachtsbilder sind noch in der Kamera.“ Er stellte drei Magazine auf den Tisch, auf zwei von ihnen stand „Berner Oberland 1978“. Mein Vater schaltete den Projektor ein. „Schneefeld am Montblanc“, kommentierte er das strahlende Weiß, das auf der Leinwand leuchtete und ließ den Rollladen herunter, obwohl es draußen schon fast dunkel war.
Die Bilder vom Geburtstag meiner Oma langweilten mich. Ich betrachtete die Spiegelungen in den Christbaumkugeln. Wenn ich näher rückte, erschien mein Kopf unendlich groß.
„Ich habe meine Mutter noch nie betrunken erlebt“, sagte mein Vater und wiederholte die Geschichte, wie sie eine Flasche süßen Weins trank, der sonst niemandem schmeckte. Auf der Leinwand erschien eine ganze Serie mit Aufnahmen von einer lachenden Großmutter, deren Brille schief saß und die sich Luftschlangen um den Kopf wickelte. Das letzte Bild vor den Konfirmationsbildern zeigte meine Oma, die sich an Großvaters Arm kaum auf den Beinen halten konnte.
Es war soweit, die Konfirmationsbilder waren an der Reihe. Mein Herz klopfte kaum noch schneller als normal, denn ich hatte beschlossen, das Bild mit meiner Geliebten nun endlich aus dem Magazin zu nehmen, sobald ich mal wieder allein zu Hause wäre, um es immer betrachten zu können, wann ich wollte. Nie wieder wollte ich ihr Gesicht vergessen. Dann geschah etwas Unglaubliches. Anstelle des Bildes mit meiner Geliebten blendete mich ein weißer Fleck, das „Schneefeld am Montblanc“.
Mein Vater projizierte das nächste Bild auf die Leinwand, ohne ein Wort zu sagen. Ohne jeden Kommentar erschien ein Dia, auf dem die ganze Familie im Restaurant saß und auf das Mittagessen wartete. Onkel Willis Hand war ein verschwommener Fleck am Bildrand, weil er in die Kamera winkte.
Mein Herz raste, die Gedanken wirbelten durch den Kopf. Das Bild war herausgefallen, lag hinter dem Schrank! Es war am Rand überbelichtet, Vater hatte es weggeworfen! Der schlimmste Gedanke war: Mein Vater hatte mich durchschaut! Er hatte das Dia weggeschlossen, damit ich es mir nicht nehmen konnte. Ich sollte nicht von Mädchen in einer fremden Stadt träumen. Mit meinem letzten Zeugnis waren meine Eltern nicht zufrieden. Womöglich hatte mein Vater das Bild mit der großen Schere in millimeterbreite Streifen geschnitten und in den Müll geworfen. Jetzt durfte ich mir nichts anmerken lassen. Am wenigsten auffällig wäre es, still auf meinem Stuhl zu sitzen und mich auf die restlichen Dias und die Urlaubserinnerungen meiner Eltern zu konzentrieren.
„Warum nur lässt du dich nicht anständig fotografieren?“, fragte mein Vater, „ich habe kaum schöne Bilder von dir.“
Ich starrte auf ein Dia mit meiner Mutter, die auf einem Felsen saß und die Zunge herausstreckte.
„Weshalb musst du immer mich knipsen?“, entgegnete meine Mutter.
Plötzlich verwandelte sich ein Dia in das Mädchen aus meiner Klasse. Ich fixierte meine Augen auf ein Detail des nächsten Bildes: An einem Bergsee lagen Tretboote am Ufer, und erneut hatte ich sie vor mir. Immer wieder dachte ich an Anja und nicht an das Mädchen auf der verschwundenen Fotografie. Es war, als wäre sie mit dem Bild aus meinem Kopf geflohen. Auch die verzerrte Spiegelung, die in der Christbaumkugel neben mir erschien, war nicht ich, sondern Anja.
Als mein Vater das letzte Magazin vorne aus dem Projektor zog und das Wohnzimmerlicht einschaltete, war es wie jedes Mal nach Diaabenden. Ich fühlte mich, als sei ich gerade erwacht, das Licht blendete wie an einem Sommermorgen.
Und ich hatte mich in das Mädchen verliebt, dem ich in einigen Tagen im Klassenzimmer wieder gegenüber säße.
Blumen im Zimmer
Die Tür steht offen, ein leichter Wind weht herein. Seit drei Stunden sitze ich hier, während mein Bruder im Nebenzimmer schläft. Sobald der Gärtner fertig ist, werde ich ihn wecken. Ich weiß, dass er sich die Hände reiben wird. Das macht er immer, wenn er sieht, dass alles in Ordnung ist. Der Kostenvoranschlag des Gärtners weist die Arbeit als günstig aus.
„Es ist der erste Auftrag dieser Art“, sagt er, und er spekuliert auf weitere Aufträge. Ich weiß, dass er vergeblich spekuliert.
Auf der Lehne des Sessels stehen Usambaraveilchen. Als sie der Lieferant brachte, sagte er: „Jetzt bin ich bald fertig“, und wischte sich die Hände an der grünen Schürze ab.
Tasuta katkend on lõppenud.