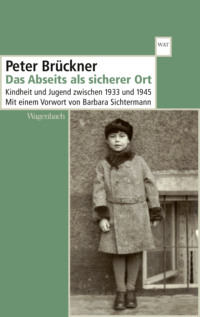Loe raamatut: «Das Abseits als sicherer Ort»

E-Book-Ausgabe 2020
© 1980, 2019 Verlag Klaus Wagenbach, Emser Straße 40/41, 10719 Berlin
Covergestaltung: Julie August unter Verwendung einer privaten Fotografie. Das Karnickel zeichnete Horst Rudolph.
Datenkonvertierung bei Zeilenwert, Rudolstadt.
Alle Rechte vorbehalten. Jede Vervielfältigung und Verwertung der Texte, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Zustimmung des Verlags urheberrechtswidrig und strafbar. Dies gilt insbesondere für das Herstellen und Verbreiten von Kopien auf Papier, Datenträgern oder im Internet sowie Übersetzungen.
ISBN: 978 3 8031 4304 4
Auch in gedruckter Form erhältlich: 978 3 8031 2815 7
Vorwort
Daß die beiden »Rätsel von Geschichte und Lebensgeschichte« ineinander verschlungen seien, ja daß es sich um ein einziges Rätsel mit einem individuellen Gesicht und einem historischen Wurzelwerk handele – das war die Überzeugung Peter Brückners, war Motiv und Motto aller seiner Arbeiten. Als Psychologe war er immer Historiker und Soziograph, als Analytiker gesellschaftlicher Zustände blieb er Seelenkundler. Diese enorme Spannung zwischen zwei Gegenständen der Forschung und Erkenntnis: Geschichte und Biographie, Gesellschaft und Individuum, Struktur und Ich macht die Faszination und – in Teilen – Schwerverständlichkeit seines Werkes aus. Es handelt sich ja um eine Spannung, die praktisch immer wieder durchreißt, die förmlich Züge einer Konstruktion hat, einer theoretischen ideé fixe, einer heuristischen Formel, deren Tauglichkeit, Zusammenhänge zu erhellen, erst aufzuweisen wäre. Wer von uns ist schon in der Lage, das »Rätsel seiner Lebensgeschichte« so auf Geschichte und Gesellschaft zu projizieren, daß sich auch nur eine sinnvolle Aufgabenstellung ergibt – von einer Lösung zu schweigen. Steckt da nicht etwas Verzweifeltes in diesem Festhalten an der Konvergenz von Ich und Welt, von Vita und Historie, das mehr über das Verlangen nach Sinn und Deutung dessen verrät, der da so verzweifelt festhält? Oder ist umgekehrt der Verzicht auf ›Spannung‹, das Sich-Bescheiden mit den disparaten, verlorenen, vereinzelten Gegenständen unserer Interessen, ist diese heute vorherrschende Spezialisierung in der Wissenschaft, aber auch in den Künsten und Medien, vielleicht eine vorschnelle und bedauernswerte Kapitulation vor den Ansprüchen einer möglicherweise fruchtbareren, aber nur schwer auszuhaltenden, mühevollen, kräftezehrenden Mehrdimensionalität? Vor einem beidhändigen Zugriff sozusagen, der sich mit dem Vereinzelten so wenig zufrieden gibt wie mit dem großen Ganzen, weil er weiß, daß das eine sich nur im anderen bewegt und das andere nur war und wird, was viele einzelne aus ihm machen?
Peter Brückner war studierter Psychologe und gelernter Psychoanalytiker, er hat nur kurze Zeit in seinem Leben als Therapeut praktiziert, trotz seiner großen Talente in dieser Disziplin. Was ihn stärker faszinierte als die einzelne Stimme, war das Konzert der historischen Bedingungen, waren auch die stummen Signale der bloßen Möglichkeiten, war das Zugleich von Solist und Orchester, der große Akkord sozusagen. Die Therapie konnte diese Neugier nicht befriedigen. Also ging Peter Brückner an die Hochschule. Er nahm einen Ruf der TU Hannover an und lehrte dort Psychologie; in seinen letzten Jahren bemühte er sich, zusätzlich die Venia legendi für Soziologie oder Politische Wissenschaften zu erlangen, was aber nicht glückte. Das Studium von Lebensgeschichten wollte er auch als Professor mit dem Studium von Geschichte verbinden, er wollte eine Qualifikation nicht nur für das Lesen in der Seele, sondern auch für das Lesen im Buch der Gesellschaft vorweisen können. Was sich institutionell dann nicht durchsetzen ließ, hat er als Autor und Lehrer auf eigene Faust probiert: die Psyche war für ihn in seinen Vorlesungen und Analysen immer auch Politikum und das politische Leben nie frei von subjektiven Impulsen. Er hielt an der ›Spannung‹ fest und hielt sie in sich aus – seine Autobiographie der Jahre 1923 bis 1945, Das Abseits als sicherer Ort, ist dafür ein sprechender Beleg.
Sie spricht vor allem in den ersten drei Kapiteln sehr deutlich von der Anstrengung, die es kostet, »das Rätsel der Geschichte« mit dem der Lebensgeschichte so zu verknüpfen, daß eins sich aus dem anderen auch dann herauslesen läßt, wenn das Ergebnis schaudern macht. »Eine Jugend im Faschismus«, hat Peter Brückner gesagt, »bleibt immer eine Jugend.« Aber sie bietet dem Heranwachsenden ihren eigentümlichen Entwicklungsreiz: den Schrecken. Seine Abwehrschlachten gegen die mehr oder weniger subtilen Versuche von Faschisierung, welche die Kinderjahre prägten, haben Brückner ein unstillbares Mißtrauen gegen alle Formen von Herrschaft mitgegeben. Als er jung war, durfte er nicht einmal den eigenen kindlichen Freuden am Wandern und Wichtigtun trauen; als er älter war, blieb Beobachtung und Selbstbeobachtung im Sinne eines experto credite sein Los. Er hat den Deutschen nie weniger als das Schlimmste zugetraut.
Man weiß, daß Peter Brückner zu jenen Hochschullehrern zählte, die der Studentenbewegung 1967 ff. nicht nur mit Sympathie zur Seite standen, sondern ihr mit ungeteilter Zustimmung folgten bzw. voranschritten. Brückner hatte ein spontanes Verständnis für die Fundamentalkritik der jungen Generation; in ihr wurden, fand er, jene radikalen Versuche eines Neuanfangs noch einmal lebendig, die nach 1945 von vielen erwartet, dann aber doch nicht unternommen worden waren. Daß nicht nur die Universität, sondern die Gesellschaft insgesamt: ihre Politik, ihre Moral, ihre Lebensformen zu erneuern seien, schien ihm völlig plausibel, und die Attacken der Studenten gegen die Ordinarienherrschaft, den Vietnamkrieg, die Restauration einer NS-belasteten Elite sowie den unerträglichen Spießer-Muff in Familien und Öffentlichkeit – all das fand er nicht nur gerechtfertigt, sondern unbedingt notwendig. Er hatte es lange erhofft und fühlte sich, als es in den 60er Jahren endlich so weit war, ganz in seinem Element: dem der theoretischen Kritik, des praktischen Experiments und des offenen Streits. Aber was ihn vor allem überzeugte, war dies: die Studenten der antiautoritären Ära protestierten nicht nur gegen die Ausplünderung der Dritten Welt durch die Erste, sondern auch gegen doppelte Moral in Sachen Sex. Sie verurteilten nicht nur illiberale Tendenzen in der deutschen Nachkriegsdemokratie, sondern auch Erziehungsgrundsätze, die fraglosen Gehorsam propagierten. Sie forderten nicht nur Mitbestimmung in allen Betrieben und Institutionen, sondern auch Wohngemeinschaften für Jugendliche und legalize pot. Sie wollten nicht nur Geschichte begreifen, sondern selbst eingreifen, nicht nur analysieren, sondern verändern, nicht nur wissen, welche die Bedingungen ihres Handelns seien, sondern auf diese Bedingungen wirken, das heißt handeln und zwar jetzt: Do it now! Sie wollten nicht mehr nur ein Schicksal haben, sondern sich eins machen. Mit einem Wort: die Spannung zwischen Vielheit und Einzelheit, zwischen Zeit und Augenblick, Welt und Mensch, Geschichte und Lebensgeschichte, sie war wieder da, sie war sogar, in den gloriosen Monaten der Jahre 1967/68, alles andere als anstrengend oder zermürbend, sie war plötzlich etwas ganz Leichtes und Wunderbares, war ein Medium von public happiness. Der Einzelne war nicht mehr zur Passivität verdammt, weil Teil eines Ganzen, an dem sich rütteln ließ, und das Ganze nicht notwendig das Falsche, weil gestaltbar von vielen aktiven Einzelnen. Das Abseits wurde zum weiten Feld und dadurch auf eine erregende Weise unsicher, die Rebellion wurde Klima und damit allgemein. Die Zeit des Studentenprotests gab Peter Brückner endlich nach vielen Jahren der nur punktuellen oder vergeblichen Kritik an einem bedrückenden, aber übermächtigen Status quo ein neues, ermutigendes Umfeld für die Betätigung seines aufrührerischen, unbescheidenen, spannungserprobten Geistes. Er nutzte sie weidlich.
Die späten 60er und 70er Jahre, das war eine Zeit der Renaissance des Marxismus, die damals die Terminologie des Protests nachhaltig färbte. Wenn man das weiß, wundert man sich nicht mehr so sehr über einige Wortungetüme, die der sonst so lebhaften und farbigen Prosa des »Abseits«-Buches immer wieder eine fast apokryphe Schwere verleihen. Wie selbstverständlich finden sich großmächtige Kategorien wie »Objektivität« – und dann auch noch: »Überhang an Objektivität« –, »Abstraktion« – und dann auch noch: »behütende Abstraktion« –, »Affirmation«, »Subsumtion« in einem Text, der eine Kindheit schildert und von nächtlichen Ausreißereien, Ängsten, Spielen und typischen Rätseln der biographischen Frühzeit berichtet. Diese scheinbar deplazierten analytischen Begriffe – sie alle stammen aus der Marxismus-Diskussion dieser Jahre – haben sich aber nicht zufällig in die Beschreibung einer Jugend im Faschismus verirrt, sie dienen, so unanschaulich und herrisch sie manchmal erscheinen, als Ausweis für den Versuch, bei dieser biographischen Selbstvergewisserung die Klammer zwischen Lebensgeschichte und Geschichte, Besonderem und Allgemeinen, Psyche und Gesellschaft zu schließen, bzw. am Aufspringen zu hindern. Was soll uns die Theorie – die soziologische, die marxistische, die ›kritische‹ – wenn sie dem, der sie sich erwirbt, keine Angebote macht, mit seiner eigenen Vita sozusagen als Prüfer ihres Wahrheitsanspruchs aufzutreten? Was soll uns umgekehrt die Konzentration auf das Naheliegende, das »Eigene«, wenn doch die überall spürbare Fremdbestimmung nur abzuschütteln ist mittels einer historisch wohlbegründeten Parteilichkeit? Was soll uns am Ende die bloße Versenkung unter den eigenen Seelenspiegel, wenn all die Dämonen, die dort hausen, von viel weiter herkommen, als unsere Erinnerung und die Zeit unserer Existenz zurückreichen? Wenn man etwas verstehen will, von sich selbst und von der Zeit, in der man lebt, muß man das eine im anderen spiegeln lernen und das enigmatische Bild, das so zustande kommt, mit viel Geduld und Feinarbeit, aber auch mit Energie und Intuition, zu entziffern suchen. Alles andere führt in die Täuschung.
Ich frage mich oft, wie wohl Peter Brückner unsere heutige Zeit, die 90er Jahre, die das Ende der Sowjetunion, der DDR und der Blockkonfrontation gebracht und der Welt ein wiedervereinigtes Deutschland beschert haben, erleben und beurteilen würde. Ob diese veränderte Lage sein Vertrauen in die Geltung von Großtheorien wie etwa des Marxismus erschüttert hätte? Ich stelle dann fest, daß diese Frage nicht richtig sitzt, weil Peter Brückners Vertrauen in die Macht alles erklärender Theorien immer schon von Skepsis getrübt war und seine Aufforderung, Lebensgeschichte im Spiegel von Geschichte zu betrachten, nicht die Großtheorie, sondern die wirkliche Geschichte meinte. Aber was ist wirkliche Geschichte? In einem Seminar für Studienanfänger hat Brückner seinen Hörern einmal empfohlen, keiner Deutung und keiner Theorie Glauben zu schenken, an deren Wirklichkeitsgehalt ihr eigener Augenschein sie zweifeln lassen müsse. Andererseits sprach er oft davon, daß die kleinen Zufälle des Alltags – »das, was einem so zustößt« – nicht schon Lebensgeschichte seien, daß dazu mehr gehöre: ein Horizont von »Bedingungen«, die übermächtig, das heißt nicht oder schwer verfügbar sein können. Wer genau wissen will, was es mit dieser doppelten ›Warnung‹ auf sich hat, lese Das Abseits … sehr aufmerksam: er wird dann das Beispiel dafür finden, daß »die Verhältnisse« ein Leben nicht nur ›beeinflussen‹, sondern es formen und zerstören können und daß umgekehrt ein lebendiger Mensch die Verhältnisse, wenn sie ihn bedrängen und bedrohen, herauszufordern lernt und sie so auch ›macht‹.
Ich glaube nicht, daß Peter Brückner heute zu jenen gehören würde, die erlöst vom Ende der Utopien, der Ideologien und der Geschichte sprechen und damit meinen, daß es genüge, wenn man den status quo beschreibt. Er würde auch jetzt auf der ›Spannung‹ (zwischen Geschichte und Lebensgeschichte) bestehen als einem heuristischen Instrument, um sich im Leben und in der Zeit zurechtzufinden; er würde ihren Sinn und ihre Voraussetzungen vielleicht anders formulieren – aber der heute zeittypischen Aufforderung zur Abkehr von allen Versuchen, die Welt als ganze zu sehen und stattdessen relativ, partikular und »objektiv« zu denken, würde er mit Sicherheit nicht Folge leisten. Denn täte er das, würde er ja zum Verräter an seiner eigenen Losung: »… der Reflexion vertrauen, solange sie Erfahrung und Objektivität fühlbar vermittelt«. Und wenn sie das nicht mehr kann, die Reflexion, wenn sie versagt oder nachprüfbar trügt? Dann muß man sie selbst reflektieren, sie erneuern und schärfen. Das ist ohnehin unerläßlich. Ohne sie auskommen aber – das ist unmöglich.
Es gelang Peter Brückner am Schluß seines Lebens nicht, die begehrte Venia legendi für Soziologie zu erhalten – er blieb formell Psychologe, ein Fach, dessen Erkenntnismöglichkeiten ihn immer weniger reizten. Vielleicht, weil das Rätsel, das eine Lebensgeschichte aufgibt, immer irgendwie gelöst wird – und sei es durch Tod oder Vergessen. Die Rätsel der Geschichte aber bleiben da, sie häufen sich auf und wuchern – sie wachsen zu Bergen, und daß die junge Generation von heute manchmal glaubt, sie brauche diesen Berg nicht abzutragen, sondern könne einfach drüberklettern – das hätte Brückner als einen tragikomischen Irrtum aufgefaßt, den er mit seiner typischen mehrdimensionalen, von Ironie und mannigfachen Anspielungen blitzenden Redeweise versucht hätte, aufzuklären. Er hätte vielleicht gesagt:
Die Anstrengung, Geschichte und Lebensgeschichte als Einheit zu fassen, scheint heute, wo wir uns von der Vorstellung trennen, daß die Geschichte Gesetzen gehorcht, zu groß. Wo alles chaotisch wird, kann man nichts mehr aufeinander beziehen, man will sich nur noch hindurchretten. Aber damit überläßt man »den Verhältnissen« das Feld und unterwirft sich ihrer wie immer ›wilden‹ Bewegung. Man gibt jeden Anspruch auf Gestaltung von Geschichte auf – und damit auf Gestaltung der eigenen Lebensbahn. Auch wenn wir keine Gesetzmäßigkeit mehr erkennen können, nach der Geschichte sich vollzieht, so kennen wir doch Gesetze, unter deren Schutz Lebensgeschichten sich entwickeln sollten. Was tun wir, um diese Gesetze zu kritisieren, zu verbessern, zu vervollkommnen und zu verteidigen? Oder, anders gefragt, rütteln wir nicht schon an den Verhältnissen, wenn wir alles tun, um unsere menschengemachten Gesetze zu vervollkommnen und zu verteidigen, verschlingen wir nicht auf diese Weise die beiden »Rätsel« aufs Neue zu einem? Für sich ist keines der beiden Rätsel lösbar; es sieht nur manchmal so aus – um so schlimmer, denn dann handelt es sich um Trug. Wenn es denn so sein sollte, daß auch das verschlungene Rätsel unlösbar bleibt, so dürfte man doch die Mühen des Verschlingens – oder des Projizierens, des Ineinander-Spiegelns – nicht scheuen, denn schon die Formulierung dieses komplexen Rätsels verhilft uns zu größerem Erkenntnisgewinn, als es selbst die (immer nur scheinhafte) Lösung der je einzelnen vermöchte. Gerade wenn Geschichte wegen ihrer Unabsehbarkeit Angst macht, muß sie als Folie und Gegenstand von Lebensgeschichte begriffen werden – sonst kommt womöglich wieder etwas dabei heraus, was hinterher niemand gewollt und von dem niemand gewußt hat.
Barbara Sichtermann
Ouvertüre
Im Jahre 1923 entschließen sich einige deutsche Länderregierungen, die NSDAP zu verbieten, weil sie die »verfassungsmäßig festgestellte republikanische Staatsform des Reichs« diffamiere (§8,1 des Gesetzes zum Schutz der Republik). Auch das Land Sachsen spricht einen Schutz aus, aber die »Diffamierung der Staatsform« bleibt. Die Landeshaupt-, Kunst- und Pensionärsstadt Dresden, Elbflorenz, wird, während der Wert des US-Dollars von 21 000 Mark im Januar 1923 auf über 48 Millionen Mark im Oktober steigt, von den Savonarolas rechtsradikaler Kampfbünde und faschistischer Vereine beunruhigt.
Diese deutschen Savonarolas haben, was in Europa sonst seltener wird, gleich en masse einen Instinkt für die Wahrnehmung von kleinsten Zeichen der Differenz in der menschlichen Physiognomie, was »abweicht«, was fremdartig anmutet, ist schon als Unwert erkannt. Wo sie wahrnehmen, denunzieren sie schon. An irgendeinem Tag verläßt ein Ehepaar, den einjährigen Sohn im hochrädrigen Kinderwagen, das Café Rumpelmayer. Eine Rotte von Faschisten drängt die Frau vom Gehsteig: »Judensau!« Der Kinderwagen wird ihr aus der Hand gerissen, der Ehemann vollständig übersehen und behandelt, als gehöre er nicht dazu. (Er sieht aus wie ein sächsischer Ingenieur, was er auch ist; daß er Kindheit und Jugend in den USA verbracht hat, als ältester Sohn des Großmeisters der Loge zu den drei Weltkugeln, und selbst bis 1917 Freimaurer war, geht erst viel später in die Akten des neuen Reiches ein.)
Judensau? Nach den Typensuchregeln der völkischen Denunziation sieht die Weggestoßene »jüdisch« nicht aus. Eher polnisch. Jedenfalls ist sie nicht von hier. Ihre Haare sind blauschwarz. Das Gesicht: slawisch geschnitten, mit breiten Backenknochen. Sie ist gebürtige Engländerin. Schon die Großeltern waren ehrenwerte Mitglieder der High Church, voll anglisiert, aber in der Tat: Juden. Das Genie des deutschen Volkstums liegt im Spürsinn für die fremde Rasse. Diese jungen Genies, Garanten der Zukunft, waren 1923 mit germanischen Runen und Symbolen geschmückt, denen gegenüber schon das Latein des Tacitus europäische Moderne war.
Der Einjährige rutscht mit dem Kinderwagen ins Abseits. Obwohl sich seine rassische Minderwertigkeit später verheimlichen läßt (lange Jahre auch vor ihm selbst), bleibt das Kind als Produkt einer atypischen Familie immer vom normierenden Zugriff der staatlichen Ordnungsmächte bedroht. Als der geborene Dissident ist es zugleich vor der eigentlichen Katastrophe dieses Kulturvolks behütet: vor der Faschisierung. Das Abseits ist, was den Nationalsozialismus angeht, in Deutschland der einzig sichere, ja, der einzige glückliche Ort.
1922–1932
Ich wurde im Mai 1922 geboren; die ersten 16 Monate lebte ich in Wohnungen, die nicht die meines Vaters waren, und zeitweise – im Hotel.
1924: Märzschnee in einem Villengarten, das Dienstmädchen, das mich auf die Mauer zur Straße setzt und mir die Tabakspfeife meines Vaters überläßt; Freunde, die ein offenes Auto haben, ein Daimler-Cabriolet, ich war gut zwei Jahre alt. Wir wohnen im ersten Stock. 1930, im zweiten Schuljahr, ist die Adresse schlechter, der Wohnraum beschränkt, aber noch Beletage. Aus dem Speisezimmer blicken wir auf eine weiße Privatklinik mit dünnem Park. Ab und an, wenn meine Eltern abwesend sind, sieht die Frau des Hausmeisters nach mir. Ostern 1932 gehe ich zur Höheren Schule, Realgymnasium Seevorstadt; mein (Halb-)Bruder Armin, zwei Jahre älter, besucht noch das vornehmere Vitzthum’sche Gymnasium. Wir wohnen inzwischen im Erdgeschoß; gegenüber: ein großes Bierlager, eine Dienststelle des städtischen Wohlfahrtsamts und ein Polizeirevier.
Das Herrenzimmer, das es als dritten Raum noch gibt, wird bald an einen Handlungsreisenden vermietet.1
Im Mai 1932 war ich für wenige Tage Nationalsozialist. Jedenfalls kam ich eines Mittags nach Hause, mein Vater war viel zu Hause, weil arbeitslos, und berichtete stürmisch, »Wir« (das heißt die Sexta) seien jetzt alle Hitlerjungen. Ich wurde unterbrochen: die ganze Klasse? Das brachte mich kurz: zum Erröten, denn ich wollte antworten: Nein, nur die besten (Schüler), aber da ich einer der schlechtesten war im Herbst 1932 der 44. unter 46 Jungen, hätte ich gestehen müssen, daß die neue Bewegung an mir vorbeiging. (Nur zu Hause war ich Nazi.) So redete ich lieber weiter in meiner Begeisterung: Sobald »wir« die Macht ergriffen haben, gibt es für uns Geld und Essen genug. Ihr habt dann ausgesorgt. Aber nur ihr. Die Lehrer gerade nicht – in der Schule werden sie ganz blaß, wenn wir von Hitler reden.
Die Phantasie des Zehnjährigen, der von Hitler nur auf der Straße und in der Schulpause gehört hat, spiegelt gewisse Momente des Nationalsozialismus getreu: den räuberischen Charakter (Geld für uns, nicht: Klassenmacht), die Gaunergemeinschaft (»wir«), das antiautoritäre, rebellische Element (die Lehrer, das heißt für ein Kind: zentrale Inhaber von institutioneller Gewalt, ängstigen sich), die Attraktivität der »Bewegung« für Heranwachsende, und zwar für die Besten, das hieß für mich damals: die Schüler mit großem Sozialprestige. Und der Marginalisierte, der ich damals ansatzweise war, schluckt die Kränkung, die darin liegt, daß man ihn ausschloß, und identifiziert sich mit der »Macht«.
Meine Eltern, gebildeter Mittelstand am Rande der Verarmung, verhielten sich untypisch. Ich habe das bedrückte Schweigen nicht wieder vergessen, das meiner Eröffnung folgte, nicht den Anblick meines Vaters, der mich an sich zog, ein zärtlicher Mann; und diese Geste fürsorglicher Wärme war eine Antwort. Ich »wußte« von diesem Augenblick an, was Hitler, was der NS-Staat bedeutete.
Freilich: So wie Kinder Unausgesprochenes wissen; nicht als Kenntnis, die jederzeit reproduzierbar ist, und das »nie wieder vergessen …« schloß auch die Möglichkeit ein, über lange Zeiten hinweg gar nicht daran zu denken.