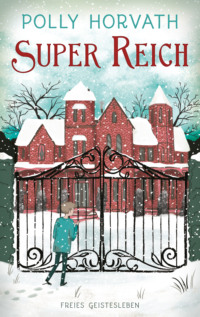Loe raamatut: «Super reich»
POLLY HORVATH
SUPER REICH
Aus dem Englischen von Anne Brauner

INHALT
DER IRRTUM
EINE EINLADUNG ZUM ABENDESSEN
DIE SPIELE
EINE LETZTE FRAGE
DER PLAN
SCHWEBEND
DIE ZEITMASCHINE
CONEY ISLAND
FREDDY UND DELIA
TANTE HAZELNUTS SCHMUCK
ENTFÜHRT
NEUE LEBEN
DER ANZUG
DER PRÄSIDENT
IM VERBORGENEN
EIN FREUND
ÜBERRASCHUNG
FÜR
ARNIE, EMILY, ANDREW,
ZAYDA, BONNY UND MILDRED
DER IRRTUM
Rupert Brown wohnte mit seiner großen Familie in einem sehr unscheinbaren Häuschen am Stadtrand von Steelville in Ohio. Rupert hatte so viele Brüder und Schwestern, dass es sich anfühlte, als würde er in einem eigenständigen kleinen Staat wohnen. Sie krabbelten über die Möbel, sie rannten hinein und hinaus. Sie waren groß und klein, Jungen und Mädchen – mit hellbraunem Haar, einer spitzen Nase, hohen Wangenknochen und schmalen Lippen. Sie waren alle dünn.
Die Browns hatten so viele Kinder, dass Mrs Brown behauptete, sich die Namen nicht mehr merken zu können. Meistens sprach sie ihren Nachwuchs mit «Hey du» an. Es gab Geschwister, die Rupert kaum kannte und mit denen er nur selten redete. Innerhalb der Familie mit ihren vielen Geheimnissen und getrennt voneinander verlaufenden Werdegängen wurden die verschiedensten Bündnisse geschlossen. Wenn man dicht aufeinanderhockt, muss es noch lange nicht gemütlich sein. Zeitweise ist es einfach nur eng.
Mit zehn Jahren lief Rupert so unauffällig in seiner Familie mit, dass ihm höchstens seine sechsjährige Lieblingsschwester Elise Beachtung schenkte. Sie waren beide still und schüchtern und gaben sich große Mühe, den anderen aus dem Weg zu gehen.
Kurz vor Weihnachten brachten Ruperts große Brüder John und Dirk eine Katze mit nach Hause. Da sie häufiger Katzen klauten, hegte niemand einen Zweifel daran, dass auch dieses Tier keine Streunerin war. Vielleicht entführten die Brüder sie, weil sie sich heimlich nach einem Haustier sehnten, wenn sie auch behaupteten, nur ihren Spaß haben zu wollen.
«Fangen und freilassen. Wie beim Fliegenfischen, nur mit Katzen», erklärte John, als er die neue Katze hochhielt, um sie seiner Mutter zu präsentieren. Er sah sie so wehmütig an, dass Rupert überlegte, ob er darauf hoffte, die Mutter würde sich in das Tier verlieben und ihnen erlauben, es zu behalten.
«Habe ich euch nicht gesagt, ihr sollt damit aufhören!», kreischte Mrs Brown, die gerade von der Arbeit gekommen war. Sie putzte Büros im Stahlwerk.
Sie marschierte durchs Zimmer, packte die Katze und schleuderte sie in den Hinterhof. Dann knallte sie die Tür zu.
Elise sah besorgt aus dem Fenster. «Die Katze liegt reglos da», flüsterte sie Rupert zu, als er sich neben sie stellte.
«Ich sehe mal nach ihr», flüsterte er zurück. Ihre Mutter war in die Küche gegangen, um den dünnen Haferschleim zu kochen, den sie ihnen mit den Essensresten anderer Leute, die der Vater täglich auflas, üblicherweise zum Abendessen servierte.
Alle Kinder der Familie Brown waren auf der Hut vor ihrer Mutter. Sie schlug gerne einmal zu. Oder sie nahm beim Fernsehen eins der jüngeren Kinder auf den Schoß und knuddelte es, als würde diese liebevolle tröstliche Person ihr wahres Ich verkörpern. Da man nie wusste, welche Mutter aus ihr herausbrechen würde, war Vorsicht geraten.
Draußen war es kalt und Rupert graute es, als er zu der Katze schlich. Was, wenn sie verletzt war? Was sollten sie dann mit ihr anstellen? Seine Mutter würde ihr mit Sicherheit nichts zu essen geben und hatte auch kein Geld für einen Tierarzt. Doch Rupert konnte das Tier nicht einfach seinem Schicksal überlassen, oder? Musste er die Katze am Ende selbst töten, um sie zu erlösen? Er hatte keine Ahnung, wie man so etwas machte. Und wenn er der Katze helfen und gleichzeitig seine Mutter von ihr fernhalten musste? Und wenn sie nun schon tot wäre, was dann?
Gerade als er nah genug dran war, um zu sehen, dass sie noch atmete, fuhr ein Polizeiwagen die Straße hinauf und hielt vor dem Haus der Browns. Während Rupert über der Katze kauerte, konnte er beobachten, wie die Wagentüren geöffnet wurden und zwei Polizisten ausstiegen und zur Tür gingen. Oh nein, oh nein! Sie wollten bestimmt seine Brüder verhaften. Wenn sie die Katze fänden, würden sie dann alle drei mitnehmen, John, Dirk und ihre Mutter, die Katzenquälerin?
Als Rupert die Hände nach der Katze ausstreckte, blickte sie ihn erschrocken an, rappelte sich mühsam auf und humpelte über den Hof. Bei dem Sturz hatte sie sich offenbar am Bein verletzt. Rupert lief ihr nach, um ihr zu helfen und sie gleichzeitig vor den Polizisten zu verstecken. Er hob sie hoch und trug sie zu dem leeren Werkzeugschuppen in der Ecke, als die Hintertür geöffnet wurde. Dirk und John rannten hinaus, sprangen über den Zaun und rasten über das Nachbargrundstück.
«Ich komme gleich wieder», flüsterte Rupert der Katze zu, bevor er still und unauffällig ins Haus ging.
«Was fällt Ihnen ein!», hörte er seine Mutter an der Haustür sagen. «Uns Tag und Nacht wegen irgendwelcher Katzen zu belästigen.»
«Mrs Fraser hat ausgesagt, sie hätte genau gesehen, wie Ihre Söhne sich die Katze geschnappt und mit ihr weggelaufen sind», sagte einer der beiden Polizisten mit müder Miene.
«Bitte schön, durchsuchen Sie das Haus!», schrie Mrs Brown. «Stellen Sie die Hütte auf den Kopf und suchen diese Katze. Viel Glück!»
«Wollen Sie damit sagen, dass Sie die Katze freigelassen haben?», fragte der andere, der genauso erschöpft aussah. Sie hatten beide müde, unglückliche Polizistenaugen. So sahen Menschen aus, die alle traurigen Varianten menschlichen Fehlverhaltens kannten, und gesehen hatten, was für schreckliche Dinge die Leute einander antaten, und gleichzeitig wussten, dass sie trotz aller Müdigkeit und Traurigkeit weiterhin an Türen klopfen und für Ordnung sorgen mussten.
Elise nahm Ruperts Hand. Er drückte sie, als plötzlich Mr Brown mit einer großen Tüte Küchenabfälle an der Veranda auftauchte.
«Schon wieder die Bullen?» Er drängte ins Haus, wo es nur wenig wärmer war als draußen. «Möchten Sie einen halb aufgegessenen Taco?», fragte er einen der beiden Polizisten übertrieben gastfreundlich und kramte in der Tüte mit Möhrengrün und fast leeren Chipstüten. «Er muss hier irgendwo sein. Ist noch fast das ganze Fleisch drin.»
«Nein, danke.» Der andere Mann hob die Hand. «Ich habe gerade gegessen.»
«Ein Stückchen Twinkie-Cremeküchlein?»
«Nein, echt nicht.»
«Ich hätte noch eine Flasche Blaubeersirup. Den hat wohl einer probiert und ihm hat’s nicht geschmeckt», sagte Mr Brown.
«Darauf schwimmt schon Schimmel», sagte der Polizist.
Mr Brown schraubte die Flasche auf und trank einen Schluck. «Bisschen herb!»
«Zu ihren Söhnen, Mr Brown.» Der Polizist startete einen neuen Versuch.
Als Mrs Brown die beiden Polizisten vernichtend ansah, tauschten sie einen Blick. Sie nahmen ihre Umgebung genau wahr: die abgewetzten Möbel, die schmutzigen Kinder in ihren verdreckten Lumpen, die Eiseskälte im Haus, Elises und Ruperts verängstigte Mienen – die anderen Kinder waren nacheinander die Treppe hochgeschlichen, nur fort von der Polizei und dem Zorn ihrer Mutter.
«Wir möchten uns kurz mit ihnen unterhalten, Mrs Brown», sagte der eine Polizist. «So geht’s nicht weiter. Jeder weiß, dass Ihre Söhne Katzen entführen. Wir sollen durchgreifen, fordern die Leute.»
«Klar. Wetten, dass all diese Leute ihre Katzen zurückbekommen haben?», sagte Mrs Brown. «Die Leute lassen ihre Katzen durch die Stadt streunen, wo sie in anderer Leute Hinterhöfe schleichen, aber deswegen werden weder die Katzenhalter noch die Katzen verhaftet. Wenn man seine Katze auf die Straße lässt, muss man sich nicht wundern, wenn sie hin und wieder verschwindet, würde ich sagen. Ihr piesackt immer die Armen, ihr taucht hier auf und brandmarkt meine Söhne als Diebe, obwohl ihr es nie beweisen könnt, stimmt’s? Wieso nutzt ihr eure Zeit nicht dafür, echte Truthähne für die Weihnachtsgeschenkkörbe ranzuschaffen statt unschuldige Bürger zu belästigen? Das wäre wirklich sinnvoll, das wäre Dienst an der Bevölkerung. Jedes Jahr das Gleiche: Wir bekommen einen Korb, der sich Weihnachtstruthahnkorb schimpft. Aber wo bleibt der Truthahn, frage ich mich. Es handelt sich ja wohl eher um ein Hühnchen, nicht mal um ein Brathähnchen.»
«Ma’am, sie heißen einfach Weihnachtstruthahnkörbe, weil … also, weil man sie schon immer so genannt hat. In einigen Körben sind Truthähne, in anderen Hühnchen. Es kommt auf die Spenden an. So, und wo sind jetzt Ihre Söhne?»
«Woher soll ich das wissen?», fragte Mrs Brown.
«Sie sollen sich vorsehen, richten Sie ihnen das aus», erwiderte der Polizist. Er zuckte sichtlich resigniert die Schultern. «Wenn Mrs Fraser die Katze zurückbekommt, drücken wir diesmal noch ein Auge zu. Beim nächsten Mal nehmen wir Ihre Söhne mit.»
«Mache ich, kein Problem», sagte Mrs Brown. «Wenn Sie Beweise hätten, säßen sie längst im Bau. Ich bin doch nicht von vorgestern.» Mit diesen Worten schlug sie den Polizisten die Tür vor der Nase zu.
Nachdem sie abgefahren waren, flüsterte Elise: «Wie geht’s der Katze?»
«Sie hinkt», antwortete Rupert ebenso leise, ohne nachzudenken.
«Sie hinkt!», rief Elise entsetzt.
«Wer hinkt?», bellte Mrs Brown und sah sie mit einer wahrhaft fürchterlichen Miene an.
«Die Katze», flüsterte Rupert.
«Wo?»
«Im Werkzeugschuppen», wisperte er und wich an die Wand zurück.
«Dann sieh zu, dass du sie los wirst!», kreischte Mrs Brown.
«Eure Mutter ist hart wie ein Stein», sagte Mr Brown und prustete vor unterdrückter Freude über seinen eigenen Scherz. «Kennt ihr ihr Geheimnis? Sie hat keine Gefühle! HAR HAR HAR!» Er krümmte sich vor Lachen.
«Sie hat ihre Wut gut im Griff», murmelte Dirk, der mit John durch die Hintertür zurückkam.
Mrs Brown warf den beiden einen derart vernichtenden Blick zu, dass Mr Brown sein schallendes Gelächter hinunterschluckte und den Fernseher einschaltete. Als John und Dirk sich zu ihm auf das schäbige Sofa setzten, schlichen auch die anderen Kinder langsam wieder die Treppe herunter.
Mrs Brown machte sich auf den Weg zur Küche, um die mitgebrachten Abfälle zu begutachten. Als sie an Elise vorbeikam, die wegen der verletzten Katze und dem Besuch der Polizisten leise weinte, fauchte sie: «Aufhören!»
Elise steckte den Daumen in den Mund. Obwohl sie zu alt zum Daumenlutschen war, landete er manchmal dort, wenn ihre Mutter in der Nähe war.
Rupert ging nach draußen und fand die Katze im Werkzeugschuppen vor, wo sie ihre Vorderpfote ableckte. Er nahm sie auf den Arm und ging zum Haus der Frasers, das zehn Blocks entfernt lag. Der Weg erschien ihm grauenvoll, weil er jeden Moment damit rechnete, dass der Polizeiwagen um die Ecke bog. Wenn die Polizisten ihn sahen, würden sie glatt ihn des Diebstahls beschuldigen. Rupert hatte solche Angst davor, dass er zweimal beinahe umgekehrt wäre, doch letztendlich fürchtete er sich noch mehr vor seiner Mutter. Zum Glück begegnete er niemandem außer einem Mann, der aus dem Bus stieg und mit dem Heimweg beschäftigt war, ohne einen Gedanken daran zu verschwenden, was ein Kind der Browns mit einer Katze machte.
Vor dem Haus der Frasers setzte Rupert die Katze behutsam ab und wollte sie so lange beobachten, bis sie sicher zur Tür gehumpelt war. Doch die Katze löste zwar nicht unbedingt eins ihrer neun Leben, aber doch wenigstens eine ihrer neun wundersamen Genesungen ein, denn sie hinkte nun überhaupt nicht mehr, sondern rannte von Rupert fort, so schnell ihre Pfoten sie trugen.
Rupert fand das beruhigend, befürchtete jedoch gleichzeitig, die Katze könnte sich bis in alle Ewigkeit vor den Menschen fürchten. Möglicherweise hatte seine Familie ein Ungeheuer aus ihr gemacht, das jeden kratzte oder anfauchte, der ihr zu nahe kam. Sorgenvoll machte er sich auf den Heimweg.
«Hast du die Katze zurückgebracht?», fragte Elise, die an der Haustür auf ihn wartete.
«Ja, es geht ihr gut, sie hinkt nicht mehr. Geh», drängte er leise, denn seine Mutter kam gerade vom Spülen aus der Küche und ließ den Blick schweifen, ob es nicht jemanden gab, den sie zusammenstauchen konnte.
Elise lief nach oben zu ihrem Bett.
«Wieso hat das so lange gedauert?», fragte seine Mutter. «Wir haben schon gegessen.»
Es gab nie genug für alle. Wenn das Essen fertig war, schlangen sie es umstandslos hinunter. Die ganze Familie war ständig hungrig, doch da er jetzt auch noch das Abendessen verpasst hatte, fühlte Rupert sich, als sei er kurz vorm Verhungern. Wie lange konnte man auf diese Weise hungern, überlegte er, während er sich zum Bett schleppte, bevor der Körper seine eigenen Knochen fraß? Nach dem Einschlafen träumte er die ganze Nacht davon, knochenlos über den Boden zu huschen.
Am nächsten Morgen wartete Rupert vor der Schule auf Elise, die später loslief als Rupert, der gerne zu früh da war. Als sie näherkam, sagte er: «Sollen wir es doch noch mal versuchen und uns beim Gratis-Frühstück anstellen?»
«Ich habe zu viel Angst», antwortete Elise.
«Ja, ich auch», sagte Rupert und lehnte am Eingang, bis es schellte. Elise rannte zu ihrem Unterrichtsraum, der in einem anderen Flügel lag,
Hungernde Kinder konnten ein Gratis-Frühstück bekommen, doch er nahm an dieser Maßnahme nicht teil, weil die Frau an der Essensausgabe die Browns ebenfalls nicht leiden konnte. John und Dirk hatten ihre Katze gestohlen und sie erst nach drei Tagen zurückgegeben. Das verzieh sie ihnen nie. Ihrer Meinung nach waren alle Browns vom gleichen diebischen Schlag. Als Rupert es tatsächlich einmal gewagt hatte, sich für ein kostenloses Frühstück anzustellen, hatte sie ihm einen bösen Blick zugeworfen, der ihn bis ins Mark erschütterte. Er hatte es seitdem nie mehr versucht, und seine Brüder und Schwestern auch nicht.
Da Rupert so dünn war, hätte er vor Gesundheit geradezu strotzen müssen. Die Ärzte behaupten schließlich, Dünnsein sei gesund, am allergesündesten sogar. Wenn es nach ihnen ginge, sollten alle Menschen zwei Tage in der Woche fasten, damit die schlechten Zellen abstarben und die guten sich besser entwickelten. Doch Rupert, dünn wie er war, mit lauter guten Zellen und keinem Platz für schlechte, fühlte sich keineswegs gesund. Jeden Tag verzweifelte er auf dem Heimweg beinahe daran, es nach Hause zu schaffen, bevor ihm vor Hunger schwindelig wurde. Und wenn er endlich dort ankam, befürchtete er jeden Tag, auf der Stelle ohnmächtig zu werden.
Zuhause ging er dann ins Schlafzimmer, von denen es in ihrem Haus drei gab. Eins für die Jungen, eins für die Mädchen und eins für Mr und Mrs Brown. In den Jungen- und Mädchenzimmern schliefen die jüngeren Kinder in den Betten und die älteren darunter. Rupert teilte sich den Boden unter einem Bett mit John und Dirk. Nach der Schule legte er sich oft unter das Jungenbett und sammelte die nötige Energie, um sich zu dem Abendessen aus Haferbrei die Treppe hinunterzuschleppen. Die Mahlzeit verlieh ihm dann gerade genügend Kraft, um wieder hochzugehen und einzuschlafen. Das war sein Leben. Ein Leben, das von der Hoffnung geprägt war, sich nicht zum Gespött zu machen, indem er in Ohnmacht fiel.
Dann geschah es eines Tages doch. Er fiel tatsächlich in Ohnmacht, und zwar an einem Tag mit enorm viel Tiefschnee.
Wie üblich stand Rupert auf und machte sich auf den Weg zur Schule. Um dorthin zu gelangen, musste er von seinem Haus im Wohngebiet der Ärmsten der Armen am Stadtrand an den Schienen entlang und am Kraftwerk vorbeigehen. Dort standen nur verfallene Häuser. Weiter ging es durch das Viertel, deren arme, aber doch stolze Bewohner sich trotz ihres geringen Einkommens um ordentliche Rasenflächen und gekehrte Treppen bemühten. Als Nächstes passierte Rupert die Häuser der Mittelschicht mit sauber geschnittenen Hecken, Gärten und Fensterläden, hinter denen er sich nur glückliche, wohlgenährte Menschen vorstellte, und schließlich die prächtigeren Häuser der Reichen. Und kurz bevor er die Schule erreichte, ging er an den Villen der Superreichen vorbei.
Als Rupert sich auf den Weg machte, wunderte er sich, dass seine Mutter an diesem Morgen das karge, aus einem Löffel Haferbrei pro Person bestehende Frühstück nicht bereitgestellt hatte. Außerdem fiel ihm auf, dass noch niemand vor ihm Fußspuren im Schnee hinterlassen hatte. Er musste die Knie hochziehen und den tiefen, schweren, nassen Schnee durchqueren. Das war besonders lästig, weil er keine Stiefel, sondern nur Turnschuhe besaß, doch er wagte es nicht, auf der Straße zu laufen. Sie wurden nie gut geräumt, sodass die Autos andauernd auf der glatten Fahrbahn zusammenstießen. Da konnte man als Junge schnell überfahren werden, obwohl der Verkehr an diesem Tag fast zum Erliegen gekommen war, was auch höchst seltsam war.
Rupert dachte daran, aufzugeben und die Schule zu schwänzen, doch er wollte als Erwachsener etwas Besonderes werden. Was, wusste er noch nicht, aber ihm war klar, dass man ohne Schulabschluss nichts Besonderes zustandebrachte. Deshalb zwang er sich weiterzugehen und sagte sich beständig Man muss es nur wollen, es ist alles eine Frage des Willens. Als er sich unvermittelt hinsetzte, stürzte eine Schneewehe über ihm ein und der nasse kalte Schnee färbte seinen Nacken rot, weil er weder Schal noch Mütze hatte. Und auch keinen Mantel. Es musste reichen, die drei Hemden, die er besaß, übereinanderzuziehen, und darüber ein löchriges Sweatshirt. Das klappte ganz gut, bis es richtig kalt wurde. Dann hatte er nicht nur ständig Hunger, sondern fror auch noch ununterbrochen. Als er nun wieder aufstand, hatte er schon fast Frostbeulen und war sich wirklich nicht sicher, ob er noch einen einzigen Schritt weitergehen konnte. Doch die herrliche Aussicht darauf, gleich in der geheizten Schule sitzen zu können, trieb ihn weiter. Er musste nur noch um die Ecke biegen.
Doch hinter dieser Ecke waren keine Autos, keine Kinder, die sich eine Schneeballschlacht lieferten, kein Licht, kein Bus. Rupert sah zu seinem Entsetzen nur ein leeres Gebäude vor sich.
Er wusste sofort, dass er etwas falsch gemacht hatte.
Entweder ist Wochenende, dachte er, oder die Lehrer sind auf einer Fortbildung oder es ist Feiertag. Die Morgen erlebte Rupert so verschwommen in seiner ewigen Müdigkeit, dem ewigen Hunger, dass er zwar das Ausbleiben des Haferbreis bemerkt hatte, aber nicht, dass sonst niemand aufgestanden war. Tja, es half alles nichts, er musste umkehren und versuchen, weder in Ohnmacht zu fallen noch zu erfrieren. Alles eine Frage des Willens, sagte er sich erneut. Zumindest konnte er in seinen eigenen Fußstapfen zurücklaufen und musste den frisch gefallenen, reinen Schnee nicht mit seinen Turnschuhen entweihen. Das sparte ein wenig Energie, immerhin das. Rupert machte sich auf den Rückweg.
Zunächst kam er durchs Viertel der Superreichen mit seinen sieben Villen. Sie standen auf riesigen Grundstücken mit hohen Zäunen, Hecken oder Toren, die sogar Katzendiebe wie die Johns und Dirks dieser Welt abhielten. Hier waren nicht nur die Superreichen, sondern auch ihre Katzen in Sicherheit.
Als Rupert gerade eins dieser Tore passierte, schwang es auf, um ein Auto durchzulassen. Das Tor schwenkte direkt auf Rupert zu und eine verschnörkelte Eisenverzierung hakte sich in einem Loch seines Sweatshirts ein und hievte ihn hoch. In diesem Augenblick fiel Rupert in Ohnmacht. Das Tor schwang noch ein Stück weiter auf, sodass sein bewusstloser, daran hängender Körper gegen die Eisenstangen schlug. Bäng, bäng, bäng.
Rupert erwachte aus seiner Ohnmacht mit dem Gedanken, dass er zu allem Überfluss auch noch blaue Flecken bekommen würde, als das Auto durch das Tor fuhr und stehenblieb. Eine Frau steckte den Kopf aus dem Fenster und sah ihn unverwandt an.
«Baumelt da jemand am Tor, Billingston?», fragte sie.
«Ich glaube, Sie haben recht, Mrs Cook», antwortete Billingston, der Fahrer.
«Dann drücken Sie den Elektroschockknopf, dafür ist er schließlich da. Um ungeladene Gäste abzuschrecken.»
Und schon durchfuhr ein starker Stromstoß Ruperts kleinen, leicht ramponierten Körper. Er zuckte so heftig zusammen, dass er erneut mit Wucht gegen das Eisentor knallte, das sich kurz darauf schloss. Der Wagen fuhr mit Mrs Cook weiter, die froh war, dass damit solchen Streichen ein Riegel vorgeschoben worden war. Sicherheitshalber betätigte Billingston den Elektroschockknopf am Tor ein zweites Mal, bevor er davonfuhr. Diesmal wurde Rupert in die Luft katapultiert, flog über die vier Meter hohe Hecke und landete auf der falschen Seite. Also auf der Villenseite und dem verschneiten Rasen der superreichen Bewohner, genau da, wo ihn niemand haben wollte. Rupert rechnete jeden Moment damit, den klebrigen triefenden Speichel bösartiger Wachhunde auf seinem Körper zu spüren, und gleich darauf ihre scharfen Reißzähne. Wenn man sich auf das Schlimmste einstellte, das einem passieren konnte, das Schlimmste, das man sich überhaupt vorstellen konnte, geschah seiner Erfahrung nach normalerweise genau das. Deshalb wartete er geduldig darauf, gefressen zu werden. Seine Energie reichte nicht einmal mehr dafür aus, sich zu bewegen, geschweige denn zu kämpfen. Die Minuten vergingen. Kein Hund fiel über ihn her. Auch keine Katze. Die Leute hatten für Tiere wohl nicht viel übrig.
Rupert wollte sich gerade aufrappeln, als jemand sagte: «Wie bist du denn hierhergekommen?»
Das war Turgid Rivers, der reichste Junge in der ganzen Schule. Er war in der sechsten Klasse, eine über Rupert.
«Und du wohnst anscheinend hier», sagte Rupert schwach.
Turgid nickte.
«Schönes Haus», sagte Rupert.
Und fiel erneut in Ohnmacht.