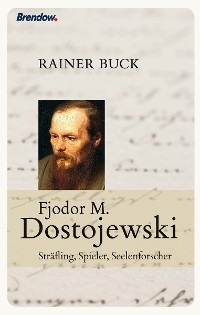Loe raamatut: «Fjodor M. Dostojewski»
Rainer Buck
FJODOR M. DOSTOJEWSKI
Sträfling, Spieler, Seelenforscher

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
ISBN 9783865065957
© 2013 by Joh. Brendow & Sohn Verlag GmbH, Moers
Einbandgestaltung: Brendow Verlag, Moers
Satz: Harfe PrintMedien, Bad Blankenburg
1. digitale Auflage: Zeilenwert GmbH 2014
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Prolog
Armenhospital, Landleben und Internate
Zerfall der Familie
Entkommen in die Literatur
„Der herrlichste Augenblick in meinem Leben“
Gegenwind
Zwischenbilanz
Im Kerker
Dem Tod ins Auge geschaut
Im Totenhaus
Hindernisreiche Rückkehr ins Leben
Liebe wird zum Verhängnis
Schwieriger Neuanfang
Polina – die „Femme fatale“
Auslandsreisen und Turbulenzen
Weitere Erschütterungen
Schuldsklaverei
Gestrandet in Wiesbaden
Schriftsteller unter Druck
„Verbrechen und Strafe“
Flucht ins Ausland
Sieben Wochen Hölle: Baden-Baden
Tragödie in der Schweiz
„Der Idiot“
Von Florenz ins Elbflorenz
„Die Dämonen“
Befreiung
Rückkehr nach Russland
Der goldene Lebensherbst
Dostojewskis Spätwerk
„Die Brüder Karamasow“
Die Puschkin-Rede
Abschied
Epilog
Bibliografischer Zettelkasten
Danksagung und nützliche Internetadressen
Prolog
Der junge Mann steht in der zweiten Reihe. Vielleicht eine Minute Leben bleibt ihm noch. Drei Pfähle sind auf der Mitte des Platzes errichtet. Die ersten Todeskandidaten sind dort bereits angebunden. Einer von ihnen, sein Kamerad Petraschewski, wehrt sich standhaft dagegen, dass ihm eine Kapuze übergestülpt werden soll. Das Erschießungskommando wartet.
Sein Blick ist jetzt auf die Kuppel der nahen Kirche gerichtet. Sonnenstrahlen spiegeln sich dort, der warme Goldton bildet einen bemerkenswerten Kontrast zu der Frische des klaren Wintermorgens. Dieses Schauspiel zieht die Augen des Delinquenten Fjodor Dostojewski an, während die letzten Gedanken seinem älteren Bruder Michail gehören, dem vertrautesten seiner Freunde.
Was noch tun in dieser einen Minute? Eine stumme Umarmung der neben ihm stehenden beiden Männer, von der Willkür zu letzten Weggefährten bestimmt. Vielleicht noch ein Gebet sprechen? Aber wozu, wenn man an dessen Sinn berechtigte Zweifel hegen muss? Sein Abgang aus dieser Welt würde im Grunde eine Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens sein: Es gibt keinen. Nicht wenn ein junger Mensch im Alter von 28 Jahren, noch vor kurzem als Genie und großer Hoffnungsträger der Literatur gepriesen, so einfach ausgelöscht werden kann – wegen sogenannter „revolutionärer Gedanken“, die nicht einmal die seinen sind, die er sich nur angeeignet hatte, weil er es gewohnt war, vieles zu durchdenken, in verschiedenen Schuhen zu wandeln. Das Leben wollte aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet werden, wenn es galt, die Tiefen der Existenz zu ermessen.
Nun ist sein Leben, sein Quantum Zeit auf dieser Erde, zerronnen. Könnte man doch noch einmal zurückgehen, noch einmal Freiheit atmen, souveräne Entscheidungen treffen, Pläne schmieden, Bekanntschaften schließen. Es gäbe noch so vieles zu denken, zu tun, zu schreiben!
*
Was sich da am 22. Dezember 1849 auf dem Semjonow-Platz in Sankt Petersburg abspielte, war eine grausame Komödie, die einen der 15 zum Tode Verurteilten sogar für immer in den Wahnsinn getrieben hat. Uns wurde das Todesurteil verlesen, man gab uns das Kreuz zum Kuss, über unseren Köpfen wurde das Schwert gebrochen, und wir wurden fürs Begräbnis eingekleidet, wird Fjodor Dostojewski am Abend desselben Tages in einem Brief an Michail die eigene Hinrichtung beschreiben. Endlich wurde alles abgeblasen, diejenigen, die schon an die Pfähle gebunden waren, wurden zurückgebracht. Dann wurde uns das Urteil verlesen, dass seine Majestät der Kaiser uns das Leben geschenkt habe.
Diese Scheinexekution war in dem an Dramatik reichen Leben Dostojewskis die sicher extremste Erfahrung. Ein auf Dramaturgie bedachter Autor würde daraus vielleicht einen Wendepunkt machen, aber das wirkliche Leben ist komplizierter. Dieser quälende Morgen, der ihn in Eiseskälte dem Tod entgegensehen ließ, machte Dostojewski zunächst einmal bewusst, wie kostbar Zeit sein kann. Aber sogleich war ihm klar, dass er auch als „Begnadigter“ noch nicht wieder im richtigen Leben angekommen war. Zehn Jahre Haft und Verbannung warteten auf ihn, die ersten vier im sibirischen Straflager. Viel mehr als das nackte Überleben würde er sich nicht zum Ziel setzen können. In der nächsten Zeit wäre er aller Möglichkeiten beraubt, die einem Schriftsteller eine Perspektive boten. Und das, obwohl er doch so voller Gedanken und Pläne war, Wichtiges und Wertvolles aufzuschreiben hatte. Würde das Zuchthaus seine Ideen nicht im Existenzkampf absterben lassen? Zwischen Angst, Niedergeschlagenheit und verbissener Hoffnung bewegten sich seine Gedanken. Zwei Tage später sitzt er in Ketten auf einem offenen Pferdeschlitten und tritt eine Reise ins Ungewisse an.
*
Wir wissen es heute: Dostojewski wird noch die Zeit zur Verfügung haben, das literarische Versprechen einzulösen, das er bereits 1846 mit seinem Roman „Arme Leute“ abgegeben hatte und das die meisten seiner in rascher Folge erschienenen Werke bestätigten.
Seine bedeutendsten Romane, die bis heute seinen weltweiten Ruhm begründen, standen noch aus, und sie bezogen ihre Tiefe und ihr Gewicht zu einem guten Teil aus den außergewöhnlichen Erfahrungen, die dem Autor durch Straflager, Verbannung und die daraus resultierenden Folgen auferlegt wurden. In der ihm aufgezwungenen angsteinflößenden Gesellschaft von Dieben und Mördern studierte er die Abgründe der menschlichen Seele. Später stürzte er sich in verzweifelte Beziehungen zu Frauen. In der Sehnsucht nach finanzieller Unabhängigkeit verfiel er der Spielsucht. Was er durchlebte und durchlitt, verarbeitete er zu Geschichten, in denen er die hintersten Winkel der menschlichen Existenz und die Abgründe der Seele durchleuchtete. Zuweilen schien er nur ein Chronist der Absurdität des menschlichen Strebens zu sein, doch besonders im letzten Jahrzehnt seines Lebens wurde er für viele Zeitgenossen zu einem prophetischen Hoffnungsträger.
Es ist lohnend, sich mit dem Leben Dostojewskis zu befassen, bekommt man damit doch einen Schlüssel zu einem besseren Verständnis einiger der faszinierendsten Bücher der Weltliteratur, die bis zur Gegenwart nichts an Aktualität eingebüßt haben. Dostojewski ist heute noch relevant, weil sich zentrale Existenzfragen nicht ändern. Das Gefälle zwischen Arm und Reich ist nicht überwunden, Normen und wirtschaftlicher Druck schaffen auch in unserer heutigen Gesellschaft „Erniedrigte und Beleidigte“ (so der Titel eines Dostojewski-Romans). Außerdem wirft eine gefallene und bedrohte Welt, in der Millionen Unschuldiger unter den Folgen von Willkür und Machtmissbrauch leiden oder wegen ihrer Armut zugrunde gehen, immer noch die Frage auf, die Dostojewski zeit seines Lebens umgetrieben hat: ob es denn wirklich einen Gott geben kann, der dem Elend seit Beginn der Menschheitsgeschichte seinen Lauf lässt?
Dostojewski hat in seinen Büchern einem Nihilisten wie Friedrich Nietzsche Rollenmodelle geboten, er hat für Sinnsuchende bis in unsere Gegenwart Projektionsfiguren geschaffen, und er hat eindrückliche Charaktere kreiert, in denen sich der Abglanz einer höheren Liebe spiegelt. Das vermochte er, weil er selbst ein beharrlicher Wahrheitssucher war. Er schaffte dabei den Spagat, einerseits alles zu hinterfragen, sich zugleich aber unerschütterlich zu seiner Faszination von der Lehre und der Person Jesu Christi zu bekennen.
Sensibel gegenüber den Widersprüchen zwischen dem Evangelium und dem, was Christen im Leben daraus machen, befürchtete er unentwegt, im Glauben einer Illusion zu unterliegen. Allerdings markierte er für sich einen klaren Standpunkt: Falls man einmal feststelle, dass zwischen dem Jesus der Evangelien und der Wahrheit eine Kluft sei, wolle er auf der Seite Jesu stehen, bekannte er im Jahr 1854 in einem Brief an Natalia Fonwisina, die Frau, die ihm Jahre zuvor auf seinem Weg ins Straflager bei Omsk ein Neues Testament geschenkt hatte.
*
„Einzig das Erlebnis führt Dostojewski zu“, schrieb der Schriftsteller Stefan Zweig über den von ihm bewunderten Kollegen, „… je tiefer wir uns in ihn versenken, desto tiefer fühlen wir uns selbst. Nur wenn wir an unser wahres allmenschliches Wesen hinangelangen, sind wir ihm nah.“
Der katholische Theologe Eugen Drewermann, ein leidenschaftlicher Anwalt christlicher Wahrhaftigkeit und ein beharrlich Hinterfragender aller Dogmen, bestätigt Zweigs Auffassung: „Man braucht den Hintergrund der gleichen Not, des gleichen Suchens und der gleichen Sehnsucht, um Dostojewskis Art, die Welt zu sehen, als ‚notwendig‘ im wahrsten Sinn des Wortes zu begreifen … Man kann an seinem Werk auf viele Jahre so seelenruhig vorbeigehen wie an … dem Sprechstundenschild eines Arztes; doch irgendwann ist es so weit: Da braucht man ihn und findet ihn als einen längst bekannten, vertrauten Gefährten, Freund, Begleiter, Helfer.“
Ich führe diese beiden Stimmen an, weil sie mir erklären helfen, was mich persönlich an Dostojewski bindet. Als ich einmal im literarischen Kosmos des Dichters Fuß gefasst hatte, wurden „diese russischen Nächte mit ihren endlosen Monologen, fiebrigen Phantasien und paranormalen Charakteren“ (Drewermann) zum wirklichen Erlebnis, zum Spiegelbild eigener Grübeleien, Phantasien und Sinnfragen.
Ich fühlte mich durch Dostojewski nicht in meinem Bedürfnis nach Unterhaltung und Zerstreuung gepackt, sondern spürte, dass ich mich urplötzlich in einem inneren Dialog mit ihm wiederfand, bei dem es um existenzielle Fragen ging. Ich war von Dostojewskis „Karamasow“-Roman stellenweise ähnlich ergriffen wie von Bibeltexten mit ihrem Wahrheitsanspruch.
„Von nichts anderem wirklich kann ein Mensch leben als von dem Vertrauen, trotz allem umfangen zu sein von etwas, das er nicht kennt, noch beweisen kann und das ihn doch besser kennt als er sich selbst und das ihn doch als berechtigt erweist inmitten einer Welt sonst unauflösbarer Widersprüche“, schreibt Drewermann. Dieses Vertrauen, Christen sprechen gewöhnlich vom „Glauben“, wird in Dostojewskis Büchern härtesten Belastungen ausgesetzt, jeden Schutzes durch dogmatische Festlegungen beraubt, auf Senfkorngröße geschrumpft – und kann gerade dadurch so mächtig und erschütternd wirken. Ich will versuchen, in diesem Buch einige Belege dafür zu liefern, wobei es nicht darum geht, Dostojewski auf die Rolle eines christlichen Denkers zu reduzieren oder ihn als „Visionär“ zu überhöhen.
In meiner Begeisterung über seine Romane hatte ich früher erwartet, in Dostojewskis Lebensgeschichte, in seinen Briefen und in seinen Aufsätzen einem geistigen Titanen zu begegnen. Aber da stößt man auf viel Profanes, das einen ernüchtert. Man ist von der Persönlichkeit Dostojewskis vielleicht gar enttäuscht, wenn man nicht bereit ist, die menschliche Existenz generell an einem Maßstab zu messen, der gnädiger ist als die propagierten Bewertungsraster unserer Leistungsgesellschaft. Festzustellen, dass auch ein Dostojewski Kind seiner Zeit und bisweilen Opfer seiner Verhältnisse ist, muss ihn uns jedoch nicht weniger eindrucksvoll erscheinen lassen.
Natürlich würde ich mich freuen, wenn ich mit meiner kleinen Studie einige Leserinnen und Leser zu einer persönlichen Begegnung mit zumindest einzelnen Werken Dostojewskis ermutigen könnte. Jenen, die Bücher von ihm gelesen haben, indes seine Biografie nicht kennen, kann ich außer der eingangs geschilderten Szene einige weitere spannende Episoden versprechen. Für diejenigen, die mit Dostojewski vertraut sind, ist dieses Buch zwar nicht vornehmlich geschrieben, doch ich hoffe, sie finden darin ebenfalls die eine oder andere neue Anregung.
Bei den russischen Namen habe ich lesefreundliche Transskriptionen gewählt. Zu Dostojewkis Lebzeiten galt in Russland allgemein der julianische Kalender. Dieser weicht vom gregorianischen Kalender um wenige Tage ab. Bei Datumsangaben habe ich mich am örtlichen Bezug orientiert.
Kritische (und zustimmende) Reaktionen an den Verlag oder direkt an den Autor sind jederzeit willkommen.
Rainer Buck, Marbach am Neckar
Armenhospital, Landleben und Internate
Fjodor Michailowitsch Dostojewski kommt am 30. Oktober 1821 im Nebengebäude eines Moskauer Armenhospitals zur Welt. Er ist jedoch kein Kind aus der Armenschicht. Sein Vater ist in der Marijinski-Klinik Oberarzt und hat dort eine bescheidene Dienstwohnung. Fjodor ist nach seinem Bruder Michail das zweite von insgesamt sieben Kindern von Michail Andrejewitsch Dostojewski und seiner Frau Marja Fjodorowna, geborene Netschajewa.
Die Dostojewskis sind Nachkommen eines verarmten Landadelsgeschlechts. Vater Michail Andrejewitsch, Abkömmling eines russisch-orthodoxen Priesters, hatte in Moskau unter großen Entbehrungen als Mediziner promoviert und eine Kaufmannstochter geheiratet, eine gütige, liebevolle Frau. Sie ist offensichtlich die Seele von Fjodors Elternhaus, denn der Vater gilt als griesgrämiger Pedant. Er ist ein für die Zeit typischer Patriarch der konservativen Art und hält seine Familie weitgehend vom gesellschaftlichen Leben fern, da es nicht nur mit Lastern, sondern vor allem mit Ausgaben verbunden wäre. In seinem Beruf wird er offensichtlich geschätzt und mit den obligatorischen Orden dekoriert, doch der Dienst im Hospital ist aufreibend und nervenzehrend.
Fjodor wächst in einfachen, aber geordneten Verhältnissen heran. Die Eltern bemühen sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten schon früh um die Bildung ihrer Kinder. Die Anfänge bestreiten sie selbst, später werden Hauslehrer engagiert. Fjodor lernt mit vier Jahren Schreiben und Lesen. An einem Buch mit biblischen Erzählungen übt er sich im Buchstabieren. Manchen Abend verbringt die Familie mit Vorlesen. Eine ultrakonservative Darstellung der russischen Geschichte gehört zur bevorzugten Lektüre des Vaters, aber auch historische Romane und Werke der sogenannten „Schauerromantik“ finden zur Freude der Knaben Eingang in die Lesestunden. Der Mutter wird eine gewisse künstlerische Neigung nachgesagt, was die Literaturpalette erweitert.

Das Geburtshaus Dostojewskis
Im Elternhaus werden aus religiöser Überzeugung heraus die Rituale der orthodoxen Rechtgläubigkeit gepflegt. Gottesdienstbesuche in der Klinikkapelle und regelmäßige Wallfahrten zu Klöstern sind daher für die Kinder eine Selbstverständlichkeit. Zudem nährt eine Amme die Seelen der Kinder mit altrussischen Sagen und Volksmärchen, was auf Fjodor nicht ohne Wirkung bleibt.
Eine Theateraufführung von Schillers Sturm-und-Drang-Drama „Die Räuber“, die er als Zehnjähriger miterlebt, wird zu einem der Schlüsselerlebnisse in Fjodors Leben. Er ist schon in jugendlichen Jahren ein glühender Verehrer gehobener Literatur, insbesondere solcher Bücher, die das Schöne und Gute im Menschen anzusprechen suchen. In seinem nur wenig älteren Bruder Michail (geboren 1820) hat er hierbei ein verständnisvolles Gegenüber. Dieser wird zeitlebens zur wichtigsten Vertrauensperson, während die Beziehungen zu den übrigen Geschwistern schwächer ausgeprägt bleiben und eher fürsorglicher Natur sind.
Durch die räumliche Nähe zur Armenklinik lernt Fjodor die Schicksale von Menschen aus schwierigsten Verhältnissen kennen. Obwohl die Eltern Kontakte zu unterbinden suchen und ein Gitterzaun den von der Familie genutzten Garten vom Grundstück des Hospitals trennt, sucht der lebhafte und sensible Junge immer wieder die Begegnung mit Patienten. Ihre individuellen Geschichten erwecken seine Anteilnahme. Zugleich wird ihm früh die Grausamkeit der Welt vor Augen geführt. Eine neunjährige Spielgefährtin Fjodors wird eines Tages vor seinen Augen im Klinikgarten vergewaltigt. Sie wird so schwer verletzt, dass sie trotz der medizinischen Hilfe seines Vaters nicht gerettet werden kann.
Im Jahr 1831 verfügt der sparsame Michail Andrejewitsch über die nötigen Mittel, um ein südlich von Moskau gelegenes Gut mit zwei dazugehörenden Dörfern und rund 100 männlichen Leibeigenen zu erwerben. Dieses besucht er selbst in den ersten Jahren nach dem Erwerb nur für ein paar Tage im Hochsommer, doch seine Familie verbringt fortan die ganze wärmere Jahreszeit im kleinen Gutshaus, das aus drei Zimmern besteht und idyllisch in einem Lindenhain liegt. Fjodor und seine Geschwister haben so die Möglichkeit, sich körperlich auszuleben, eine intensive Beziehung zur Natur zu gewinnen und die Landbevölkerung kennenzulernen.
Unter den einfachen Bauern gibt es Menschen, deren schlichter Herzensgüte und Frömmigkeit sogar noch in Dostojewskis literarischem Spätwerk ein Andenken gewidmet ist. Als der kleine Fjodor einmal halluziniert und sich von einem Wolf verfolgt wähnt, findet er Zuflucht bei dem Bauern Marei, der ihm geduldig mit nahezu weiblicher Zärtlichkeit zuredet, ihn in seinen Ängsten ernst nimmt und schließlich das Kreuzzeichen über ihm macht. Besonders aber ermutigen sein mildes Lächeln und sein liebevoller Blick den Jungen. Ich ging, schaute mich aber fast alle zehn Schritte nach ihm um; Marei stand da mit seinem Stutchen und schaute mir nach, und jedes Mal nickte er mir zu, wenn ich mich nach ihm umsah.
Durch seine beruflichen Verdienste hatte es der Vater geschafft, den durch Verarmung verlorengegangenen Adelstitel der Familie wiederzuerlangen und mit seinen Söhnen 1830 in das Buch des Moskauer Erbadels eingetragen zu werden. Für Dostojewski spielt es in späterer Zeit trotz seiner Sympathien für die Armen und Rechtlosen durchaus eine Rolle, edler Abstammung zu sein. Sein Ansehen ist ihm vielleicht deshalb so wichtig, weil er in den Kreisen, in denen er – abgesehen von den Jahren im Straflager – die meiste Zeit verkehrt, materiell nie zu den Privilegierten gehört.
Ab 1834 besuchen er und sein Bruder Michail in Moskau Internatsschulen, denn der Vater legt Wert auf eine umfassende Ausbildung und geht dafür sogar finanziell bis an die Schmerzgrenze der Familie. Nur dadurch, dass er neben dem Klinikdienst viele Privatpatienten betreut und zudem eine Hypothek auf das Landgut aufnimmt, ist es überhaupt möglich, die teuren Internate zu bezahlen. Insbesondere will er, dass die Söhne Französisch und Deutsch lernen. Von einem französischen Internat wechseln sie etwas später auf ein „Privatgymnasium für adlige Knaben“. In dieser elitären Schule müssen die Brüder schmerzlich feststellen, dass sie im Vergleich zu den meisten Mitschülern von zu Hause aus nur mit einem kargen Budget ausgestattet werden können. Dies trägt ihnen regelmäßige Sticheleien ein, schweißt sie aber noch enger zusammen.
Die früh angefachte Begeisterung für Literatur nimmt in diesen Jahren zu. Die Gedichte von Schiller werden auswendig gelernt, von den russischen Klassikern verehren Fjodor und Michail zunächst vor allem Alexander Puschkin. Die Reinheit und Erhabenheit von Puschkins Dichtkunst wird Fjodor noch im hohen Alter bewundern.
Zerfall der Familie
Anfang 1837 trifft das Schicksal die Familie hart. Marja Dostojewskaja stirbt am 27. Februar an der Schwindsucht. Ihr Mann wird durch ihren Tod aus der Bahn geworfen. Er quittiert seinen Dienst als Arzt und beschließt fortan, als Gutsherr auf seinem Landbesitz zu leben. Seine despotischen Züge bekommen von nun an die Leibeigenen zu spüren. Zusehends verfällt er dem Alkohol.
Für Fjodor und seinen älteren Bruder hat die neue Situation zur Folge, dass sie das erträumte Universitätsstudium in Moskau aus ihren Plänen streichen müssen. Entgegen ihren literarischen Neigungen bestimmt der Vater die Sankt Petersburger Ingenieursakademie als geeignetsten Ausbildungshort für seine Söhne. Aufgrund ihrer schulischen Leistungen spekuliert er für sie dort auf einen Freiplatz, doch die Korruption bei der Vergabe der Stipendien macht ihm einen Strich durch die Rechnung. Alexandra Kumanina, eine reich verheiratete Patentante, kommt fortan für Fjodors Schulgeld auf. Für das tägliche Leben hingegen fehlt es dem jungen Studenten in den kommenden Jahren oft am Nötigsten.
Schlimmer noch als das ungeliebte Fach ist der Umstand, dass nur Fjodor in Sankt Petersburg studieren kann, während es Michail nach Reval verschlägt. Fortan können die Brüder nur brieflich den Kontakt halten – und selbst das fällt schwer, denn zuweilen reicht das schmale Budget Fjodors nicht einmal für das Porto aus.
Den tagesfüllenden Pflichtenkatalog der Ingenieursakademie absolviert Fjodor Dostojewski zwar nicht begeistert, aber doch pflichtbewusst. Die Fertigkeiten für eine spätere Berufsausübung kann er sich durchaus aneignen. Die Briefe an seinen Bruder zeigen jedoch sein Leiden am streng reglementierten Alltag. In der Schule wird er zum Außenseiter. Er beklagt die Oberflächlichkeit seiner Kommilitonen und ihre einseitige Orientierung auf die nette einträgliche Stellung. Zugleich repräsentieren sie für ihn die Herzenshärte einer militärisch geprägten Gesellschaft: Alles, was gerecht, aber gedemütigt und verfolgt war, verachteten sie, schreibt er in seinen späteren Erinnerungen.
Fjodor beißt sich durch, und da sein Gerechtigkeitsempfinden hochgradig ausgebildet ist, setzt er sich bei mancher Gelegenheit für jüngere Schulkameraden ein, wenn sie als Neuankömmlinge von den Älteren gequält werden. Er ist ein nicht beliebter, aber immerhin geachteter Mitschüler. In seinen Briefen an den Vater, in denen er um Geld bittet, kommt die Sorge zum Ausdruck, nicht mit den anderen mithalten zu können, was Kleidung und Lebensstil betrifft. Dünnhäutig registriert er Demütigungen, die ihn selbst treffen, und reagiert zugleich mitfühlend, wenn ein anderer zum Opfer von Spottlust erkoren wird. Die selbst erfahrenen Situationen der Scham machen ihn hochgradig sensibel für die Rituale von Über- und Unterordnung, die die gesellschaftlichen Konventionen seiner Zeit durchdringen.
Der Vater kann, selbst wenn er wollte, nicht viel für die Söhne tun. Ihm haftet nunmehr der Ruf an, als typischer poméschtschick (Gutsbesitzer) das Leben eines Wüstlings, Trinkers und Tyrannen zu führen. Nach seinem jähen Tod im Juni 1839 heißt es, die eigenen Leibeigenen hätten ihn umgebracht. Dies wird bis heute so kolportiert. Allerdings attestiert die von zwei Ärzten unterschriebene Sterbeurkunde einen tödlichen Schlaganfall.
Dostojewski hat sich zu keiner Zeit viel über seinen Vater geäußert. Er mag wohl über sich selbst erschrocken gewesen sein, wie wenig Trauer er über den Verlust empfand. Dass ihn das Thema ambivalenter Vater-Sohn-Beziehungen bis ins Alter stark beschäftigt, zeigt unter anderem die problematische Vaterfigur in seinem letzten Roman „Die Brüder Karamasow“. Der Tiefenpsychologe Sigmund Freud versucht in einer Studie über Dostojewski dessen verborgene Gedanken an einen Vatermord nachzuweisen. Allerdings spricht Dostojewski in den überlieferten Briefen an den Bruder immer respektvoll über den Vater, und auch die Zeugnisse anderer Geschwister deuten darauf hin, dass Michail Andrejewitsch Dostojewski in vielen späteren Schriften über seinen berühmten Sohn wohl zu schlecht wegkommt.