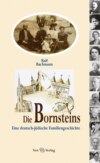Loe raamatut: «Sprachbilder und Sprechblasen», lehekülg 3
In der ehemaligen DDR spöttelte man gern: »Spare mit jedem Pfennig, koste es, was es wolle.« Ehemalige DDR? Das hätte nur Sinn, wenn irgendwo eine zweite herumläge, die noch existiert. Aber manche haben Angst, als Nostalgiker zu gelten, wenn sie etwas von früher erzählen und dabei einfach DDR sagen, so wie sie in Berlin gar die Erdachse wenden und vom ehemaligen Ostteil der Stadt reden. Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Kurt Beck liebt »einander gegenseitig«. Das ist genauso eine Tautologie wie bei RTL das Versprechen der Regierung, einen »neuen Start anzufangen« und im Inforadio Berlin-Brandenburg »der frühere Ex-Präsident Clinton«. Das ZDF berichtet über »gescheiterte Testversuche« von BP im Golf von Mexiko. Kanzlerin Merkel verkündet, Europa sei in der Realität der Wirklichkeit angekommen. Hoffentlich erkennt es dort die tatsächlichen Fakten. Bundespräsident Wulff versichert vor einer Japanreise, es gehe dabei um Zusammenarbeit, gar – welche Sensation – um gemeinsame Zusammenarbeit, wo man doch im Normalfall, schon um Streit zu vermeiden, nur mit sich selbst zusammenarbeitet.
Wenn wir schon bei den Sprachsünden des Alltags sind, sei auch ein Wort zur sogenannten Überfremdung gesagt. Wird die Sprache verhunzt, wenn sie Fremdes aufnimmt? Schon im 17. Jahrhundert entstanden Sprachgesellschaften wie die »Teutschgesinnte Genossenschaft«, die der sich erst herausbildenden deutschen Nationalsprache als einem die ganze Nation umschlingenden Band huldigten und Fremdwörter als Gefahr bekämpften. Das war ein zweischneidiges Schwert. Einerseits war die sprachliche Einheit tatsächlich eine schützenswerte, noch zarte Pflanze, andererseits waren die Nachbarländer wie Italien und Frankreich auf vielen Gebieten Deutschland weit voraus und ein Anschluss an die internationale Entwicklung ohne die Übernahme fremden Sprachguts undenkbar.
Die Bemühungen um »Sprachreinigung« waren also eine Gratwanderung. Mit Spott wurde schon damals auf Übertreibungen wie die Ersetzung von Urne durch Leichentopf, von Fieber durch Zitterweh, Nase durch Gesichtserker, Fenster durch Tageleuchter und Nonnenkloster durch Jungfernzwinger reagiert. Zur Goethezeit wollten »Puristen« Schalkernst für Ironie, Süßchen für Bonbon, Lotterbett für Sofa einführen. Lächerlich waren die Überspitzungen, nicht aber die Bemühungen. Die vernünftigen Vorschläge blieben erhalten, oft neben dem kritisierten Ursprungswort: Abstand und Distanz, Anschrift und Adresse, Mundart und Dialekt, Bücherei und Bibliothek, Zerrbild und Karikatur, Stelldichein und Rendezvous, Feingefühl und Takt. Goethe sah die Sache so: »Die Gewalt einer Sprache ist nicht, dass sie das Fremde abweist, sondern dass sie es verschlingt.«
Geschlechtsleben hat gegen Sex keine Chance
Das gilt heute mehr denn je. Es lohnt sich, um unseren Sprachschatz zu kämpfen. Ob der Kampf Erfolg hat, hängt meiner Meinung nach nicht nur von der Mode, sondern bei jedem Wort vor allem von drei weiteren Faktoren ab: Verständlichkeit, Wohlklang und auch moderne Sprachökonomie. Das langatmige Geschlechtsleben hat am Ende gegen den kurzen und gut klingenden Sex keine Chance. Einchecken ist hässlich, ersetzt aber einen ganzen Satz. Job ist griffiger und knapper als Berufsarbeit. Man muss trotzdem nicht tatenlos zusehen, wie aus ehrlicher Arbeit jobbender Einheitsbrei wird und am Ende alle jobben: der Straßenfeger und der Lyriker, der Zuchtbulle und der Kurienkardinal. Selbst das Kitakid, das einst ein Kindergartenkind war, wird nach dem Topfgang für guten Job gelobt. Bei schlechtem Job halten wir es weiter mit der vertrauten und klangstarken deutschen Scheißarbeit. Die Kitakinder sind da aus Gründen der Logik ein Sonderfall.
Die sogenannte Reinheit der deutschen Sprache zu wahren ist eine schier unlösbare Aufgabe, weil sie selbst darauf pfeift. Die Umgangssprache schnappt alles auf, was ihr über den Weg läuft und gefällt. Kaum sagt einer cool, schon greift sie danach. Dann folgt crazy und sexy, Shopping und Date, Fast Food und Superhit, Event und Homepage, gecastet und gemailt, ausbaldowern und roboten, online und Software. Manches Wort ist so schnell wieder weg, wie es kam, manches wird, wie es Goethe empfohlen hat, einverleibt, bis nichts mehr fremd an ihm klingt.
Auf der vorletzten Seite war von der Zeit die Rede, als Preußens französisch sprechende Adelshäuser – selbst der große Friedrich musste zugeben »Deutsch kann ich nicht gut« – und die Hugenotten, die eine so zahlreiche Minderheit waren wie jetzt die Türken, später auch Napoleons Besatzer in Berlin für eine Frankofonie sorgten, die dem Denglisch von heute durchaus vergleichbar war. Behalten haben wir etwa Bulette und Erbspüree, Filet und Roulade, Bluse und Kostüm, Toilette und elegant, Balkon und Chance, Revanche und Milieu, Malheur und Mayonnaise (die man neuerdings auch Majonäse schreiben darf), Salon und Sabotage, da und dort sogar Esprit. Wir sagen bis heute Charité, Gendarmenmarkt, Budike, Fete, Promenade. Die Berliner fanden Spaß daran, ihre eigenen Wörter mit Endungen zu französisieren: Kneipier, Stellage, Kledasche, schikanös. Bei manchem Wort errät keiner mehr die Herkunft – Grieben (gribelettes), Kinkerlitzchen (quincailleries – wertlose Kleinigkeiten), Muckefuck
(mocca faux = falscher Kaffee). Manches korrigierte das Leben, so wurde aus dem Billett das (englische) Ticket, das wiederum mit der Fahr- und der Eintrittskarte koexistiert. Die deutsche Sprache hat alles überlebt, nichts eingebüßt und sogar noch gewonnen.
Ohne Wortimporte weder Perestroika noch Schokolade
Ein knappes Drittel des deutschen Wortbestands hat einen Migrationshintergrund, wie man heute so korrekt wie unschön sagt. Manches importierte Wort ist ein Schmuckstück unserer Sprache geworden. Wer möchte schon auf Perestroika und Glasnost verzichten, die wir den Russen verdanken, auf den Tollpatsch, der aus Ungarn stammt, die Schokolade, der man Altmexiko nicht mehr ansieht, und gar die Hängematte, gegen die wohl nicht einmal die »Teutschgesinnten« etwas einwenden würden. Das, was sie bezeichnet, ist jedem bekannt. Aber wer weiß, dass die aufgehängten Schlafnetze eine Erfindung der Eingeborenen der karibischen Inseln sind, die von den nässe-, ratten- und mäusegeplagten Matrosen des Kolumbus vor 500 Jahren begeistert aufgegriffen wurde. Bei den Indianern hießen sie »hamaca« (in den karibischen Sprachen heute noch), die Holländer machten daraus zunächst Hangmac, was die Volkssprache der Logik wegen in Hangmat verwandelte. Nun blieb zur deutschen Hängematte nur noch ein Schritt. Ich gestehe gern, dass ich von alledem keine Ahnung hatte, bis ich die spannende Einsendung von Ulrich A. Schmidt aus Castrop-Rauxel im von Prof. Dr. Jutta Limbach herausgegebenen Buch »Eingewanderte Wörter« lesen konnte.
Zusammenfassend darf man für alle ängstlichen Gemüter konstatieren, unsere Sprache wäre arm ohne Griechen (Demokratie, Parallele, Patriot, Philosoph, Muse, Fantasie), Lateiner (Amulett, Zettel, Wein, Lokus, Tempo, Fenster), Italiener (Kredit, Giro, Mosaik, Posse, Adagio, Pizza, Kohlrabi, Trüffeln), Franzosen (Dessous, Pantoffel, Boutique, Resümee, Bonbon, Negligé, Rendezvous, Gourmet), Juden (Dalles, Massel, meschugge, Mischpoche, Schlemihl, beschickert), Russen (Sputnik, Datsche, Apparatschik, Kosmonaut, Wodka, dawai, nitschewo, in der DDR auch in der pikanten Variante Weltnitschewo), Türken (Sofa, Papagei, Tasse, Limonade, Fanfare, Spinat, Jogurt) und all die anderen. Mag mancher Politiker tönen, Multikulti sei endgültig gescheitert – die moderne deutsche Sprache atmet den Geist eines gesunden Multikultismus.
Sie wäre weltweit isoliert, würde sie auf die Anglizismen verzichten. Karl-Heinz Göttert spricht in seiner schon in Kapitel 1 zitierten Biografie der deutschen Sprache von einer Brückenfunktion des Englischen, sie sei eine »Lingua franca«, eine freie Sprache, geworden. Englisch verbindet als internationales Sprachwechselgeld die Kontinente und stellt in manchen Bereichen der Wissenschaft das dar, was früher Latein war. Göttert geht noch weiter. Er schreibt: »Englisch i s t das neue Latein.« Wer hätte die Chance, Computer durch elektronischer Tischrechner zu verdrängen, Link durch Verbindungsstück zu anderen Internetseiten, Laptop durch tragbarer Personalcomputer.
Auch im Zeitungsdeutsch kommt man ohne Anleihen bei Fremdsprachen nicht aus. So hieß es im Wissenschaftsteil einer Zeitung: »Die Simulation bestätigte, dass das Universum zu 70 Prozent aus ›dunkler Energie‹ besteht, einem mysteriösen Kraftfeld, dessen Struktur man noch nicht erfassen kann.« Wäre das klarer mit Nachahmung, Weltall, Antriebskraft, geheimnisvoll und Zusammensetzung? Es wäre nur deutscher. Der Sprache ist das egal. Sie hat kein Nationalgefühl. Wir sind nicht ausländerfeindlich, auch unsere Sprache nicht. Übrigens: Viele der übernommenen Wörter sind in Wahrheit Internationalismen. Und 80 Prozent der sogenannten Anglizismen wurzeln laut Göttert selbst im Griechischen, Lateinischen oder Romanischen.
Zum Orogasmusu nach Nippon
Wir sollten also, wenn wir gescheit sind, die fremden Sprachen vorbehaltlos nutzen, soweit sie Besseres als die eigene bieten. Wie aber ergeht es der deutschen Sprache jenseits der Grenzen, ohne die wärmende Obhut der Sachsen und der Schwaben? Das erwähnte Buch über Wortimporte hat einen Zwillingsbruder. Er heißt »Ausgewanderte Wörter« und bringt eine Auswahl aus 6000 Einsendungen und Belegen aus aller Welt zu einer Ausschreibung des Deutschen Sprachrates, bei der nach deutschstämmigen Wörtern in anderen Sprachen gefragt worden war. Das Lesen dieses Buches macht aus manchen Gründen Freude, nicht zuletzt, da es zeigt, dass unsere schöne Sprache kein Auslaufmodell geworden ist, nur weil man sich in allen Kontinenten vornehmlich des Englischen bedient. Herausgeberin Jutta Limbach bemerkt in einem Vorwort, die deutsche Sprache habe sich »mit ihren einfallfreudig zusammengesetzten Wörtern für andere Sprachen immer wieder als eine reichhaltige Fundgrube erwiesen«. Sie nennt als Beispiele solcher »Kombi-Wörter«, die sich in vielen Sprachen wiederfinden, Fingerspitzengefühl, Zeitgeist, Gratwanderung und Leitmotiv.
Wenn die meisten Einsendungen zu Deutschexporten aus dem englischamerikanischen und dem slawischen Sprachraum kommen, verwundert das kaum. Aber es gibt auch »exotische« Exempel. So ist es doch hübsch, auf Estnisch Lips für Schlips und Naps für Schnaps zu hören. In die westafrikanische Sprache Wolof hat man lecker übernommen. Und was könnte wohl aus unserer Sprache bis nach Japan gekommen sein? Nun zum Beispiel arubaito für Teilzeitarbeit, kirushuwassa für Kirschwasser, noirooze für Neurose und, siehe da, orogasmusu mit der gleichen Bedeutung, wie sie der eine oder andere von uns in Erinnerung hat.
Und nach Israel? Etwa Wischer (Mehrzahl: Wischerim) für Scheibenwischer, Schlafstunde für Siesta und Strudel für das @-Zeichen. Vigéc nennen die Ungarn die Hausierer. Die Redewendung »Was ist das« ist komischerweise zweimal ausgewandert, einmal nach Frankreich, wo es Dachfenster, Oberlicht, Türspion bedeutet, vielleicht eine Erinnerung an die auf der deutschen Rheinseite üblich gewesenen Guckfenster, durch die man vor dem Öffnen der Tür fragte: »Wer ist da? Was ist?« In der ungarischen Umgangssprache dagegen benutzt man es im Sinne von keine Kunst »Ez olyan nagy was-ist-das?«, wenn man fragen will: Was ist das schon? Ist das so schwer?
Auch wer was wo erfunden hat, erkennt man am Sprachgemisch. Wie es damit im Tschechischen aussieht, findet man in Lektion 12 des Kapitels »German for Sie«. Die Ukrainer trauen uns das feijerwerk zu, die Bulgaren den schteker, die Russen den schlagbaum und schtrejkbrechery , dazu buterbrody, rjukzak, galstuk (für Schlips / Halstuch), brandmauer (deutsch firewall), buchgalter und zejtnot (beim Schach). Für die Finnen sind wir der Prototyp des besservisseri und versessen auf kahvi paussi, für die Polen hochsztapler oder szlafmyca, womöglich gar im szlafrok, für die Serben štreber. Die Franzosen nennen einen Spaßvogel loustik, den Handball handball, Kitsch kitch und Nudeln nouilles, kennen aber auch le képi, le schnorchel, les neinsager und le waldsterben . Praktisch sind deutsche Wörter in der ganzen Welt kleben geblieben. In der südbrasilianischen Großstadt Blumenau saß ich im Lokal »Frohsinn« und fand zum Oktoberfest auf der brasilianischen (also portugiesischsprachigen) Karte Eisbein mit Sauerkraut. Man könnte einwenden, hier handle es sich um eine einst deutsche Siedlung. Jedoch Oktoberfeste, sznizil (das ist die türkische Schnitzelvariante), Kuchen, Zwieback, Kümmel und Schnaps kennt man wie Gneis und Zink, Nickel und Quarz auch anderswo, natürlich in unterschiedlicher Schreibweise.
In lederhosen zum beer fest
Dass Deutschland Exportweltmeister ist (besser: war), kann man für die Sprache trotzdem leider nicht sagen. Zwei von Deutschland ausgehende Weltkriege und die Hitlerei sind nicht ohne Folgen für die einst zumindest in Nord-, Ost- und Südosteuropa sehr beliebte Sprache geblieben. Aber zum Trost für jene, die wegen Denglisch um unsere Muttersprache bangen, darf man feststellen, dass selbst in den USA gern auf einige deutsche Vokabeln zurückgegriffen wird. Vom Zeitgeist war die Rede. Mit autobahn und fahrvergnügen, fraulein und fuehrer, pilsner und leberkaes mit sourkraut, waldmeister und pretzel, muesli und pumpernickel braucht man kein wunderkind zu sein, um selbst in lederhosen mit rucksack gemütlich zum coffee-klatsch oder zum beer fest zu gelangen, nicht wahr? Der Ruf »Gesundheit!« gilt in den Staaten als vornehmere Variante zu »bless you«.
Wie finden Sie die folgenden amerikanischen Sätze: »I cannot schlepp your luggage«, »There is a poltergeist in the house.« Bei der Präsidentenwahl 2004 in den USA hielt ein Kandidat dem anderen vor: »You are too wischiwaschi.« Im Time-Magazin hatte man für Bush zum Abschied das Wort shwindler parat. Der Fleischer an Portugals Südwestzipfel, dessen Bude die Aufschrift »Letzte Bratwurst vor Amerika« trägt, informiert unvollständig. Er sollte ehrlich zugeben: An bratwursts wird es in New York nicht fehlen.
Es liegt nahe, dass man vermeintlich typisch deutsche Eigenschaften und Produkte auch im Ausland deutsch benennt. Gemütlichkeit natürlich, und dazu Angst, Schadenfreude, Fernweh, Wanderlust, Weltanschauung, Wirtschaftswunder, Leberwurst, Zwieback, Wiener, Gasthof. Nachdenklich sollte stimmen, dass in diese Reihe auch Blitzkrieg, Übermensch, Lumpenproletariat, Hinterhalt und Berufsverbot gehören. Erwähnenswert erscheint mir auch, dass im Englischen wie im Russischen deutsche Befehlsworte für die Hundekommandos bevorzugt werden: Hier! Platz! Hopp! Aus! Sitz! Pass auf! Pfui! Such!
Rettet den Hubschrauber vor dem Helikopter!
Keine Angst also vor dem Sprachcocktail. Was nach dem Turmbau zu Babel geschah, war nur als Übergangslösung gedacht. Auf die Palme bringen sollten uns nur Verletzungen der Sprache durch Modetorheiten, Prahlsucht, unverdaute Sprachbrocken und inhaltloses Geschwätz. Warum aus den Flugzeugentführern Hijacker werden müssen, der Friseur an der Ecke neuerdings »Cut & Go« (ohne zu zahlen?), der Konditor »Coffee to go« (zum Weglaufen?) anbietet, warum man downloadet statt herunterzuladen und mental pusht statt geistig in Schwung zu bringen, warum ein richtiger Verlierer ein Loser sein muss und ein Spielgewinner ein Matchwinner, warum es keine Freilichtveranstaltungen mehr gibt, sondern nur noch Openair-Events, warum die Direktion die gute alte Putzkolonne in einem großen Berliner Hotel durch ein Cleaningteam ersetzt, wüsste ich schon ganz gern. Und ich wünsche mir sehr, dass der bildhafte Hubschrauber nicht mit dem technokratischen Helikopter totgeschlagen wird.
Meist geht es nur darum, mit Wortbombast kleine Sprachfürzchen zu Donnerschlägen aufzublasen. Besonders beliebt ist das in Parlamentsreden. O-Ton: »Gerade im Angesicht der Komplexität der aktuellen Situation sollten wir keine hektische Betriebsamkeit auf diesem abschüssigen Terrain generieren.« Gemeint ist: »Ehe wir in ein Fettnäpfchen treten, machen wir lieber gar nichts.« Der Chef des Marburger Bundes verkündete vor einem Ärzteausstand: »Die Ärzte wollen eine Streiksituation gestalten.« – »Die Ärzte wollen streiken« hätte auch genügt. Auf der Fanmeile zur Fußball-EM wollten die Händler »im Vorfeld der Veranstaltungen« die Riesenbratwürste nicht schlicht anbieten, sondern »zum Verzehr bringen«. Das teilten sie Journalisten nicht etwa mit, nein, sie brachten es ihnen zur Kenntnis. Nach einigen Spielen gab es Zwischenfälle, die von der Polizei »einer Untersuchung zugeführt« wurden. Manchmal wurden sie auch einfach untersucht. Nicht die Zahl der möglichen Nutzer, sondern »die Größe der Community – möchte ich mal sagen« will die Leiterin einer bedeutenden Berliner Bibliothek den Gebühren für die Buchausleihe an Universitätsinstitute zugrunde legen.
Vom Stadionausrufer bis zum Regierungssprecher
Ist es Ignoranz oder Angeberei, wenn »Ich erinnere mich« von manchen Prominenten durch »Ich erinnere« ersetzt wird, wohl weil im Englischen »I remember« genügt? Im Laufe meines langen Journalistenlebens habe ich Hunderte von Leuten interviewt, die überflüssigerweise meine Fragen bewerten wollten. Ich hörte: Das ist eine schwierige Frage, eine schöne, eine kluge, eine dumme, eine nachdenklich stimmende, eine raffinierte, eine selten gestellte und mehr. Diese Zeiten sind vorbei, all das wird durch die Modefloskel »Das ist eine gute Frage« ersetzt, auch wenn dem Interviewpartner nur keine Antwort einfällt und er zugeben müsste: »Das weiß ich nicht.«
So und ähnlich gestanzt und gestelzt reden sie nun fast alle und fast immer: vom Stadionausrufer bis zum Regierungssprecher, vom Betriebsrat bis zum Minister, vom Bürgermeister bis zur Kanzlerin. Ist es wirklich schon 130 Jahre her, dass ein Münsteraner Pfarrer als Neujahrsgebet sagte: Gib den Regierenden ein besseres Deutsch und den Deutschen eine bessere Regierung. Herr sorge dafür, dass wir alle in den Himmel kommen. Aber nicht sofort.
Kapitel 3
Ein lieder-licher Lebenslauf
Was man so alles gesungen hat und was das über die Zeiten verriet
Schläft ein Lied in allen Dingen,
Die da träumen fort und fort,
Und die Welt hebt an zu singen,
Triffst du nur das Zauberwort.
Joseph von Eichendorff
Um es mit Udo Jürgens auf heutige Art zu sagen: In allen Dingen lebt ein Lied. Und ist das Lied ein Zauberwort, dann beginnt es in einem ganz von allein zu klingen, ohne dass man einen Ton hören muss. Man mag wollen oder nicht, es verfängt sich in den Gehörgängen und sägt bald sanft, aber dauerhaft an ihnen. Der Volksmund hat dafür keinen so poetischen Namen wie der Romantiker. Ihm ist vom Chorgesang bis zur Liebesschnulze alles oft und gern Gehörte einfach ein Ohrwurm, egal ob es sich um »Freude, schöner Götterfunken« oder »Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad«, um »Mausi, süß warst du heute Nacht« oder »Lebt denn dr alte Holzmichl noch?« handelt. Am zählebigsten sind diese Ohrtierchen im Unterbewusstsein. Über ihr Fortleben im Koma fehlen genauere wissenschaftliche Untersuchungen noch. Aber im Traum zählen sie, wenigstens bei mir, zu den Dauergästen.
Wer aus dem Schlaf aufgeschreckt wird und nicht wieder zur Ruhe kommt, dem fallen vielleicht schweißgebadet die Folgen verpasster Termine ein. Andere rekeln sich wohlig bei der Erinnerung an schöne Erlebnisse. Schüler üben noch einmal die Antworten auf Prüfungsfragen des nächsten Tages. Politiker feilen, meist mit wenig Erfolg, an besseren Formulierungen für ihre große Rede. Durch mein Gehirn wabern da stets Lieder. Manchmal ist es ein einzelnes, manchmal kommen Dutzende von allen Seiten, Lieder, die ich nicht vergessen kann, aus längst oder unlängst vergangener Zeit, liebliche Melodien, Chansons, Arien, Schnulzen, Schreckenstöne. Zwanghaft und auf mich selbst wütend quäle ich mich oft stundenlang, aus Liedfetzen Text und Melodie des Originals zu rekonstruieren. Das ist eine Art individuelle Denkmalspflege, denn an vielen der Lieder hängen Geschichten, ja, hängt Geschichte.
Solche Strophen und ihre Zusammenhänge verfolgten mich nächtelang. Bis ich begann, sie aufzuschreiben, damit sie Ruhe geben. So entstand Schritt für Schritt ein lieder-licher Lebenslauf. Für dieses Kapitel habe ich nur einige ausgewählt, die mich an wichtige Abschnitte meiner ersten Lebenshälfte erinnern, die Periode, als ich noch selber sang und als es im Lande brodelte. Ob das für andere Leute Nichtigkeiten sind, die sie gar nicht interessieren oder ob sie an ihnen solchen Spaß haben wie der Schreiber, vermag ich nicht zu beurteilen. Ich staune jedenfalls immer wieder, was alles sich da in meinem Kopf festgesetzt hat, der doch die eigene Autonummer nicht behalten kann, und schrieb es ganz bewusst fast nur aus dem Gedächtnis nieder. Selbst wo es möglich gewesen wäre, habe ich meist darauf verzichtet, in Büchern nachzuschlagen, wie die korrekten Texte lauten. Mir ging es nur darum, womit die Lieder auf mich gewirkt haben und warum sie in meiner Erinnerung blieben. Wem an Genauigkeit gelegen ist, tut besser daran, mit anderen Quellen zu vergleichen.
Striez Mutter, die Landwehr kommt
Schon wenn ich mich als Kleinkind auf dem Nachttopf mühte, pflegte mich mein Vater mit einem nicht ganz stubenreinen Rundgesang über etwas so wenig Kindliches wie die sächsische Landwehr anzuregen: »Striez Mutter, die Landwehr kommt, der Vater trägt die Fahne, die Kinder laufen nackt herum und wackeln mit dem – striez Mutter ...« Dieses Endloslied liebte er – vielleicht wegen der Wirkung – so, dass er es genau wie ein anderes Landwehrlied fast täglich zu pädagogischen Zwecken einsetzte: »Immer langsam voran, immer langsam voran, dass die preußische Landwehr mal nachkommen kann ...« Das brummte er im Takt des schweren Schrittes von Soldatenstiefeln, wenn er meinte, ich solle nicht so bummeln. Er tat das derart oft, dass es lebenslang haften blieb und ich die Melodien noch heute summen kann. Mir gefielen wohl die lustigen Bilder von der striezenden Mutter, um die lauter kleine Nackedeis mit wackelnden Schwänzchen tanzten. Erst viel später fiel mir auf, dass da auch ein Wort dazugehörte, mit dem ich ganz bestimmt nichts anfangen konnte.
Es waren die letzten Tage der Weimarer Republik und zugleich die Zeit, als die braune Flut Deutschland überschwemmte. Alle möglichen Uniformmänner waren da bei uns in Crimmitschau zu sehen, doch weit und breit keine sächsische Landwehr, geschweige denn eine preußische. Also beschäftigte mich, als ich langsam zu denken lernte, allmählich nicht nur die kindsgemäße Albernheit des Textes, sondern auch die Fragestellung, was eigentlich so eine Landwehr macht, die doch offenbar mit den Liedern auf die Schippe genommen werden sollte.
Als ich meinen Vater danach fragte, wunderte er sich, denn er hatte das »nur so« gesungen. Die gibt es doch schon lange nicht mehr, erklärte er mir. Er kenne die Lieder aus der Zeit, als er selber ein Junge war, und habe sie wohl von seinem Vater gehört. Ja, eine Landwehr existierte bis zum (Ersten) Weltkrieg, früher in den einzelnen Ländern wie Preußen und Sachsen, später im ganzen Reich, klärte er mich schließlich auf, eine bunt zusammengewürfelte Bürgerwehr, die eigentlich gar nicht in die Zeit passte. Alle haben sich über sie lustig gemacht. Verstanden habe ich von seiner wissenschaftlich und historisch ohnehin nicht haltbaren Erklärung natürlich so gut wie nichts, ich wollte ja eigentlich auch nur wissen, was er, der Pazifist, da gesungen hat und was er damit meinte.
Die Marie steht da im Hemd
So kam es, dass ich bei meiner ersten bewussten Begegnung mit dem Lied nicht wie die meisten kleinen Kinder auf »Häschen in der Grube« oder »Alle meine Entchen«, sondern auf, wenn auch recht absonderliche, deutsche Militärmusik traf. Militärlieder begleiteten meine Entwicklung auch danach. Das lag am Zeitgeist und daran, dass wir sehr arme Leute waren, die anfangs weder Radio noch Grammofon besaßen, weshalb meine Musikkenntnisse nur auf dem beruhten, was ich zu Hause (davon wird noch die Rede sein) und auf der Straße hörte. Dort aber ertönten vor allem martialische Marschlieder, die der SA-Kolonnen und die der anderen Uniformierten.
Jedes Regiment hatte seinen eigenen Traditionsmarsch mit einem langweiligen amtlichen, aber, wie sich bald herausstellte, auch einem vom »Soldatenvolk« selbst gemachten höchst anrüchigen illegalen Text. Mich interessierten nur die Laiendichtungen, die nicht im Marschzug, sondern am Straßenrand die Runde machten. Zu schmissiger Marschmusik mit zündenden Melodien schmetterte man gänzlich unmilitärisch: »Dass die Kuh mehr kackt wie die Nachtigall, na das ist doch allemal der Fall. Sie sollten sich was schämen, dafür noch Geld zu nehmen« oder »Die Marie steht da im Hemd, hat vier Finger in den Arsch geklemmt, und sie denkt sich so im Sinn, wo steck’ ich nur den Daum’ noch hin« oder auch nur witzlos »107, 107, auf der Straße wächst der Priem«. Das Regiment 107 hatte seine Kaserne in Leipzig. Von der Landwehr bis zum Kautabak verdanke ich also bedeutende Erkenntnisse meines ersten Lebensjahrzehnts den sozusagen militärkritischen Liedtexten. Dass mir Militärmusik trotzdem vor allem Gänsehaut verursacht, hängt mit der späteren Zeit zusammen.
Übrigens hatten wir noch im Musikunterricht an der Schule Gelegenheit, sogar der 200 Jahre zurückliegenden militärischen Vergangenheit der deutschen Lande nachzuhängen. Das war ein Steckenpferd unseres Musiklehrers. Zuerst kamen die bekannten Gesänge aus dem frühen 19. Jahrhundert mit der Würdigung eines monogamen Angehörigen der Reitertruppe »Es war einmal ein treuer Husar, der liebt’ sein Mädchen ein ganzes Jahr« und der Klage über den Mangel an Wehrpflichtigen in manchem Ort »Lippe-Detmold eine wunderschöne Stadt, darinnen ein Soldat, ei der muss marschieren in den Krieg«. Ei, fallera, trallala, juhu und hurra waren über Jahrhunderte die häufigsten Lückenbüßer in den Texten. Dann aber wurde es für mich als sächsischem Hobbyhistoriker spannend. Was sangen die beiden Seiten im Siebenjährigen Krieg? Da gehörte doch Sachsen wie so oft in der Geschichte zu den Verlierern. Für den Lehrer war das eine Gratwanderung. Wir lebten in einer sächsischen Stadt, und es galt, dem heimatlichen Lokalpatriotismus ebenso genüge zu tun wie der preußischen Vorherrschaft im Reich.
Als erstes lernten wir, schließlich waren die Wettiner aufseiten der Habsburger, eine emphatische österreichische Lobeshymne auf den Kriegshelden Ernst Gideon Freiherr von Laudon, der die Preußen in einer Bataille in Böhmen geschlagen hatte: »General Laudon, Laudon greift an, mit hunderttausend Mann greift General Laudon an, General Laudon, Laudon greift an.« Gleich danach wurden wir mit der Kehrseite konfrontiert: »Und Friederich der Große, der zeigt’s den Feinden an. Er ziehet ein in Sachsenland, zwei Schwerter in der Hand.« Ob ihn beim Einziehen nicht behinderte, dass er keine Hand frei hatte, erfuhren wir nicht, dafür aber, mit welchen Worten Fridericus Rex, unser König und Held, nach der von Carl Loewe vertonten Meinung des Dichters Willibald Alexis (1798 –1871) angehende Kriegswitwen tröstete: »Nun adjö, Luise, wisch ab das Gesicht. Eine jede Kugel die trifft ja nicht, denn träf ’ jede Kugel apart ihren Mann, wo kriegten die Könige ihre Soldaten dann?« Wer auch nach diesem überzeugenden Argument nicht bereit war, frohen Herzens Abschied zu nehmen, dem war wohl wirklich nicht zu helfen.
Wenn Judenblut vom Messer spritzt
Mit den Naziliedern war es noch eine andere Sache. Ich habe die braunen Horden immer nur gefürchtet und gehasst, denn meine Mutter war Jüdin, mein Vater linker Sozialdemokrat. Wenn durch die schmale Leipziger Straße in Crimmitschau, in der wir wohnten, aus den Kehlen von hundert Braunbehemdeten geschmettert wurde »Es zittern die morschen Knochen«, dann zitterten bei mir nicht nur die. Und die Nazis marschierten viel. Fast täglich hörte ich, hinter der Gardine stehend, das drohende Gebrüll: »Wir werden weiter marschieren, wenn alles in Scherben fällt. Denn heute gehört uns Deutschland und morgen die ganze Welt.«
In der Phantasie des politisch frühreifen Erstklässlers, der ich war, entstand so eine erste Vorahnung von dem Schrecklichen, das kommen sollte: Um die ganze Welt zu erobern, wollen sie alles in Scherben schlagen. In Klemperers »LTI« kann man lesen, dass offenbar auf Weisung des Goebbelsschen Propagandaministeriums das »gehört uns« entschärft und daraus »da hört uns« gemacht worden ist, aber ich bin bereit zu beschwören: In Crimmitschau haben sie, wie es Klemperer auch aus Dresden kannte, immer »gehört uns« gesungen.
Bei einem zweiten Lied, das mir Grauen verursachte, habe ich mich geirrt – beim Horst-Wessel-Lied »Die Fahne hoch«. Sie sangen: »Kam’raden, die Rot Front und Reaktion erschossen, marschier’n im Geist in unser’n Reihen mit.« Ich verstand es aber in meiner Angst anders: mit einem Ausrufezeichen hinter dem »erschossen« und weiter mit »Marschiert im Geist«. So wurde aus dem Ganzen ein Befehl, die Aufforderung, »Rot Front und Reaktion« zu erschießen. Erst etliche Jahre später merkte ich meinen Irrtum, der wohl der Wahrheit um vieles näher kam als der richtige Text. Keine festliche Gelegenheit verging, ohne dass ich dieses Lied ertragen musste, da es zur offiziellen Hymne der Nazipartei gemacht wurde und stets im Anschluss an das »Deutschlandlied« ertönte. Jedes Mal hörte ich, wenn auch fälschlich, aus dem ganzen Gesang vor allem die Aufforderung zum Erschießen der politischen (und selbstverständlich erst recht der »rassischen«) Gegner. Selbst wenn man deshalb meine vaterländische Gesinnung in Zweifel ziehen sollte, gestehe ich, dass in mir noch heute schon bei den ersten Tönen der Nationalhymne die schreckliche Erinnerung an die mörderische Kombination von »Deutschland, Deutschland über alles, über alles in der Welt« und »Die Fahne hoch, die Reihen dicht geschlossen. SA marschiert mit ruhig festem Schritt. Kam’raden, die Rot Front und Reaktion erschossen ...« hochkommt.
Tasuta katkend on lõppenud.