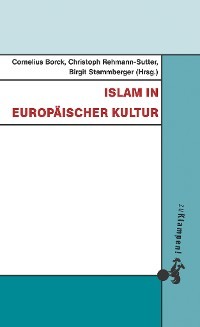Loe raamatut: «Islam in europäischer Kultur»
Cornelius Borck, Christoph Rehmann-Sutter, Birgit Stammberger (Hg.)
Islam in europäischer Kultur

© 2017 zu Klampen Verlag · Röse 21 · 31832 Springe www.zuklampen.de
Umschlaggestaltung: Groothuis. Gesellschaft der Ideen und Passionen mbH · Hamburg
Satz: Germano Wallmann · Gronau · www.geisterwort.de
E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH 2017
ISBN 978-3-86674-686-2
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über ‹http://dnb.dnb.de› abrufbar.
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Einleitung der Herausgeber
Rifa’at Lenzin
Wie öffentlich darf Religion sein?
Richard Nennstiel
Christlich-islamischer Dialog im Wandel von Geschichte und Politik
Ulrich Rebstock
Zahlenwanderungen – und wie die Christen arabisch zählen lernten
Ahmad Milad Karimi
Islamisches Denken in der Gegenwart
Die Autoren
Anmerkungen
Einleitung
Der Islam gehört seit Jahrhunderten zur Vielfalt von Strömungen in Europa. Unzweifelhaft ist der Islam deshalb Teil europäischer Kultur. Dieses Offensichtliche gerät aber in den gegenwärtigen identitätspolitischen Auseinandersetzungen um Europa aus dem Blick. Im Kontext einer »neuen Islamophobie« (Vincent Geisser1), in den Reden und politischen Programmen der neopopulistischen Bewegungen ist umstritten, wie und ob der Islam zu Europa gehören soll. Einige wollen Europa als öffentlichen Raum ohne Islam definieren. Es geht um Ein- und Ausschluss, um die Sichtbarkeit von Religion, um das Verständnis von Zugehörigkeit, um Laizität, um kulturelle Leitbilder. Die Beiträge des Buches nehmen diese Debatte zum Anlass, um auf verschiedenen Ebenen und von verschiedenen Seiten der Frage nachzugehen, wie der Islam Teil europäischer Kultur ist.
Der Titel des Buches ist mit Bedacht gesetzt. Er verbindet den Islam nicht nur mit europäischer Kultur, sondern denkt diese auch dynamisch und plural, sowohl was die Vergangenheit und die Gegenwart als auch was die Zukunft anbelangt. Europäische Kultur ist das, was zwischen den Menschen, die in Europa im Kontext unterschiedlicher Religionen und Konfessionen leben, geschah und geschieht. Sie ist auch das, wie sich europäische Gesellschaften zu Gesellschaften außerhalb Europas verhalten. Insofern sind die Missionen, die Eroberungen, der Kolonialismus und die beiden Weltkriege auch ein Teil der europäischen Geschichte. Zu ihr gehören aber auch die kritische Aufarbeitung und die Auseinandersetzung mit schwierigen Erinnerungen als Vergegenwärtigung von Vergangenheit. Europa ist nicht nur ein Territorium, sondern eine aus ihren inneren Differenzen und Widersprüchen heraus lebendige Kultur, die nicht fertig vorliegt, sondern die vor allem das ist, was sie wird. Und das bedeutet auch, dass die europäische Kultur das ist, was wir aus ihr machen.
Die Auseinandersetzung mit dem Thema Islam schreibt sich in die jeweiligen speziellen Geschichten der Länder Europas unterschiedlich ein. Die Pariser Soziologin Nilüfer Göle und ihr Team beobachteten in dem transnationalen Befragungsprojekt »Euro-PublicIslam« die höchst unterschiedlichen Erscheinungsweisen des Islam in Europa.2 Verschiedene muslimische Lebensformen in verschiedenen historischen und politischen Kontexten stoßen auf unterschiedliche Logiken von Islamophobie. Es haben sich Modelle herausgebildet: etwa das britische Modell der Multikulturalität, das mit der Brexit-Abstimmung 2016 an die Grenzen der realpolitischen Wirklichkeit gestoßen ist; das aus den innerchristlichen Konfessionskriegen zur Befriedung des Staates entstandene französische Modell der Laizität, mit dem Kruzifixe in Schulzimmern verboten sind, in dem nun aber nicht deutlich ist, ob an einem südfranzösischen Badestrand Burkinis getragen werden dürfen; oder die im deutschen Kontext behauptete christliche Leitkultur des Abendlandes, die deutliche Zeichen des Anachronismus mit sich führt.
Trotz dieser Unterschiede wird die Angst vor ›dem Islam‹ und das Zerrbild einer ›Islamisierung‹ politisch transnational bewirtschaftet, um Allianzen zu finden. Vorurteile werden aktiv geschürt. Dabei wird der Islam als fremd und nichteuropäisch konstruiert. Wie der Soziologe Vincent Geisser argumentiert, ist die neue Islamophobie nicht eine Reaktualisierung eines zum Teil älteren antiarabischen, antimaghrebinischen und flüchtlingsfeindlichen Rassismus. Der Begriff bezeichnet das Phänomen deshalb genauer, weil er die Spaltung eines ›wir‹ von ›denen‹ und damit die Angst vor ›jenen‹ klar zu Tage bringt und weil seine Referenz nicht ethnisch, sondern religiös ist. Diese Religion darf nicht (oder zumindest nicht zu deutlich) sichtbar sein. Das Verrichten von Freitagsgebeten auf öffentlichen Plätzen beispielsweise ist in europäischen Ländern ein Ärgernis, das von Muslim_innen deshalb meist vermieden wird. Der Begriff der Islamophobie ist präziser als der einer Xenophobie, die sich auf alles Fremde richten könnte. Islam in europäischer Kultur will dieser Islamophobie entgegentreten und betont die tiefe Verwobenheit von europäischer Kultur und Islam. Dazu soll den Verflechtungen in der Vielzahl ihrer Bedeutungen als Geschichte von Gemeinsamkeiten und Differenzen nachgegangen werden.
Grundlage dieses Buches bilden vier Vorträge, die im Sommersemester 2016 im Studium generale der Universität zu Lübeck gehalten wurden. In dieser Zeit wurde in Deutschland von einer Flüchtlingskrise und von Obergrenzen gesprochen, zugleich war das öffentliche Klima aber auch von einem enormen bürgerlichen Engagement geprägt. Die Veranstaltung wurde getragen vom Zentrum für Kulturwissenschaftliche Forschung Lübeck (ZKFL) und verstand sich als das Engagement einer der Religion gegenüber aufgeschlossenen Bürger_innengruppe auf einer säkular-universitären Plattform. Es war weder eine Veranstaltung von Islam-Anhänger_innen noch ein Projekt im christlich-islamischen Dialog. In den Diskussionen ging es vielmehr darum, das Verhältnis von Religion und Gesellschaft genauer auszuloten und den Islam im Verhältnis der verschiedenen europäischen Kulturen näher anzuschauen. Weil die Veranstaltung auf außerordentlich großes Interesse stieß und rasch die Nachfrage nach den Texten entstand, vor allem aber auch deshalb, weil wir die Vorträge für nachlesenswert halten, haben wir uns entschlossen, aus den Beiträgen ein Buch zu machen.
****
Wir und der Islam, die Deutschen und die Muslime, wir und die anderen – solche Formulierungen finden sich derzeit in Talksendungen, Feuilletons und auch in der Alltagssprache. Doch was heißt es eigentlich, das Verhältnis zwischen Deutschen und Muslimen in einem ›Wir Deutsche‹ und ›Die Muslime‹ zu bestimmen, und wer ist gemeint, wenn ›wir‹ von einem ›wir‹ sprechen? In seiner Betrachtung über Muslim_innen in Deutschland problematisiert Navid Kermani Identitätskonzepte, die uns zunächst vertraut erscheinen.3 Die Einordnung, sich über ein ›Wir‹ mit diesem oder jenem zu identifizieren, ist zunächst ein normaler, alltäglicher Akt, den wir beständig ausführen.
Die Vorstellung eines einheitlichen und ungebrochenen ›Wir‹ gründet aber auf einer problematischen Auffassung von Identität. ›Wir‹ zu sagen, setzt Identität immer schon als gegeben voraus und gründet damit auf einem kollektiven Konzept von Identität, das einer Projektion entspringt. Denn kollektive Identität entsteht erst in Prozessen der Identifikation. Es gibt keine eigene Identität ohne das Andere; das Eigene ist allenfalls im Singular mit sich selbst identisch. Ein identitäres ›Wir‹ überträgt die Gleichheit einer Sache auf problematische Weise auf eine Gruppe, für die es keine Identitäten in einer bereits schon feststehenden singulären Form gibt. Jede Gruppenidentität setzt sich aus vielen Identitäten zusammen. In diesem Sinne ist Identität hier nicht von sich selbst her, sondern immer vom Anderen her zu denken und in ihrer Pluralität anzuerkennen. Das Andere ist die Bedingung dafür, dass es überhaupt Eigenes geben kann. Die problematische Konstruktion eines einheitlich gedachten ›Wir‹ übersieht die Tatsache, dass die Möglichkeit von Identität erst über den Anderen gegeben ist. Die Vorstellung einer ungebrochenen und vom Anderen radikal abgetrennten Identität negiert den Anderen in seiner konstitutiven Funktion und grenzt das Andere bzw. den Anderen gewaltsam aus. Für Kermani liegt in der Annahme einer »einzigen Identität« deshalb ein »Gewaltpotential«, das aus der »pragmatischen Einschränkung, die jede Art von Identifizierung bedeutet, eine reale Verstümmelung der Persönlichkeit« macht.4 Die Anerkennung einer schon immer plural verfassten, in sich gespalteten Identität, fordert letztlich auch eine Art der Selbstbeschränkung, die jedes Identitätspostulat anerkennen muss.
Was mit dieser Einsicht gewonnen wird, ist die Möglichkeit eines offenen Dialogs. Um überhaupt in einen Dialog treten zu können, ist zunächst ein Akt der Selbstbeschränkung und Selbsttransformation notwendig. Denn erst die Anerkennung der Tatsache, dass sich über kulturelle Identität nur sprechen lässt, wenn Alterität mitgedacht wird, schafft die Möglichkeit des Dialogs, nämlich in einer ebenso selbstkritischen wie erkenntniskritischen Haltung gegenüber Identität. In dem prekären Balanceakt, zwischen dem Eigenen und dem Anderen das Wagnis einzugehen, vermeintlich eigene Sicherheiten aufs Spiel zu setzen, wird der Raum eröffnet, um miteinander ins Gespräch zu kommen.
Kermanis Plädoyer für eine Politik der epistemischen Selbstbeschränkung heißt letztlich auch auszuhalten, dass Identität niemals ein Wesensmerkmal von Personen ist, sondern erst über Verfahren der Ein- und Ausgrenzung hergestellt wird. In diesem Sinne ist Identität ein eminent politischer Begriff, denn Individuen können Identität erst über bestimmte Normen und Wertvorstellungen herstellen, die geteilt werden müssen. Deshalb basiert die Vorstellung einer kulturellen Identität auf einer Projektion. Kultur lässt sich nicht auf einen Nenner bringen, sondern gründet auf Konzepten der Alterität und Pluralität. Schon in dem zunächst harmlosen Bemühen, Identität festzustellen, liegt bereits eine gewaltsame Seite kollektiver Identifikation. Denn die für diesen Diskurs der kulturellen Selbstbehauptung notwendigen Prozesse der Ein- und Ausgrenzung können nicht ausgeschlossen bleiben. Die oft beschworene Formel einer kulturellen (europäischen) Identität stellt also eine Konstruktion dar, die dann gefährlich wird, wenn damit die Bemühungen der Fest-Stellung eines allseits verbindlichen Konzepts, eines homogenen Gebildes verknüpft sind. Was auf den ersten Blick harmlos erscheint, wird dann problematisch, wenn mit dem Begriff von Identität normative Aufforderungen gesetzt und politisch instrumentalisiert werden. Demgegenüber liegt die ebenso zivilisatorische wie politische Aufgabe einer Kultur gerade darin, Unschärfen, Unsicherheiten und Ambivalenzen von Identität auszutarieren, statt sie einer gemeinsamen Identität zu unterstellen.
****
Es gibt keine Positionierung außerhalb der uns umgebenden Bedingungen. Vielmehr entsteht auch individuelle Identität nur aus den Verbindungen heraus, in die wir immer schon eingelassen sind. Mit diesem Gedanken schließen wir an Judith Butlers Konzept des Angewiesenseins an: Das Subjekt lässt sich keineswegs als Zentrum eines bedingungslos Über-sich-Verfügens denken, sondern es wird erst im Austausch mit anderen und damit im Modus der Ent-Eignung konstituiert: »Wir werden vom Anderen dekomponiert«, schreibt Butler und betont damit die Verwiesenheit eines exponierten und zum Anderen hin geöffneten Selbst.5 Deshalb muss auch eine Politik der Identität und Selbstbestimmung eingestehen, dass selbst noch ein generalisiertes ›Wir‹ sich allein über Prozesse der Ausgrenzungen konstituieren lässt und in jeder Form eines kollektiven ›Wir‹ immer schon die Möglichkeit von Kritik bereits eingeschlossen ist. Die nur scheinbar einfache Frage: »Wer gehört dazu?« öffnet sich einem Hinterfragen: Für wen spreche ich und was ist die Position, von der her ich spreche? Bei Fragen nach Identität und Subjektivität sind diese Verflechtungen und Verstrickungen der eigenen Position mitzudenken, bevor wir politische Selbstbehauptungen aufstellen. Weil diese Ambivalenzen weder ausgeräumt noch verhindert werden können, kann erst aus ihrer Anerkennung individuelle wie politische Handlungsfähigkeit entstehen.
In diesem Sinne möchte der Band einen Beitrag für eine Kultur des gegenseitigen Zuhörens leisten. Dazu müssen zunächst wichtige Hintergrundinformationen geliefert werden, um mit der erforderlichen Sorgfalt thematisieren zu können, welche Hindernisse bestehen, welchen Grund die Schwierigkeiten haben und wie sie entstanden sind. Kommunikative Dissonanzen sind ebenso ein kulturelles Phänomen wie der Umgang mit ihnen und die Suche nach Verständigung. Kommunikationshemmnisse entstehen, wenn Menschen mit unterschiedlichen Vorgeschichten und Lebensformen aufeinandertreffen. Im umsichtigen Umgang mit anderen können sie zu Kommunikationskernen werden. Der ethische Kerngehalt von ›Integration‹– ein aktuelles Schlagwort – ist die Anerkennung. Anerkennung kann, wie es Hegel 1805 formulierte, nur als wechselseitiges Verhältnis, als Beziehung, gedacht werden: »Der Mensch wird notwendig anerkannt und ist notwendig anerkennend.«6
Mit den hier versammelten Beiträgen von zwei europäischen Islamforschern und zwei muslimischen Intellektuellen werden solche auf wechselseitige Anerkennung ausgerichteten Perspektiven zur Auseinandersetzung mit dem Islam eröffnet: Es geht um zeitbezogene Alltagsbeobachtungen zur Ausgrenzung islamischer Kultur (Rifa’at Lenzin), um die Verflochtenheit von Islamfeindlichkeit und europäischer Kolonialgeschichte (Richard Nennstiel), um die verschlungenen Pfade der Überlieferung antiken Wissens (Ulrich Rebstock) sowie um die existenzielle Dimension religiösen Denkens in der Gegenwart (Ahmad Milad Karimi). Als Herausgeber wollen wir mit diesen Texten dazu beitragen, Denkräume und Vorstellungswelten zu erkunden, Einseitigkeiten aufzubrechen, Ambivalenzen auszuloten und so Vorurteile abzubauen. Jenseits von Stereotypen wird der Islam als Kultur befragt und gleichzeitig im Kontext europäischer Kulturen zur Sprache gebracht. Wir verstehen die Texte als eine Aufforderung, Handlungsweisen vielstimmiger zu machen.
Wir danken der Hanseatischen Universitätsstiftung für die Unterstützung des Studium generale in Lübeck und Brita Dufeu für die sorgfältige Betreuung der Manuskripte.
Cornelius Borck, Christoph Rehmann-Sutter und Birgit Stammberger
Wie öffentlich darf Religion sein?
Rifa’at Lenzin
»Jede Person [hat] das Recht, ihre Religion und ihre weltanschauliche Überzeugung frei zu wählen und allein oder in Gemeinschaft mit anderen zu bekennen«, steht in Artikel 15 der Schweizerischen Bundesverfassung. Das schließt die Öffentlichkeit des Bekenntnisses zumindest nicht aus. Die aktuelle Diskussion um religiöse Symbole im öffentlichen Raum dreht sich aber in der Regel nicht um Kirchtürme, Kreuze am Wegesrand oder auf Berggipfeln. Auch nicht um christliche Ordenstrachten, buddhistische Mönchsroben oder jüdische Kippas. Für Aufregung sorgen vielmehr Kopftücher, Minarette und vereinzelte Burkas. Religion scheint also nicht gleich Religion zu sein. Oder anders gesagt: Es gibt offensichtlich Religionen, die in der Öffentlichkeit präsent sind und sein dürfen, andere eher weniger oder am liebsten gar nicht.
Was die Ablehnung von bestimmten religiösen Gruppen angeht, so hängt diese von verschiedenen Faktoren ab und ist durchaus wandelbar. Richtete sich diese Ablehnung vor nicht allzu langer Zeit vor allem gegen Juden, so stehen heute unangefochten Muslime im Fokus. Sie werden in einer Zeit, die durch wirtschaftliche Unsicherheit, Gewalt und Terrorismus geprägt ist, zunehmend als Gefahr wahrgenommen.
Wer aber sind diese Muslime?
Bericht des Bundesrates zur Situation der Muslime in der Schweiz
Im Mai 2013 veröffentlichte der Schweizer Bundesrat (Schweizer Regierung) die Ergebnisse einer Untersuchung zur Situation der Muslime in der Schweiz. Ziel des Berichts war, »die wesentlichen Charakteristiken der muslimischen Gemeinschaften in der Schweiz zu erfassen, Berührungspunkte und mögliche Spannungsfelder in ihrem Verhältnis zur schweizerischen Mehrheitsgesellschaft und den Behörden zu benennen sowie Handlungsoptionen und Konfliktlösungsmechanismen aufzuzeigen, die sich in der Praxis bewährt haben. Zudem soll eine Übersicht zu den aktuellen Integrations- und Dialogbemühungen auf staatlicher Ebene gegeben werden.«7
Der Bericht wurde auf der Grundlage des aktuellen Forschungsstands erstellt. Der wesentliche Befund ist, »dass hinsichtlich der Berührungspunkte zwischen staatlichen Behörden und Menschen muslimischen Glaubens sich der Dialog und die pragmatische, einzelfallorientierte Lösungsfindung vor Ort bewährt haben. Gravierende Differenzen religiöser Natur sind häufig personenbezogene Einzelfälle.«8
Der Bericht stellt ebenfalls fest: »[R]und ein Drittel der in der Schweiz lebenden Muslime verfügt über das Schweizer Bürgerrecht. Somit sind nicht nur Ausländerinnen und Ausländer von islamfeindlichen Einstellungen betroffen, sondern vermehrt auch Schweizer Bürgerinnen und Bürger. Entsprechend bedeutet die Bekämpfung von Diskriminierung nicht nur eine integrationspolitische Herausforderung.«9
Ein weiterer wesentlicher Punkt des Berichts ist, dass »die Unterscheidung zwischen Religions- und Migrationskontext für eine lösungsorientierte Diskussion über die Muslime und den Islam in der Schweiz zentral ist«.10 Wie wichtig die Trennung dieser beiden Aspekte (Religion und Migration) ist, kommt auch in Bezug auf die Frage von religiösen Symbolen im öffentlichen Raum und insbesondere in der Frage des Tragens eines Kopftuchs an Schulen zum Ausdruck. Bei einem Kopftuchverbot an Schulen oder einem möglichen Burkaverbot geht es eben nicht um Fragen der Integration, sondern einzig und allein um Religionsfreiheit respektive deren Einschränkung. In der Pressemitteilung war allerdings von dieser eminent wichtigen Differenzierung nicht mehr die Rede.
So schön so gut. Was ist denn eigentlich das Problem mit dem Islam oder mit den Muslimen? Wie erklärt es sich, dass die Schweiz seit 2009 ein Minarettverbot in der Bundesverfassung hat? Der Bau von Minaretten ist also verboten – das bei gerade mal zwei Moscheen, die als solche gebaut und von der Architektur her eindeutig als solche zu erkennen sind. Und wie erklärt es sich, dass seit 2013 im Tessin das Tragen einer Burka verboten ist? Es gibt zwar keine im Tessin lebenden Burkaträgerinnen, aber für die Mehrheit, die für das Verbot stimmte, spielte das offensichtlich keine Rolle.
Die politische Diskussion
Wie auch im übrigen Europa findet der gesellschaftspolitische Diskurs betreffend Migration und Integration in der Schweiz ebenfalls immer öfter vor dem Hintergrund der muslimischen Präsenz im Land statt.
Bis in die 1990er Jahre hinein wurde die Existenz von Muslim_innen in der Schweiz weder von Politik und Gesellschaft noch von der Wissenschaft zur Kenntnis genommen. Sie waren Gastarbeiter_innen – Türk_innen, Araber_innen, Jugoslaw_innen –, Ausländer_innen eben. Die Migrationsforschung beschäftigte sich zwar mit ›Gastarbeitern‹ aus der Türkei oder Jugoslawien, betrachtete sie jedoch allein unter soziologischen Gesichtspunkten. Die Andersartigkeit dieser Menschen in religiöser Hinsicht wurde weitestgehend ausgeblendet. Die religiösen Einstellungen und Aktivitäten der Muslim_innen interessierten kaum und wurden – wenn überhaupt – als Randerscheinung ohne jegliche Relevanz für die Mehrheitsgesellschaft aufgefasst. Bis vor Kurzem galt es gerade bei Sozialwissenschaftler_innen als ausgemachte Sache, dass ›Religion‹ sozusagen ein Auslaufmodell der Geschichte sei und in absehbarer Zeit kein gesellschaftlich relevanter Faktor mehr sein würde.11
Die große Mehrheit der Gastarbeiter_innen in der Schweiz und in Deutschland kam aus säkularen Staaten, die zudem ein sehr gespaltenes Verhältnis zu Religion hatten: aus der laizistischen Türkei einerseits und dem kommunistischen und postkommunistischen Jugoslawien andererseits. Nebst den ›Gastarbeitern‹ im eigentlichen Sinn kamen aber auch zahlreiche Student_innen und Akademiker_innen in die Schweiz, einige religiös, andere nicht, die meisten stammten aus städtischen Mittelstandsfamilien, die westlichen Einflüssen und westlichem Denken – gerade was das Verhältnis zur Religion anging – häufig sehr positiv gegenüberstanden. Insbesondere religiöse Menschen empfanden das Klima in den 1980er Jahren in der Schweiz als sehr offen – sie hatten oft erstmals in ihrem Leben das Gefühl, ihre Religion frei von staatlichen Zwängen ausleben zu können. Das hat sich in der Zwischenzeit gründlich geändert.
Diese Wahrnehmung bzw. Nichtwahrnehmung in religiöser Hinsicht änderte sich 1989 anlässlich der Rushdie-Affäre, als Muslime insbesondere in Großbritannien in großer Zahl aus religiösen Gründen gegen die Veröffentlichung der »Satanischen Verse« protestierten und ein Verbot des Buches verlangten. Auch den Muslimen wurde ihr religiöses Anderssein bzw. dessen rechtliche Konsequenzen nun erstmals bewusst: Die Rushdie-Affäre brachte ihnen nämlich mit aller Deutlichkeit zu Bewusstsein, dass die britischen Gesetze ausschließlich die Angehörigen der christlichen Religion schützten und dass es keine Gesetze gab, die die Muslim_innen vor religiöser Diskriminierung bewahrten.12
Als viele Muslim_innen in Großbritannien 1991 gegen den ersten Golf-Krieg protestierten, wurde ihre Opposition nicht als demokratisches Recht auf freie Meinungsäußerung interpretiert, sondern sie galten plötzlich als potenziell Subversive, als Fünfte Kolonne, als Illoyale einem Staat gegenüber, der sich im Kriegszustand befand.13 Obwohl sich die Aufregung nach und nach wieder etwas legte, blieb als gefährliche Hinterlassenschaft ein allgemeines Misstrauen gegenüber den Muslim_innen zurück.
Der große Bruch in der Wahrnehmung geschah im Gefolge des 11. September 2001. Aus Türk_innen, Araber_innen, Ex-Jugoslaw_innen, Pakistani wurden praktisch über Nacht ›Muslime‹. Es bildete sich ein Diskurs heraus, der bis heute anhält und den die deutsche Sozialpädagogin Iman Attia folgendermaßen charakterisiert: »Indem politische, gesellschaftliche und soziale Phänomene zunehmend mit ›der Religion‹ der anderen verknüpft werden, können eigene Anteile an diesem Phänomen und am problematischen Verhältnis zueinander geleugnet werden. Die Lage der Anderen wird mit deren ›Kultur‹ begründet, die wesentlich durch ›ihre Religion‹ geprägt sei; ›der Islam‹ sei für desolate Zustände verantwortlich und eine Gefahr.«14
Francis Matthey, der ehemalige Präsident der Eidgenössischen Kommission für Migrationsfragen (EKM), machte eine auffällige Wahrnehmungsverschiebung in der schweizerischen Öffentlichkeit aus: Zwar habe es schon immer Fragen im Umgang mit Muslimen in der Schweiz gegeben, etwa die Diskussion um das Kopftuch im öffentlichen Raum, um den Dispens vom Schwimmunterricht oder um die Einrichtung spezieller Grabstätten auf Friedhöfen. Doch spätestens seit der Lancierung der Initiative »Gegen den Bau von Minaretten« sei »ein neuer Ton« im Umgang mit der muslimischen Bevölkerung festzustellen. So würden Muslim_innen »vermehrt mit Vorkommnissen in der islamischen Welt in Verbindung gebracht, so als befürworteten sie insgeheim die Anwendung von Körperstrafen […], als wären sie (mit-)verantwortlich für terroristische Anschläge islamistischer Gruppierungen oder als müssten sie für konservative Ausprägungen des Islams anderswo geradestehen.«15 ›Der Muslim‹ entwickelte sich demnach zu einer Projektionsfläche für jedwede Problematik in Verbindung mit dem Islam und vermeintlich spezifisch ›islamischen‹ Phänomenen wie religiösem Fanatismus, religiöser Intoleranz oder religiöser Gewalt.
Das ist zwar eine zutreffende Analyse des Ist-Zustands und wohltuend unaufgeregt, erklärt aber immer noch nicht, weshalb sich der Islam bzw. die Muslime zu dieser Projektionsfläche für alles Negative entwickeln konnten.
Obschon mehrere Studien und auch der Bericht des Bundesrates vom Mai 2013 den Muslimen bescheinigen, sie seien in ihrer großen Mehrheit gut integriert und es seien keine spezifischen Maßnahmen nötig, um sie besser zu integrieren,16 gewinnt man in den Diskussionen und öffentlichen Debatten um den Islam und die Muslime ein ganz anderes Bild. In den westlichen Ländern und auch in der Schweiz lässt sich seit einiger Zeit ein zunehmend islamkritischer Diskurs feststellen. Dieser kann – wie diverse europäische Instanzen kritisieren17 – auch islamfeindliche Formen annehmen, und es wird die Integrationsfähigkeit der Muslime als Ganzes in Frage gestellt.
Dabei wird die islamische Verhüllung per se oft zum politischen Symbol und Zeichen mangelnder Integrationsbereitschaft hochstilisiert. Analog zu entsprechenden Bemühungen in europäischen Staaten wie Frankreich oder Belgien gibt es gegenwärtig auch in der Schweiz etliche Vorstöße auf kantonaler oder Bundesebene, die entweder ein generelles Kopftuchverbot in Schulen und/oder ein Burkaverbot im öffentlichen Raum zum Ziel haben.
Bisher verneinten Bundesrat und Parlament einen Regelungsbedarf. Im Sinne einer pluralistisch gefassten Integrationspolitik stellte sich der Bundesrat auf den Standpunkt, dass Angehörige unterschiedlichster religiöser Bekenntnisse, die sich in ihrem Erscheinungsbild deutlich von der Bevölkerungsmehrheit abheben, durchaus willens und in der Lage sind, die Werte der Bundesverfassung zu respektieren. Gemäß Artikel 4 des Bundesgesetzes über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG) bedeute Integration nicht das vollständige Aufgehen in der Mehrheitskultur, sondern das Sich-Einfügen in eine demokratisch und rechtsstaatlich organisierte Gesellschaft, die auf den Werten der Bundesverfassung sowie gegenseitiger Achtung und Toleranz beruht. Solange sich eine Frau aus freien Stücken für das Tragen einer Ganzkörperverschleierung entscheidet, seien auch ihre Grundrechte nicht verletzt.18
So neu, wie es einen die Diskussionen der letzten Jahre um Kopftuch und Burka in Europa, speziell in Frankreich, Belgien und der Schweiz, glauben machen könnten, ist dieser Konflikt allerdings nicht. Schon die Kreuzritter sind unter anderem ausgezogen, um die Sarazenenprinzessin zu ›befreien‹, wie überhaupt Befreien und Retten ein Leitmotiv und zugleich eine Legitimation für christlich-europäisches Hegemonialstreben zu sein scheinen. Den Kreuzrittern folgten im Zeitalter des Kolonialismus die Engländer und Franzosen, die als Eroberer in Ägypten und Algerien im Namen des Fortschritts – Stichwort mission civilisatrice – versucht haben, den Schleier zu verbieten, um dadurch die Frauen zu ›befreien‹. Das bisher jüngste Glied in dieser Kette von ›Befreiungsversuchen‹ war der Einmarsch von Amerikanern und Europäern in Afghanistan. Die Militärintervention mit dem Namen »Infinitive Justice«, später in »Enduring Freedom« umbenannt (George W. Bush hatte anfänglich noch von einem neuen »Kreuzzug« gesprochen, was zwar unklug, aber ehrlicher war), hatte nicht in erster Linie Rache für den Angriff von Usama bin Laden auf amerikanische Einrichtungen zum Ziel. Im Gefolge des »War on Terror«, so war in den hiesigen Medien zu lesen, sollten vor allem die afghanischen Frauen von der Burka befreit werden. Die Medien gaben damit getreulich wieder, was Laura Bush, die damalige First Lady, in einer Radiosendung vom 17. November 2001 vorgetragen hatte: »Because of our recent military gains in much of Afghanistan, women are no longer imprisoned in their homes. They can listen to music and teach their daughters without fear of punishment. The fight against terrorism is also a fight for the rights and dignity of women.«19
Das hehre Ziel, die bedauernswerten afghanischen Frauen aus den Klauen der blutrünstigen Taliban-Terroristen zu befreien, rechtfertigte also den Krieg und die Bomben. Dies entspricht genau dem, was die Literaturwissenschaftlerin und Philosophin Gayatri Chakravorty Spivak in ihrem berühmten Essay Can the Subaltern speak? als die Narrative von »White men saving brown women from brown men« beschrieben hatte.20
»Infinitive Justice« war 2001. Heute nun, fünfzehn Jahre und Hunderttausende von Toten später, ziehen die Invasionstruppen wieder ab – die Burka ist geblieben. Geblieben ist auch die Retter-Attitüde, wie der Fall von Malala Yousafzai zeigt, dem Mädchen, welches von den Taliban angeschossen und schwer verletzt worden war. Sie wurde nach Großbritannien ausgeflogen, gerettet und nach ihrer Genesung mit Auszeichnungen für ihren Mut im Kampf um Schulbildung für Mädchen überhäuft. Malala hätte allerdings ebenso gut Opfer von einem der zahlreichen Drohnenangriffe der Amerikaner werden können, die vielen Kindern in dieser Gegend nicht nur das Recht auf Ausbildung kosten, sondern das Leben. Es ist müßig zu fragen, ob die Reaktion der westlichen Öffentlichkeit in diesem Fall dieselbe gewesen wäre.
Zwei Fragestellungen bestimmen derzeit den westlichen Blick auf die nichtwestliche und insbesondere islamische Welt: Wie hält man es dort a) mit der Demokratie und b) mit den Frauenrechten? Selbstredend gilt dabei die westliche Sicht als maßgeblich, wie auch das westliche Verständnis darüber urteilt, was als demokratisch gelten kann. Nicht anders verhält es sich mit der Genderfrage. Die Genderfrage ist geradezu zum Sinnbild schlechthin geworden für den angeblichen Wertekonflikt zwischen ›den Muslimen‹ und der westlichen Gesellschaft. Wobei das Kopftuch stellvertretend für die Defizite der islamischen Welt in Sachen Frauenrechte steht.