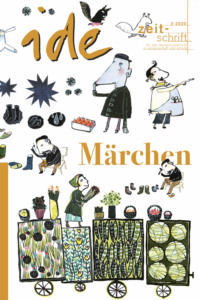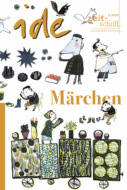Loe raamatut: «Märchen»

____________________________________
Editorial
NICOLA MITTERER:
Editorial
Magazin
Kommentar
Manuela Kapeller: Von einer, die auszog, aus der Distanz zu lehren …
ide empfiehlt
MATTHIAS LEICHTFRIED: F. Heizmann, J. Mayer, M. Steinbrenner (Hg., 2020): Das Literarische Unterrichtsgespräch
Neu im Regal
Märchen im Großen und Ganzen und en détail
STEFAN NEUHAUS: Über die allmähliche Verfertigung der Märchen beim Erzählen. Zur Entstehung der Gattung bei den Brüdern Grimm und E.T.A. Hoffmann
VIKTORIA WALTER: Das Kunstmärchen um 1800. Beispiele, Ausprägungen, Entwicklungstendenzen
Märchen und ihre unterschiedlichen kulturellen Ausprägungen
KARIN RICHTER: Das Märchen in einem interkulturellen, intermedialen und fächerübergreifenden Unterricht
ADAMS BODOMO: Ananse auf der Suche nach einem Narren. Ein Volksmärchen aus Afrika
POLONA ZAJEC: Mojca Pokrajculja. Die Perle der slowenischen Volksmärchen
Online: CAO LI: Mythos oder Märchen?
Adaptionen und Interpretationen von »Jing Wei Tian Hai«
Märchen in Bild und Text und in ihrer besonderen Struktur
JAN M. BOELMANN, LISA KÖNIG: »Es war einmal eine neue Welt …« Märchenerzählungen in virtuellen Realitäten
CLARA VON MÜNSTER-KISTNER: »Die habe ich, die sollen mir nicht wieder entwischen.« Zum Zusammenspiel von Bild und Text für die Erzeugung von Angst in Hänsel und Gretel-Bilderbüchern
HEIDI LEXE: Rotkäppchen-Verschwörungen. Multimediale Neu-Inszenierungen eines Volksmärchens
ANITA SCHILCHER, CHRISTINA KNOTT: Propps Märchentheorie als Ausgangspunkt für eine kompetenzorientierte Märchendidaktik
Märchenhaftes Theater
KATHARINA SCHMöLZER: Märchen und Theater. Ein Erfahrungsbericht aus dem Stadttheater Klagenfurt
Service
CLARA VON MÜNSTER-KISTNER: Märchenwelten. Bibliographische Hinweise
»Märchen« und »Erzählen« in anderen ide-Heften
| ide 2-2020 | Videospiele |
| ide 2-2019 | Verbalisieren. Zur Sprache kommen |
| ide 2-2018 | Textmuster und Textsorten |
| ide 3-2016 | Sehnsuchtsort Mittelalter |
| ide 3-2011 | Erzählen |
| ide 2-2002 | Bilderbuch |
| ide 4-2000 | Kinderliteratur aus dem Süden |
| ide 1-2000 | Schöpfungsmythen. Erzählungen vom Anfang |
| Das nächste ide-Heft | |
| ide 4-2020 | Spracherwerb und Sprachenlernen erscheint im Dezember 2020 |
| Vorschau | |
| ide 1-2021 | Interpretieren |
| ide 2-2021 | Wald |
https://ide.aau.at
Besuchen Sie die ide-Webseite! Sie finden dort den Inhalt aller ide-Hefte seit 1988 sowie »Kostproben« aus den letzten Heften. Sie können die ide auch online bestellen.
www.aau.at/germanistik/fachdidaktik
Besuchen Sie auch die Webseite des Instituts für GermanistikAECC, Abteilung für Fachdidaktik an der AAU Klagenfurt: Informationen, Ansätze, Orientierungen.
Editorial
»Ja, ja, so geht es in der Welt zu!« dachte der Tannenbaum und glaubte, es sei wahr, weil der Mann, der es erzählte, so nett war.
(Hans Christian Andersen 1980, S. 307)
Literatur und Unterricht sind gewissen Moden unterworfen, das Märchen aber ist im Leben wie in der Schule seit langer Zeit omnipräsent. Die Gründe dafür sind vielfältig und werden in vielen der Beiträge in diesem Heft benannt, allerdings vermögen diese nur in ihrer schwer beschreibbaren Gesamtheit einen Eindruck davon zu vermitteln, weshalb das Märchen bei all seiner Antiquiertheit so zeitgemäß, in seiner Einfachheit so faszinierend komplex wirkt und weshalb es trotz unzähliger literaler und visueller Interpretationen den Charakter eines oral vermittelten Erzählens beibehalten konnte. Wenn man sich Geschichten erzählt, ohne sie vorzulesen, beginnen diese meist mit »Es war einmal…«. Die weltweite Existenz märchenhafter Erzählungen lässt dabei vermuten, dass es einen tieferen Grund für unsere enge Verbundenheit mit diesem historisch und topographisch zwar jeweils verorteten, aber in seinen Motiven dennoch archaischen Genre gibt. Möglicherweise ist er darin zu finden, was Paul Good als grundlegenden Antrieb für das Geschichtenerzählen und die Sinnsuche des Menschen beschreibt. In Die Unbezüglichkeit der Kunst (1998) denkt er eingangs lange über die bildlich und textuell in unzähligen Ausführungen vorhandene, in seinen kulturellen Ausprägungen äußerst mannigfaltige Vorstellung des Einhorns nach, dessen reale Existenz nie nachgewiesen werden konnte. Das sei auch nicht nötig, so der Autor, schließlich erweise sich
auch ohne empirische Letztinstanz […] das Geschäft des Bedeutens keineswegs als chaotisch. Vielmehr lehrt uns die Geschichte des menschlichen Sinnierens und Selbstdarstellens, daß sich immer wieder die gleichen Erfahrungen, Hoffnungen, Vorstellungen in vielfachen Formen und Verwandlungen […] aussprechen. (Good 1998, S. 15)
Diese Annahme wird, wie der Autor ausführt, vom Interesse der Schüler_innen bestätigt, denn diese zeigen sich immer wieder aufs Neue und erstaunlich unabhängig von den Veränderungen der sozialen Realitäten von Märchen fasziniert. Auf höheren Schulstufen lässt sich dies insbesondere dann beobachten, wenn die »kleine Geschichte«, die oftmals zu Unrecht als eine »Geschichte für Kleine« missverstanden wird, beispielsweise durch anspruchsvolle Illustrationen wie etwa jene von Lisbeth Zwerger, Nikolaus Heidelbach, Kat Menschik oder Shaun Tan, durch Adaptionen, die jeweils unterschiedliche Aspekte der Ursprungs erzählung fokussieren, ausgestaltet, verändert und in jedem Fall neu und anders dargestellt wird. Gleich drei Beiträge in diesem Band werden auf diese »neuen Märchen« eingehen und in diesem Zusammenhang Ideen für den Unterricht bereitstellen, die auch noch in der Sekundarstufe II auf Interesse stoßen können (siehe dazu die Beiträge von Jan M. Boelmann und Lisa König, Clara von Münster- Kistner sowie Heidi Lexe). Ob das Märchen hier nun durch die Überführung in visuel le Formen des Erzählens, durch – mitunter antithetische – Umdeutungen der Figurenc harak terisie rung oder die Möglichkeit eines interaktiven Mitgestaltens einer ästhetisch zwar voll ausgeformten, in ihren inhaltlichen Aspekten aber variablen und konstruktiv erfahrbaren Welt grund legende Veränderungen erfährt, ist im Unterricht von den jeweiligen (technischen) Möglichkeiten und den Erkenntnisinteressen abhängig. Diese lassen sich auch über inhaltlich-thematische Bezüge hinausdenken und können etwa die Erzähltheorie betreffen, deren grundlegende Kate gorien sich am Märchen in seiner oft einfachen, daher »prototypischen« Struktur exemplifizieren und damit einüben lassen. Ein solcher Zugang gibt das Märchen als etwas nicht Zu fälliges und damit in seiner künst lerischen Gemachtheit zu erkennen, wobe i der Unterricht – vielleicht un er warte ter Weise – unterhaltsam und kurzweilig sein kann (siehe dazu den Beitrag von Anita Schilcher und Chris tin a Knott).
Insbesondere in der Zusammenschau dieser Neu- und Umarbeitungen alter Märchenstoffe und traditioneller Darstellungen wird sich den Leser_innen dieses Heftes das Genre auch als etwas Wundersames insofern präsentieren, als es in den verschiedenen Beiträgen sowohl als die literarische Form der Dichotomien par excellence erkennbar wird – wo sonst gibt sich das Gute und das Böse in der Literatur noch so eindeutig zu erkennen? – als auch als ein hybrides Genre, dessen selbst geschaffene, meist unumstößlich und starr wirkende Kategorien auf allen Ebenen der Kunst mit Leichtigkeit aufgebrochen, bei Bedarf auch in ihr Gegenteil verkehrt werden können. Ob der Wolf nun gut ist oder böse, Rotkäppchen Opfer oder Täterin, letztlich ist das zu einer Frage der medialen Auswahl geworden und lässt sich ebenso auf die eine wie auf die andere Weise beantworten. Gerade hier liegt wohl auch ein größtenteils noch unentdecktes didaktisches Potenzial des Literaturunterrichts mit Märchen, der in dieser Akzentuierung des performativen Potenzials zur Etablierung eines »weiten Blicks« der Schüler_innen, auch auf ethische Fragen, beitragen kann.
Während das Märchen in den Darstellungsformen der Graphic Novel und des Videospiels tendenziell Althergebrachtes infrage stellt, transformiert oder zumindest in neue Bezüge setzt, ist es andererseits auch das paradigmatische Genre des Bewahrens und Tradierens. In bestimmten kulturellen Ausprägungen des Märchens steht dieser Aspekt ebenso im Vordergrund wie die Fortführung einer im Westen längst nicht mehr omnipräsenten Erzählkultur (siehe dazu den Beitrag von Adams Bodomo), die sich im Unterricht aufs Neue etablieren ließe, ebenso wie eine interkulturelle Perspektive, die Verbindendes wie Unterschiedliches, mitunter auch Unvereinbares als unschätzbar wertvollen Beitrag zu einer diversen Gesellschaft umfassen kann. In diesem Sinne widersetzen sich Märchen den globalen Vereinheitlichungstendenzen, nicht zuletzt in ihren Erzählungen und in den unterschiedlichen Weisen des Erzählens.
Beachtlich ist in diesem Zusammenhang auch, wie weit das Märchen als Erzählform und einige seiner Motive gereist sind, wie vielfältig und mitunter hochartifiziell die Formen der visuellen und narrativen Rezeption dabei waren und sind. Gerade dieser Zugang, der beispielsweise ein längst bekanntes und eventuell langweilig gewordenes Märchenmotiv in völlig andere als die gewohnten Bezüge zu setzen vermag, kann für Schüler_innen aller Altersstufen in der Sekundarstufe I und II neue und unerwartete Einsichten ermöglichen und das vielleicht schläfrig machende Dornröschen in seiner wesentlich blutrünstigeren französischen Ursprungsversion wieder zum Leben erwecken (siehe dazu den Beitrag von Karin Richter). Um derlei (Ver-)Wandlungen ermessen und eventuell in eigenen produktiven Zugängen weiterspinnen zu können, bedarf es allerdings eines soliden Grundlagenwissens, das in diesem Heft insbesondere der Beitrag von Stefan Neuhaus in verständlicher und dennoch umfassender Form vermittelt. Dieser Artikel legt die geschichtliche Bedingtheit von Märchen und ihre Entstehungszusammenhänge dar und nimmt den hin und wieder verklärt dargestellten Kinder- und Hausmärchen der Gebrüder Grimm die politische Unschuld, indem er sie als ein (inter-)kulturelles Konstrukt zeigt, das heute immense urheberrechtliche Probleme aufwerfen würde und mit den Kunstmärchen, wie sie im deutschsprachigen Raum etwa Ludwig Tieck und E.T.A. Hoffmann hervorgebracht haben, nur entfernt verwandt ist. Dieses Wissen in den Unterricht miteinzubeziehen, ist aus Sicht der Herausgeber - innen unabdingbar, um eine Generation heranzuziehen, die sich der gesellschaftlichen Wirkkraft von Literatur und Kunst erst bewusst werdenmuss.
Zu guter Letzt wird sich das Märchen den Leser_innen dieses Heftes als ein Alleskönner präsentieren und jene, die es im Unterricht seit Jahren verwenden, werden daran nichts Überraschendes entdecken können. Das Märchen kann Vieles sein, einerseits etwa die Geschichte, die sich »das Volk« erzählt bzw. die es sich erzählen lässt, und dabei die Motive und Themen aufgreift, die uns im Alltag beschäftigen und die so sehr im Alltäglichen und im Existenziellen verwurzelt sind, dass sie auf der ganzen Welt auftauchen. So kann auch der Austausch zwischen Mensch und Tier und die Lehren, die sich aus deren Interaktionen ziehen lassen, durchaus als eine kulturübergreifende Konstante des Genres betrachtet werden, die auch in Adaptionen erhalten bleibt und ihre Wirkung tut (siehe dazu den Beitrag von Polona Zajec). Das Spektrum internationaler Märchen wird durch einen Beitrag aus China ergänzt (siehe den online-Beitrag von Cao Li, https://ide.aau.at/), der dem Zusammenhang der importierten literarischen Gattung Märchen mit Vorläufern in der chinesischen Tradition nachspürt. Andererseits kann das Märchen seine Form verändern, nicht mehr Volks-, sondern Kunstmärchen sein, nicht einfach, sondern reich an Figuren, kontextuellen, philosophischen und historischen Bezügen, selbstreferenziell und dabei nicht nur die Welt außen, sondern auch das eigene Wirken reflektierend (siehe dazu den Beitrag von Viktoria Walter). Kunstmärchen à la Friedrich de la Motte Fouqué und Ludwig Tieck haben ebenso wie das in Georg Büchners Woyzeck integrierte »Antimärchen« ihren Status als klassische Lektüre im Unterricht der gymnasialen Oberstufe behaupten können. Von didaktischem Interesse sind hier nicht zuletzt die Entstehungsgeschichte (auch: des Genres selbst) und die künstlerischen Anliegen der Verfasserinnen, wobei auch die Frage im Hintergrund immer bestehen bleibt, weshalb, auch ganz unabhängig von romantischen Tendenzen, die Literatur ohne das Märchen, dessen Motive und spezielle Erzählweise nicht auskommt – und das bis heute. Dieser Frage im Unterricht Platz einzuräumen, ist ein sinnhaftes Unterfangen, das vermutlich zu einem Nachdenken über die Bedeutung des Geschichtenerzählens einlädt. Für das Volksmärchen wie für das Kunstmärchen, bebildert, aufgeführt, animiert oder nicht, gilt, dass es eine Form der Bildung ermöglicht, die imponiert, ohne zu manipulieren:
Am ästhetischen Gebilde, und nur an ihm, haben wir gelernt, uns einer nicht-versklavenden Form von Autorität, einer nicht- repressiven Erfahrung von Rangdifferenz auszusetzen. Das Kunstwerk darf uns, den der Form Entlaufenen, noch etwas »sagen«, weil es ganz offensichtlich nicht die Absicht verkörpert, uns zu beengen. (Sloterdijk 2009, S.37)
Besonders deutlich spricht das Märchen dann zu uns, wenn es sich auf der großen Bühne präsentiert, mit Kostümierung, Bühnenbild, Stimme und anderen Varianten körperlicher Präsenz in Erscheinung tritt. Spätestens dann wird die vielleicht weit zurückliegende Vorleseerfahrung wieder lebendig und es wird deutlich, dass uns das Märchen in allen Lebensphasen etwas zu sagen hat (siehe dazu den Beitrag von Katharina Schmölzer). Die Frage nach dem Bedeuten und der Bedeutsamkeit des Märchens wird sich im besten Unterricht nicht abschließend klären und gleicht darin allen Erkenntnismöglichkeiten, die die Literatur betreffen.
Gewiss ist nur, es war einmal …
Clara von Münster-Kistner bietet im Serviceteil eine bibliographische Zusammenschau relevanter Publikationen zum Thema. Grenzen und Möglichkeiten des Distance Learning kommentiert Manuela Kapelle r. Matthias Leichtfried rezensiert und empfiehlt Das Literarische Unter richtsgespräch, weitere aktuelle Publikationen stellt Ursula Esterl vor.
Der besondere Dank der Heraus -gebe r_innen gilt der Illustratorin Renate Habinger, die uns für die Gestaltung des Covers Bilder aus dem wunderbaren Buch, gegen das kein Kraut gewachsen ist (Anger-Schmidt/Habinger 2010), zur Verfügung gestellt hat.
NICOLA MITTERER
Literatur
ANDERSEN, HANS CHRISTIAN (1980):Der Tannenbaum. In: Ders.: Sämtliche Märchen in zwei Bänden. Erster Band. München: Winkler, S.302–312.
ANGER-SCHMIDT, GERDA; HABINGER, RENATE (2010): Das Buch, gegen das kein Kraut gewachsen ist. Kräuter und Gewürze von Augentrost bis Zimt. Wien: Nilpferd bei Residenz.
GOOD, PAUL (1998): Die Unbezüglichkeit der Kunst. München: Fink.
SLOTERDIJK, PETER (2009): Du mußt dein Leben ändern. Über Anthropotechnik. Frankfurt/M.: Suhrkamp.
_________________________
NICOLA MITTERER und MARKUS PISSAREK forschen und lehren am Institut für GermanistikAECC, Abteilung Fachdidaktik, der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt. E-Mail: nicola.mitterer@aau.at und markus.pissarek@aau.at
Stefan Neuhaus
Über die allmähliche Verfertigung der Märchen beim Erzählen
Zur Entstehung der Gattung bei den Brüdern Grimm und E.T.A. Hoffmann
Die Gattung Märchen entsteht mit den Kinder- und Hausmärchen (1812/15) der Brüder Grimm und den Märchenerzählungen E.T.A. Hoffmanns. Im Rahmen einer »Archäologie« (vgl. Foucault 1981) lässt sich der Prozess der Naturalisierung der Gattung nachvollziehen. Die Kinderund Hausmärchen als prototypische »Volksmärchen« werden als Beitrag zum national-kulturellen Diskurs lesbar. Der politische Kontext der Zeit wirkte auf die Entstehung der Texte massiv ein, ohne dass die von Wilhelm Grimm stark schematisierten Texte selbst diese Spuren auf den ersten Blick zeigen. E.T.A. Hoffmann verwendet in Der goldne Topf von 1814 zum ersten Mal konsequent einen Dualismus von fiktionaler Realität und Wunderwelt, auch dieses Konzept wird gattungsbildend: für das sogenannte Kunst- oder Wirklichkeitsmärchen.
______________________________
Das abgewandelte Zitat im Titel (Heinrich von Kleist Über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden, entstanden vermutlich 1805/06, Erstdruck von 1878) soll auf den Konstruktionscharakter nicht nur aller Gedanken, sondern auch aller Gattungen hinweisen. Am Beispiel der Gattung Märchen soll versucht werden zu zeigen, wie sehr unser »kulturelles Gedächtnis« (vgl. Assmann 2002) von Konzepten geprägt ist, die vergleichsweise jung sind. Generell gilt, »[…] daß die Wahrnehmung, die Einspeicherung und der Aufruf von Erinnerungen kulturellen Schemata folgt« (Welzer 2005, S. 160). Der Prozess der Naturalisierung des Anfang des 19. Jahrhunderts entstandenen kulturellen Schemas oder Konzepts »Märchen« soll im Rahmen des gegebenen Umfangs eines solchen Beitrags nachvollzogen werden. Auch wenn es, mit Michel Foucault gesprochen, kein Außerhalb des Diskurses gibt (vgl. Foucault 2000, S. 25), so können doch im Rahmen einer (von ihm so benannten) »Archäologie« (Foucault 1981) die Voraussetzungen des Diskurses offen gelegt werden, um zu einer größeren Freiheit im Umgang mit den Gegenständen zu gelangen.
1. Die Kinder- und Hausmärchen als Beitrag zum national-kulturellen Diskurs
Die Entstehung der Kinder- und Hausmärchen (in der Folge KHM) der Brüder Grimm, die zu den berühmtesten Publikationen der Weltgeschichte zählen und deren Manuskript zum Weltdokumentenerbe gehört, ist eine Geschichte von Zufällen und Anfangsproblemen. Als Clemens Brentano mit Achim von Arnim Lieder und Gedichte für die 1806–1808 veröffentlichte Liedersammlung Des Knaben Wunderhorn – deren Bedeutung für die deutschsprachige Lyrik den KHM ebenbürtig ist – suchte, kam er auf die Idee, auch eine Märchensammlung zu beginnen (vgl. Rölleke 2004, S. 35). Da er wusste, dass seine Bekannten Jacob und Wilhelm Grimm Bibliothekare in Kassel waren und somit an der Recherchequelle saßen, bat er sie um ihre Hilfe – doch verlor er bald das Interesse.
Die Brüder Grimm wussten das nicht, sammelten weiter und schickten Brentano das Manuskript – nicht ohne eine Abschrift anzufertigen, sonst gäbe es die KHM heute nicht. Denn Brentano antwortete nicht und nach längerem Überlegen und Zögern brachten die beiden Grimms, mit Hilfe von Achim von Arnim, die Sammlung nun selbst heraus (vgl. Rölleke 2004, S. 80 f.). Sie erschien in zwei Bänden 1812 und 1815 und lag wie Blei im Regal des Verlegers. Niemand wollte diese Sammlung kaufen, die in den jungen Jahren der Entstehung der Germanistik aus der Edition von Texten wie dem Nibelungenlied als eines von vielen Editionsprojekt entstanden war. Erst die weitere Bearbeitung durch Wilhelm Grimm, der dabei »seinen eigentümlichen Märchenstil« (ebd., S. 88) entwickelte, und vor allem die sogenannte »Kleine Ausgabe« von 1825 mit einer Auswahl von 50 Märchen und mit Illustrationen der nun auch »kindgerechten Märchentexte« von Ludwig Emil Grimm (ebd., S. 92) verhalf den KHM zum Durchbruch: »Die Erstauflage umfaßte 1500 Exemplare und wurde zu Lebzeiten Wilhelm Grimms zwischen 1833 und 1858 noch neunmal aufgelegt« (ebd., S. 93).
Im Geiste Johann Gottfried Herders wollten die Grimms der deutschen Nation auf die Sprünge helfen, die in politischer Hinsicht leider auch später nicht gemacht wurden (vgl. Neuhaus 2002). Die Befreiungskriege gegen Napoleon halfen nicht, eine moderne Nation mit parlamentarischer Mitbestimmung zu initiieren. Der Wiener Kongress schuf 1815 mit dem Deutschen Bund eine feudale, wenn auch leicht modernisierte Nachfolgeorganisation für das Heilige Römische Reich deutscher Nation, das 1806 untergegangen war. Damit war – retrospektiv gesehen – politisch der Zug bereits abgefahren, eine Systemreform nach dem Muster Frankreichs (eine Republik) oder Großbritanniens (eine konstitutionelle Monarchie) durchzuführen. Es kam zwar immer wieder zu revolutionären Protesten, vom Wartburgfest 1817 über das Hambacher Fest 1832 bis zur sogenannten »deutschen Revolution« von 1848, die schnell in eine konservative Gegenrevolution mündete. Die feudal geprägte Struktur wurde immer so weit den ökonomischen und sozialen Wandlungsprozessen angepasst, dass sie nicht dauerhaft gefährdet wurde und sogar – mit den sogenannten Einigungskriegen Preußens von 1864 (gegen Dänemark, um Schleswig-Holstein), 1866 (gegen Österreich, um die Vorherrschaft im Deutschen Bund) und 1870/71 (gegen Frankreich) – in die Gründung des Zweiten deutschen Kaiserreichs mündete, als sogenannte »kleindeutsche Lösung« ohne das mittlerweile andere Interessen verfolgende Österreich (Doppelmonarchie Österreich- Ungarn seit 1867).
Diese politischen Zusammenhänge wirken sich auf die Literatur aus und umgekehrt – und dies kann in einem weitaus größeren Maß der Fall sein, als dies üblicherwei se bei der Lektüre von Literatur in Bildungskontexten (Schule, Universität) berücksichtigt wird. Das System Kunst ist zwar – so hat es Niklas Luhmann ausbuchstabiert (vgl. Luhmann 1997) – wie jedes Teilsystem der Gesellschaft autopoietisch und unterscheidet zwischen Kunst und Nichtkunst, es steht aber auch in enger Wechselwirkung mit den anderen Teilsystemen. Mit Pierre Bourdieu lässt sich von einer »paradoxen Beziehung zum geschichtlichen Erbe« (Bourdieu 2001, S.386) sprechen. Einerseits ist Literatur autonom, weil sie sich ihre eigenen Regeln gibt, andererseits entstehen diese neuen Regeln in einem komplexen Austausch mit früheren Texten und innerhalb eines politischen, sozialen, ökonomischen Kontexts der jeweiligen Zeit und Gesellschaft.
Da es an politischen Gestaltungsmöglichkeiten mangelte, konzentrierte sich das gebildete Bürgertum auf die weitere Ausformulierung einer »deutschen« Kultur. Dieses Selbstverständnis schloss zu dieser Zeit Österreich als mächtigsten Mitgliedsstaat noch mit ein. Im Übergang von einem (ebenfalls schriftlich basierten!) mündlichen Gedächtnis zu einem schriftlichen schufen deutschsprachige Autoren eine Nationalliteratur, die allerdings bis ins frühe 19. Jahrhundert (nicht zuletzt angesichts der fehlenden Aussicht auf politische Teilhabe) eher ein Konzept von »Weltliteratur« favorisierte, wie es Johann Wolfgang von Goethe in seinen Gesprächen mit Eckermann vertrat: als Gespräch über Literatur der an ihr Beteiligten und als »komplexes Beziehungssystem von Texten, das durch zahllose Verweise und Verknüpfungen zusammengehalten wird« (Lamping 2010, S. 62).
Das von Herder entwickelte, sehr offene und daher für unterschiedlichste Temperamente und Interessen adaptionsfähige Konzept der sogenannten »Volkspoesie« schuf bereits früh einen idealen Rahmen. Parallel zur Alphabetisierung und »ästhetischen Erziehung« des Bürgertums nach den Maximen von Friedrich Schiller, wurden Stoffe und Themen in einem »deutschen« Sinn bearbeitet. Hier wirkte die Aufklärung nach und weiter, insbesondere mit ihrem Tugendideal und der Aufforderung zu »vernünftigem« Handeln. Die Arbeit am kollektiven Gedächtnis der deutschen Kulturnation machte allerdings, weil es dafür noch kein Bewusstsein gab, vor Plagiaten und eigenen Produktionen nicht halt. Historische wie gegenwärtige Realität ist das Ergebnis von oft nicht (mehr) sichtbaren Aushandlungsp rozessen: »Individuelle wie kollektive Vergangenheit […] werden in sozialer Kommunikation beständig neu gebildet.« (Welzer 2005, S. 44) Es gilt daher, sich den spezifischen, die Entstehung der Gattung Märchen prägenden Diskurs der Zeit zu erschließen, um die Mechanismen dieser Arbeit an der »Vergangenheit« besser verstehen zu können.
Die Brüder Grimm schufen, in der fortdauernden Bearbeitung vor allem durch Wilhelm Grimm, eine verbindliche Form für eine sehr einfache und nicht zuletzt auch dadurch sehr populäre, aber zugleich ausgesprochen voraussetzungsreiche kurze literarische Form – das sogenannte Volksmärchen. Von Lothar Bluhm (2011, S. 17) wird es zu Recht als »Buchmärchen« bezeichnet, da es sich bei der behaupteten Methode der Aufzeichnung um einen Mythos im genannten Sinn handelt, also um die Arbeit an einer »deutschen« Kultur, die zugleich für die kaum verfügbare und vorzugsweise idealisierte Vergangenheit wirksam werden soll.
Für die meisten der von ihnen »nacherzählten« Märchen verwendeten die Grimms Vorlagen aus Märchen- und Novellensammlungen anderer Sprachen. Zu nennen sind beispielsweise Giovan Francesco Straparolas Die ergötzlichen Nächte (1550–53), Giambattista Basiles Das Pentameron (1634–36) und Charles Perraults Contes du temps passé (1697) (vgl. Neuhaus 2017c, S. 64–82). Viele dieser und anderer Quellen waren auch im sozialen Umfeld der Grimms bekannt: »Die Gewährsleute der ersten Stunde sind durch die Namen Mannel, Wild und Hassenpflug gekennzeichnet. Es handelt sich ausnahmslos um überdurchschnittlich gebildete Frauen aus gutsituierten Familien« (Rölleke 2004, S. 76). Die Grimms selbst legten, als »gute« Editoren, in einem umfangreichen Kommentarteil viele ihrer Quellen offen (vgl. Brüder Grimm 1994, Bd. 3).
Die »Vorrede« zur zweiten, bereits von Wilhelm Grimm weiter bearbeiteten Ausgabe von 1816 ist aus heutiger Sicht eine fragwürdige Mystifikation:
Wir finden es wohl, wenn von Sturm und anderem Unglück, das der Himmel schickt, eine ganze Saat zu Boden geschlagen wird, daß noch bei niedrigen Hecken oder Sträuchen, die am Wege stehen, ein kleiner Platz sich gesichert hat und einzelne Ähren aufrecht geblieben sind. Scheint dann die Sonne wieder günstig, so wachsen sie einsam und unbeachtet fort: keine frühe Sichel schneidet sie für die großen Vorratskammern, aber im Spätsommer, wenn sie reif und voll geworden, kommen arme Hände, die sie suchen, und Ähre an Ähre gelegt, sorgfältig gebunden und höher geachtet als sonst ganze Garben, werden sie heimgetragen, und winterlang sind sie Nahrung, vielleicht auch der einzige Samen für die Zukunft.
So ist es uns vorgekommen, wenn wir gesehen haben, wie von so vielem, was in früherer Zeit geblüht hat, nichts mehr übrig geblieben, selbst die Erinnerung daran fast ganz verloren war, als unter dem Volke Lieder, ein paar Bücher, Sagen und diese unschuldigen Hausmärchen. Die Plätze am Ofen, der Küchenherd, Bodentreppen, Feiertage noch gefeiert, Triften und Wälder in ihrer Stille, vor allem die ungetrübte Phantasie sind die Hecken gewesen, die sie gesichert und einer Zeit aus der andern überliefert haben.
Es war vielleicht gerade Zeit, diese Märchen festzuhalten, da diejenigen, die sie bewahren sollen, immer seltener werden. (Brüder Grimm 1994, Bd. 1, S. 15)
Es ist hier weder der Raum, die Geschichte der Germanistik aus einer frühen Form der Editionsphilologie zu entwickeln, noch besteht hier die Möglichkeit, das Konzept der Volkspoesie Herders und dessen Wirkung nachzuzeichnen. Wichtig ist festzuhalten, dass es für die Brüder Grimm kein Gegensatz und nicht einmal ein Widerspruch war, dass sie schriftliche Quellen und mündliche Überlieferungen, die auf schriftliche Quellen zurückgingen, als Material für ihre Bearbeitungen nutzten und dies nicht als Konstruktion, sondern als Rekonstruktion idealtypischer bürgerlicher »deutscher« Erzählungen verstanden. Der ganze Prozess der durchaus auf Popularität und Wirkung zielenden Bearbeitung insbesondere durch den Wechsel der Ausrichtung von einem an Editionen interessierten Fachpublikum hin zu einer breiten und vor allem kindlichen Öffentlichkeit wird in der »Vorrede« angesprochen: »Wir suchen die Reinheit in der Wahrheit einer geraden, nichts Unrechtes im Rückhalt bergenden Erzählung. Dabei haben wir jeden für das Kindesalter nicht passenden Ausdruck in dieser neuen Auflage sorgfältig gelöscht« (Brüder Grimm 1994, Bd. 1, S. 17).
Wie skrupulös die Grimms beispielsweise alles Sexuelle, das sich in den Ursprungstexten in großer Deutlichkeit findet, getilgt haben, konnten Beat Mazenauer und Severin Perrig zeigen (vgl. Mazenauer/Perrig 1998). Viele der Stoffe, die sich teilweise bis ins frühe Mittelalter zurückverfolgen lassen, bearbeiten Themen, die Menschen in ihrer Zeit beschäftigten, etwa die Frage des Scheintodes oder der möglichen Folgen unehelichen Geschlechtsverkehrs. Das konnte aber in einer vom Entstehen der modernen Wissenschaften ebenso wie vom Tugendbegriff und Erziehungsprogramm der Aufklärung geprägten, kulturell und politisch neuen Halt suchenden Gesellschaft keine Rolle mehr spielen. Dazu kommt: Kinder und ihre erwachsenen Mitleser*innen sind, das haben die Grimms – vielleicht auch durch die Wirkung von Des Knaben Wunderhorn – zunehmend erkannt, viel leichter zu erreichen und im skizzierten »bürgerlich«-ideologischen Sinn zu beeinflussen. Diese Arbeit der Grimms an »ihren« Märchen geschah dabei nicht vorrangig reflektiert-konzeptionell, sondern ganz konkret im Austausch mit den aufgeklärt erzogenen, entsprechend (vor-)gebildeten Mitbürger*innen (vgl. Martus 2015, S. 211). So suchten und fanden sie »ihren« originellen Weg und schufen eine der populärsten Textsammlungen aller Zeiten.
Verblüffend ist im Nachhinein, wie sehr der Erfolg den Brüdern Grimm recht gab: Die KHM gelten bis heute als Ursprungserzählungen nicht nur »deutscher« Kultur, sondern einer Ursprungskultur, die von der »verspäteten Nation« herbeigewünscht wurde, um das Trauma der Verspätung zu verarbeiten und eine noch glorreichere Nationwerdung zu imaginieren. Dass diese Perspektive wie bei Goethe so auch bei den Grimms durchaus noch ansatzweise kosmopolitisch geprägt war, zeigt die Bemerkung gegen Ende der »Vorrede«: »Übrigens ist dies nur gegen sogenannte Bearbeitungen gesagt, welche die Märchen zu verschönern und poetischer auszustatten vorhaben, nicht gegen ein freies Auffassen derselben zu eignen, ganz der Zeit angehörenden Dichtungen, denn wer hätte Lust, der Poesie Grenzen abzustecken?« (Brüder Grimm 1994, Bd. 1, S. 24). Hier schimmert bei aller Camouflage durch, dass es für die Grimms kein Problem darstellte, Stoffe auch anderer Sprachen und Kulturen zu bearbeiten, denn es ging ihnen nicht darum, die Stoffe »zu verschönern und poetischer auszustatten«, sondern darum, sie »frei aufzufassen« und der »Zeit« anzupassen.