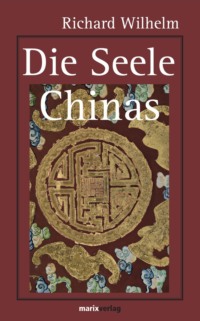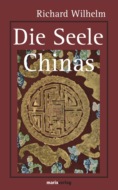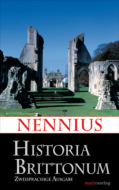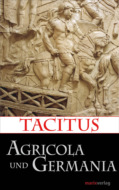Loe raamatut: «Die Seele Chinas»
Cover
Über den Autor
Über den Autor
»Botschafter zweier Welten« hat man Richard Wilhelm genannt. Er lebte von 1873 bis 1930, ging schon früh als Missionar nach China, wirkte lange Jahre in Tsingtau als Pfarrer und Pädagoge, hatte zuletzt eine Professur an der Pekinger Universität inne. 1924 gründete er in Frankfurt das berühmt gewordene »China-Institut« – er tat das als Botschafter des geistigen China, das er in exemplarischen Übersetzungen u.a. Laotses, Konfuzius’ und des I Ging erstmals bekannt gemacht hat.
Zum Buch
Zum Buch
»Ich habe das große Glück gehabt, fünfundzwanzig Jahre meines Lebens in China zu verbringen. Ich habe Land und Volk lieben gelernt wie jeder, der lange dort weilte. Aber gerade die jetzt vergangenen fünfundzwanzig Jahre waren besonders wichtig, weil sie es waren, in denen Altes und Neues sich trafen. Ich habe noch das Alte China gesehen, das für die Jahrtausende zu dauern schien. Ich habe seinen Zusammenbruch miterlebt und habe erlebt, wie aus den Trümmern neues Leben blühte. Im Alten wie im Neuen war doch etwas Verwandtes: eben die Seele Chinas, die sich entwickelte, aber die ihre Milde und Ruhe nicht verloren hat und hoffentlich nie verlieren wird. Wenn etwas von dieser Seele Chinas dem Leser offenbar wird, dann ist der Zweck dieses Buches erfüllt.« (Aus dem Vorwort des Buches)
»›In China rechnet man nach Jahrhunderten.‹ Das war in der Vergangenheit stets die Losung der alten Kolonisten im Fernen Osten. Aber diese Losung ist längst zur Unwahrheit geworden. Heute entwickelt sich das Leben in China in fieberhafter Eile. Jeder Tag bringt neue Ereignisse und Entwicklungen, und hinter den lauten Tagesereignissen und Kämpfen vollzieht sich etwas ganz Großes: das Auftauchen einer neuen Welt. Ganz langsam und allmählich fing es an, aber mit immer wachsender Beschleunigung rollt das Rad des Geschehens weiter, dieses Rad der Wiedergeburt, das Altes, Überlebtes mit sich hinunter nimmt in die Unterwelt des Vergessens und Neues, nie Dagewesenes aus dem Nichts emporhebt.« (Aus dem Vorwort)
Haupttitel
Impressum
| Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über dnb.d-nb.de abrufbar. |
| Alle Rechte vorbehalten |
| Copyright © by marixverlag GmbH, Wiesbaden 2011 Der Text wurde behutsam revidiert nach der Ausgabe Berlin 1925 Covergestaltung: Nicole Ehlers, marixverlag GmbH Bildnachweis: akg-images GmbH, Berlin Redaktion: Gabriele Bauer, Frankfurt eBook-Bearbeitung: Medienservice Feiß, Burgwitz Gesetzt in der Palatino Ind Uni – untersteht der GPL v2 ISBN: 978-3-8438-0049-5 www.marixverlag.de |
Inhalt
Über den Autor
Zum Buch
Vorwort
Die Seele Chinas
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebentes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Sechzehntes Kapitel
Siebzehntes Kapitel
Achtzehntes Kapitel
Neunzehntes Kapitel
Zwanzigstes Kapitel
Fußnoten
Kontakt zum Verlag
Vorwort
»In China rechnet man nach Jahrhunderten.« Das war in der Vergangenheit stets die Losung der alten Kolonisten im Fernen Osten. Aber diese Losung ist längst zur Unwahrheit geworden. Heute entwickelt sich das Leben in China in fieberhafter Eile. Jeder Tag bringt neue Ereignisse und Entwicklungen, und hinter den lauten Tagesereignissen und Kämpfen vollzieht sich etwas ganz Großes: das Auftauchen einer neuen Welt. Ganz langsam und allmählich fing es an, aber mit immer wachsender Beschleunigung rollt das Rad des Geschehens weiter, dieses Rad der Wiedergeburt, das Altes, Überlebtes mit sich hinunter nimmt in die Unterwelt des Vergessens und Neues, nie Dagewesenes aus dem Nichts emporhebt. Aber das Neue ist nicht etwas, das ganz unvermittelt entstünde. Seine Keime und Anknüpfungspunkte liegen in der Vergangenheit. Wer die Keime des Werdens zu deuten versteht, vermag aus ihnen die Zukunft zu lesen.
Ich habe das große Glück gehabt, fünfundzwanzig Jahre meines Lebens in China zu verbringen. Ich habe Land und Volk lieben gelernt wie jeder, der lange dort weilte. Aber gerade die jetzt vergangenen fünfundzwanzig Jahre waren besonders wichtig, weil sie es waren, in denen Altes und Neues sich trafen. Ich habe noch das Alte China gesehen, das für die Jahrtausende zu dauern schien. Ich habe seinen Zusammenbruch miterlebt und habe erlebt, wie aus den Trümmern neues Leben blühte. Im Alten wie im Neuen war doch etwas Verwandtes: eben die Seele Chinas, die sich entwickelte, aber die ihre Milde und Ruhe nicht verloren hat und hoffentlich nie verlieren wird. Wenn etwas von dieser Seele Chinas dem Leser offenbar wird, dann ist der Zweck dieses Buches erfüllt.
Frankfurt, Herbst 1925
Richard Wilhelm
-
HERRN TSAI YÜAN PEI,
DEM KÄMPFER FÜR RECHT UND FREIHEIT,
DEM GELEHRTEN,
DEM FREUND.
Die Seele Chinas
Erstes Kapitel
Meine Ankunft im Osten
Die Nebel Mitteleuropas waren am Horizont zurückgesunken. Das Lachen und die Gesänge Italiens, der blaue Himmel und die silbernen Mondnächte bereiteten auf die schöne Welt des Ostens vor. Ich machte die Reise nach China auf einem der alten Lloyddampfer, die wegen ihrer soliden Bequemlichkeit berühmt waren. Die Seefahrt brachte die gewöhnlichen Abwechslungen: fliegende Fische, vorüberkommende Schiffe, ein wenig Meerleuchten, die fern heraufblinkenden Sterne des südlichen Himmels, die weite Gleichförmigkeit des Meeres und kurze Besuche in südlichen Häfen mit üppiger Tropenvegetation.
Der Lärm Schanghais war der erste chinesische Eindruck. Und doch war es nicht China, was man hier erlebte. Es war ein Kompromiss zwischen den festen Regeln des Lebens, die der Engländer an jeden Ort, wo er den Fuß zur Erde setzt, mitbringt, und dem Gewühl der chinesischen wurzellosen Hafenstadtbevölkerung, ein Kompromiss nicht unähnlich der Sprache, die man damals auf den Straßen hörte: Pidgin-Englisch (business Englisch, Geschäfts-Englisch), jener fürchterlichen Missgeburt aus verdorbenem englischen Slang und chinesischer Syntax, die aus der gegenseitigen Verachtung der handeltreibenden Bevölkerungen des Ostens und des Westens geboren war. Dieses Pidgin-Englisch ist ja inzwischen in China beinahe ausgestorben. Der Chinese hat es längst gelernt, die lingua franca der europäischen Welt, das Englische, beziehungsweise Amerikanische, idiomatisch richtig auszusprechen, und sieht mitleidig auf den rückständigen Europäer herab, der sich auf die alte barbarische Weise verständlich machen möchte.
Aus dem Gewühl der Handelsstadt an den Ufern des Whangpoo ging es dann in einer weiteren Seefahrt an Bord der »Knivsberg«, eines kleinen Küstendampfers der Firma Jebsen, nach Norden weiter. Aus dem Meer traten die nebelduftigen Laoschanberge hervor, und bald darauf machte der Dampfer auf der Außenreede von Tsingtau fest, von wo die Passagiere in Sampans, kleinen flachen Ruderbooten, die in der Brandung auf- und niederschwankten, an Land gebracht wurden.
Es war damals die erste Zeit der kleinen Kolonie am Gelben Meer, die dazu bestimmt war, ein Einfallstor für Deutschland zu bilden, wenn die große Melone China aufgeschnitten und unter die Nachbarn verteilt werden sollte. Diese Sorge um den Beuteanteil hat sich späterhin als recht unnötig erwiesen, da China sich doch als bedeutend widerstandsfähiger herausstellte, als man nach dem japanischen Sieg vermutet hatte. Der Platz war ja als Sanktion besetzt worden, nachdem einige Missionare der Steyler Mission als Märtyrer von Räuberhand im Innern der Provinz Schantung gefallen waren; nicht ohne dass zuvor von sachverständiger Seite die Brauchbarkeit des Platzes für eine großzügige Hafenanlage festgestellt worden wäre. Es kam auf die seltsamste Art in deutschen Besitz. Wie Beteiligte erzählten, ganz im Gegensatz zu den Wünschen des Auswärtigen Amtes, das Komplikationen mit Russland fürchtete, nur dadurch, dass eine Depesche, die die Besetzung verhindern sollte, irgendwie zu spät dechiffriert wurde. Vielleicht hing es damit zusammen, dass Tsingtau keine Kolonie wurde, sondern ein Pachtgebiet, und dass es nicht dem Kolonialamt unterstellt wurde, sondern dem Reichsmarineamt.
Das Leben in der neuen Niederlassung war voll von Abenteuern und Tatendrang. Die paar Deutschen, die sich am Südrand der Kiautschoubucht in dem kleinen Fischerdorf Tsingtau niedergelassen hatten, bildeten eine große Familie, mit allen Zwistigkeiten freilich, die in großen Familien zu herrschen pflegen. Noch war kein europäisches Haus errichtet. Das Hotel war zwar im Bau, ebenso wie einige andere Gebäude, aber man lebte in notdürftig eingerichteten chinesischen Fischerhütten. Da meine Wohnung noch nicht fertig war, wurde ich fürs erste im Hotel Ägir untergebracht. Hier saßen die Kolonisten des Abends beisammen unter reichlichem Alkoholgenuss, schmiedeten Pläne und besprachen die Neuankömmlinge, die im schwarzen Rock und festlichen Handschuhen durch den Schlamm der grundlosen Wege hüpften oder, wenn schönes Wetter war, unter dauerndem Umsichschlagen sich von Staub und Fliegen zu reinigen suchten, während sie ihre Antrittsbesuche machten, bei denen man gefragt wurde, ob man zur See gekommen sei und ob man eine gute Überfahrt gehabt.
Das Hotel Ägir war ungenügend auf Logiergäste eingerichtet. Als ich am Abend des ersten Tages mein Zimmer betrat, dessen Ziegelboden notdürftig mit Strohmatten bedeckt war, raschelten die Ratten unter dem Bett und über der Zimmerdecke, die nur aus Papier zusammengeklebt war. Dennoch schlief ich bald ein, obwohl das Zimmer nicht verschließbar war. Ein heller Hahnenruf weckte mich. Als ich die Augen rieb, saß ein chinesischer Hahn am unteren Ende meines Bettes und krähte, während seine Hennen emsig auf dem Boden umherscharrten. Es war nicht die schlechteste Zimmergenossenschaft, die man in jenen Zeiten in Tsingtau finden konnte.
Die Straßen waren erst im Bau; von den Hügeln herunter zogen sich breite und tiefe Sandravinen und nicht gar selten kam es vor, dass ein heimkehrender Kolonist, der den Kopf etwas voll hatte von Plänen und Entwürfen, in eine solche Ravine hinunterrutschte und der Einfachheit halber dort unten gleich sein Nachtquartier aufschlug; wobei es dann abermals vorkam, dass er sich im besten Schlaf gestört fand durch einen Nachkömmling, der an derselben Stelle in die Tiefe gesunken war und auch auf die stärksten Proteste wegen Hausfriedensbruchs nicht hören wollte.
Endlich war mein Wohnhaus fertig. Es war eine Chinesenhütte, die von einem deutschen Kaufmann bewohnt worden war, der sich darin erschossen hatte. Von da ab war das Haus gemieden, weil der Verblichene gelegentlich spukte. Darum wurde es mir überwiesen, denn man nahm an, dass der Pfarrer auch mit spukenden Nachtgespenstern fertig würde, was denn auch der Fall war. Weit schlimmer als die Gespenster war die Regenzeit; denn das Dach war weit entfernt davon, dicht zu sein, so dass man schließlich nach vergeblichen Versuchen, das Bett in einen trockenen Winkel zu schieben, doch zum Regenschirm greifen musste. Aber man fand sich mit dem Schicksal ab, namentlich wenn man sah, wie es andern ging. Als ich nämlich am Morgen nach dem ersten Regen zu meinem väterlichen Freund, dem Missionar D. Faber, hinüberging, der gerade mit einer großen literarischen Arbeit – einer Übersicht über die gesamte chinesische Geschichte – beschäftigt war, da fand ich ihn auf dem Tische sitzend, der als Insel im Teich der Stube stand, und mühsam nach Manuskripten und Büchern fischend, die munter als Fischlein im bräunlichen Gewässer umherschwammen. Mir kam die Sache sehr heiter vor, aber er war zu alt dafür und beklagte sich bitter über das Zwecklose, dass er vom Missionsverein in eine Wüste geschickt worden sei, wo ihm jede wissenschaftliche Arbeit unmöglich war. Er ist dann auch kurz darauf an Dysenterie gestorben, enttäuscht und verbittert über die Sinnlosigkeit des Schicksals. Aber seine letzten Momente waren verklärt von einer großen Überwindung, und im Nachtsturm nahm seine Seele Abschied, nachdem er bis zuletzt in seinen Fantasien mit chinesischen Geistern verkehrt hatte.
Meine Aufgabe bestand zunächst darin, die Seelsorge und die Schularbeit unter den Deutschen der Kolonie auszuüben. Die Gottesdienste wurden in der Reitbahn der Matrosenartilleriekaserne abgehalten, ohne dass man der Mehrzahl der Beteiligten eine größere Begeisterung angemerkt hätte. Die Schule bestand aus drei deutschen Knaben, von denen jeder eine Klasse bildete, einem Deutsch sprechenden, einem Englisch sprechenden und einem Chinesisch sprechenden Mädchen und außerdem einem amerikanischen Missionarssöhnchen, so dass wenigstens eine gewisse Mannigfaltigkeit nicht zu vermissen war. Es dauerte allerdings ziemlich lange, bis der Unterricht beginnen konnte, denn in dem Chinesendorf Ober-Tsingtau herrschte Flecktyphus und Dysenterie, und die Eltern fürchteten die Ansteckung, was ihnen nicht zu verdenken war, da gerade in jenen Zeiten ein großer Prozentsatz namentlich unter den Seesoldaten diesen Krankheiten zum Opfer fiel.
So blieb mir genügend Zeit, mich auf die andere Seite meines Berufes vorzubilden, indem ich mich dem Studium der chinesischen Sprache widmete. Ich kann wohl sagen, dass ich im Schlaf Chinesisch gelernt habe. Irgendwelche vorgebildeten Lehrer gab es damals nicht. Man mietete sich einen chinesischen Dorfschullehrer oder einen etwas heruntergekommenen Schreiber, setzte ihn vor das Lehrbuch und ließ ihn lesen, während man selber nachsprach. Als Lehrbuch war damals allgemein das Buch des amerikanischen Missionars Mateer: Mandarin Lessons, im Gebrauch. Es fing an mit den Sätzen: I Go Jen, Liang Go Nan Jen, San Go Nü Jen, Si Go Men, zu Deutsch: Ein Mensch, zwei Männer, drei Frauen, vier Türen. Der Tiefsinn dieser Sätze wirkte überwältigend, zumal da die Stunden am frühen Nachmittag bei 25-28 Grad Wärme abgehalten wurden. Anfangs wurden Lehrer und Schüler durch die Fliegen munter gehalten, von denen es zwei Arten gab, eine gewöhnliche graue Sorte, die sich nur durch träge Klebrigkeit auszeichnete und die sogenannten grünen Bohnenfliegen, grünschillernde Tiere mit großen roten Augen, die in ihrem stumpfen Trotz die ganze Bosheit rücksichtsloser Bestialität zeigten. Das einzig Gute an den Tieren war, dass sie nicht Tigergröße hatten. Aber auch so haben sie genug Menschen unter die Erde gebracht. An den Wänden klackte hier und da ein Gecko, der einen schlafenden Moskito erschnappte, die sonst gegen Abend die Fliegen abzulösen pflegten. So ging das Lernen in plätscherndem Takt weiter: »I Go Jen, Liang Go Nan Jen« der Lehrer, »I Go Jen, Liang Go Nan Jen« der Schüler. Einmal fuhr ich auf, wie man in einer Mühle erwacht, wenn das Räderwerk stille steht. Ich hatte aufgehört zu reden und war eingenickt; als ich aber zu mir gekommen war, schlief auch der Lehrer fest in seiner Ecke, und nur langsam und undeutlich entströmten ihm schnarchende Laute: »I … Go … Jen …« Diese Art, Chinesisch zu lernen, die mehr von der Beeinflussung des Unterbewusstseins ausgeht als von intelligenter Geistestätigkeit, war übrigens jahrtausendelang auch von den Chinesen selbst geübt worden. Wenn man einer chinesischen Schule sich näherte, so klang es in der Ferne wie ein Bienenschwarm und in der Nähe wie das Getöse eines Jahrmarkts, und die kleinen Knaben sagten jeder für sich sein Sprüchlein her, von dessen Bedeutung keiner eine Ahnung hatte, während der aufsichtführende Lehrer auch meist in tiefer Selbstbeschauung in seiner Ecke saß. Das waren selige Zeiten. Schließlich hat man auch so Chinesisch gelernt. Die Hauptsache war, dass man etwas zu sagen hatte, dann stellte sich der richtige Ausdruck schon irgendwie ein. Chinesisch1 ist die leichteste Sprache, wenn sie unbefangen gelernt wird, vom Sinn her eher als vom Einzelausdruck. Aber für neugierige Frager bietet die Sprache eitel Tücken. Da hilft auch die modernste Methode nichts. In Peking ist jetzt eine Language School mit reichlichem Aufwand amerikanischer Millionen erbaut. Da hängen Tafeln lautphysiologischer Art, Zunge, Zähne und Kehlkopf sind abgebildet, wie sie bei den verschiedenen Lauten stehen müssen und schließlich machen die Schüler die Zunge krumm und hängen sie zum Mund heraus und ihr Chinesisch klingt darum doch nicht besser. Auch die Berlitzsche Unterrichtsmethode hilft solchen Menschen nichts; denn als ein chinesischer Lehrer auf sich deutend »wo« und auf die amerikanische Schülerin deutend »ni« gesagt und dies eine halbe Stunde wiederholt hatte, begann die Schülerin endlich zu begreifen, und sie ging aus der Stunde weg mit der Überzeugung, dass »wo« die Nase heiße und »ni« der Zeigefinger.
Zuweilen gab es übrigens doch auch Unterbrechungen in dem chinesischen Sprachbetrieb. An einem schönen Sommerabend, als ich gerade hinter den Büchern saß, gingen vor dem Fenster ein paar Pferde vorüber. Die chinesischen Pferde sind, wie alles Chinesische, ein wenig anders als die entsprechenden europäischen Dinge, aber doch wieder so ähnlich, dass man merkt, es handelt sich schließlich um dasselbe Wesen. Die chinesischen Pferde sind zum Beispiel viel kleiner als die europäischen, weniger zart und edel, unglaublich genügsam und ausdauernd. Sie sind nur um der Menschen willen da, zum Reiten und Ziehen. Was der Reiter aushält, halten sie auch aus. Sie verlangen auch keine besondere Kunst, um sich reiten zu lassen. Man muss einfach oben bleiben, energisch vorwärts wollen und darf keine Angst haben. Wenn sie merken, dass dem Reiter etwas von den entsprechenden Eigenschaften fehlt, so spielen sie mit ihm, sind faul und eigensinnig und werfen auch ab. Die Psychologie des chinesischen Pferdes lernte ich aber erst später. Damals sah ich die Tiere wehmütig vorüberziehen ins ungewisse Land, hinein in den goldnen Abendsonnenschein. Da stieg mir der Wunsch nach Abenteuern auf. Ich schickte meinen chinesischen Diener hinaus, ob die Pferde für ein paar Tage zu mieten seien und er kam mit der freudigen Nachricht zurück, dass alles in Ordnung sei. Über das Reiseziel war man sich bald einig. Der chinesische Diener schlug die Stadt Tsimo vor, und ich war’s zufrieden. Ich glaube, er tat es, weil er dort zu Hause war und die Gelegenheit zu einem Urlaub benutzen wollte. Denn an sich war es nicht besonders weise, für den ersten Ritt ein Ziel zu wählen, das 90 chinesische Li – etwa 45 km – entfernt war, zumal da die Sonne doch schon recht tief stand. Aber jeder Europäer hält seinen Boy – so nennt man ganz unabhängig von ihrem Alter die Diener im Osten – in gewissen Stücken für ein höheres Wesen, der nicht nur weiß, ob es morgen regnet oder schön ist, sondern der auch beim Einkauf chinesischer Kunstgegenstände zu Rate gezogen wird und in allen schwierigen Situationen Bescheid weiß. So hatte mein Boy gesagt, dass man gut nach Tsimo reiten könne, also musste es auch möglich sein. Die bissige Antwort D. Fabers, den ich pro forma über die Sache befragte, dass ich meine Wunder erleben werde, kam demgegenüber nicht in Betracht, denn ich wollte ja meine Wunder erleben. Und erlebte sie auch. Das Reiten lernte ich merkwürdig schnell. Wir hatten wohlgezogene, kräftige Tiere, die nicht mit irgendwelcher Wildheit kokettierten, sondern schlecht und recht mit ihren Lasten in gemessenem Trab voranmachten. Sie wussten alles ganz genau. Schwache Versuche, einmal Schritt zu reiten oder Galopp, prallten an der überlegenen Entschlossenheit meines Pferdes ab, das auf den fremden Reiter ebensowenig reagierte wie auf die Schwankungen der Warenpacken, die es sonst zu tragen gewohnt war. So fügte ich mich denn ins Notwendige und genoss den Ritt ins Unbekannte in vollen Zügen. Bald waren die höchsten Felshügel überstiegen und die fruchtbare Ebene dehnte sich bis fern an die Gipfel des Laoschan, der purpurgolden im Schein der untergehenden Sonne zu leuchten begann. Auf den Feldern stand Hirse und Kaoliang (Sorghum). Dieser Kaoliang wächst in fruchtbaren Sommern so hoch, dass selbst ein Reiter kaum darüber wegsehen kann. Auch verschiedene Arten von Sojabohnen, Erdnüsse, Bataten und sonstige Nutzpflanzen waren heimisch. Dazwischen standen Obstbäume in großer Zahl, von denen besonders die süßen und dauerhaften Schantungbirnen und die rotglänzenden Kakifeigen (Persimona Kaki), die im Unterschied zu den Tomaten wirklich so gut schmecken wie sie aussehen, in der Gegend gedeihen. Rings am Horizont reihten sich die Dörfchen, alle von dichten, hohen Bäumen umgeben. Die Häuser in der Tsingtauer Gegend sind meist aus Granit gebaut, der den Hauptbestandteil der Gebirge in der Nähe bildet. Es ist ein ziemlich weicher, feldspatreicher Granit, der leicht verwittert und vom Regen stark mitgenommen wird und dann die Ravinen mit ihren seltsam steilen Wänden bildet, deren Hänge oft auf weite Strecken von den grünen Ranken der Puerariapflanze bedeckt sind. Dieser Granit lässt sich verhältnismäßig leicht bearbeiten, so dass es ein einfaches Geschäft ist, die Mauern zyklopisch aufeinanderzuschichten. Der Fußboden besteht aus gestampftem Lehm. Die Türen haben hölzerne Riegel und die Gitterfenster werden mit Papier beklebt, das im Sommer allmählich zerreißt und luftdurchlässig wird, während man zum nächsten Winter alles wieder frisch bezieht. Vor dem Haus, das mit Kaoliangstengeln und Lehm gedeckt wird und meist aus drei ineinandergehenden Räumen besteht, ist ein ummauerter Hof, mit lehmgestampfter Tenne, auf der das Getreide mit Walzen oder Flegeln gedroschen und mit geflochtenen, schaukelähnlichen Körben geworfelt wird. An der einen Seite des Hofes stehen die Stallungen mit den kleinen, rötlichen Rindern, die weder geschlachtet noch gemolken werden, sondern nur dem Menschen bei der Feldarbeit helfen, daneben ein paar Eselchen, die zwar eigensinnig sein können, aber nicht als dumm gelten. Die Frau und die Töchter sind vielleicht an der Walzenmühle beschäftigt mit Mahlen. Ein Eselchen mit verbundenen Augen zieht im Kreise trottend die Walze herum. Ein Schweinekoben mit fetten, runzligen, schwarzborstigen Schweinen steht in der Ecke neben dem Behälter, in dem alle Reste gesammelt werden, um mit Erde gehörig vermischt dem Boden wieder zugeführt zu werden, der sie zur Nahrung von Mensch und Tier hat wachsen lassen. Ein Hund unedler Rasse mit gerolltem Schwanz bellt nach dem Wanderer und wird, wenn man im Hause höflich ist, von irgendeinem Familienmitglied durch einen Steinwurf zur Ruhe gebracht. Hühner gackern und scharren. Im Dorfteich schwimmen auch wohl ein paar Gänse, sogenannte Singgänse, mit merkwürdigen Höckern auf ihren gelben Schnäbeln. Katzen kommen vor, nicht sehr zahlreich zwar, und gelten fast als etwas Heiliges, so dass zum Beispiel nicht leicht jemand sich bereit finden wird, eine Katze zu töten. Unter dem Hoftor spielen die Kinder, die kleinen Knaben im Sommer meist völlig nackt – zur gerechten Entrüstung gewisser Missionare und zum Entzücken eines jeden Menschen, der Natur, Unschuld und Freiheit schätzt – die Mädchen haben meist ihre roten Höschen an. Die Frauen tragen ja in China auf dem Land Hosen und nur in den Städten werden darüber Röcke getragen. Der Kleiderstoff ist aus Baumwolle gewoben und in der Regel mit Indigoblau gefärbt, jenem gleichmäßigen Blau des Himmels, das mit dem Gelb der Erde und dem Grün der Pflanzen die großen kosmischen Grundakkorde der chinesischen Landschaft bildet. Die Männer tragen meist solche heller oder dunkler blau gefärbten Stoffe, während die Frauen und Mädchen in bunten Farben strahlen. Nur wo Trauer eingekehrt ist in einem Haus, trägt man den fahlen, ungefärbten Sack und lässt die Haare wachsen, ohne sie zu ordnen. Die Frauen und Mädchen sitzen des Abends unter den Toren ihrer Höfe, plaudern und lachen und haben sich viel zu erzählen, während die älteren Männer am Tempelchen des heiligen Schützergenius, des Kuanti, oder unter dem großen Sophorabaum beieinandersitzen, ihre dünnen, geraden Pfeifchen rauchen und über die Ereignisse in Dorf und Welt reden, über die man sich eine Meinung bilden muss.
So war der Ritt durch den Abend recht vergnüglich. Aber der Weg führte immer weiter. Schon sank die Sonne hinter den feingezackten Spitzen der Perlberge jenseits der Kiautschoubucht. Die Dämmerung brach herein. Der blaue Rauch stieg aus den Dörfern in die Höhe und weiße Nebel legten sich auf Felder und Haine. Aber das Ziel war noch nicht wesentlich näher gerückt. Die Pferde trotteten immer weiter auf den stiller werdenden Wegen. Endlich wurde es Nacht und eine gewisse Ermüdung kam infolge des ungewohnten Aufenthalts im Sattel. Schon begann ich an die Abenteuer zu denken, die D. Faber versprochen hatte. Ein breiter Sandstreif leuchtete durch die Nacht. Es war einer der nordchinesischen Flüsse, die im Sommer mehr oder weniger trocken liegen und nur in der Regenzeit ihr breites Bett mit Wasser füllen. Die Pferde suchten sich die schmalen Wege heraus, die durch Sand und Geröll gebahnt waren, und weiter ging es in die Nacht hinein. Immer fremder und dunkler reckten sich am Horizont die Felsen, immer seltsamer bogen sich die Äste. Steile Malsteine tauchten an der Seite des Weges auf. Es waren Ehrenzeichen für treue Witwen und pietätvolle Töchter. Die wildverschlungenen Drachen, von denen die Steintafeln gekrönt waren, hoben sich fantastisch von der letzten Helle des rasch dunkelnden Himmels ab. Schließlich begann auch der Diener unsicher zu werden. Doch die Pferde trabten ruhig durch den Sternenschein voran. Das Geräusch des Tages war verklungen, nur die Grillen und Heimchen schrillten noch durch die Stille. Die Nacht in China ist nicht eine einfache Abwesenheit des Lichts. Sie ist etwas Wesenhaftes besonderer Art. Alles Leben hat sich verkrochen hinter Mauern und Tore. Die Sterne glühen groß und fremd. Seltsame Schatten huschen durch die Luft, bald zirpende Fledermäuse, bald unhörbare Eulen. Die vielen Grabhügel auf den Feldern drängen sich wirr durcheinander, unheimlich streichen Füchse und Iltisse durch das Gras und gehen ihren gespenstischen Zielen nach. Jetzt ist die Stunde, wo das Irrlicht hervorkommt und das Gespensterfeuer über dem Boden schwebt und um die Hügel der Gräber streicht. Um diese Stunde ist man gern zu Haus. Gar mancher grausige Geist geht um und zieht seine magischen Kreise. Mit leiser Stimme sprach der Diener von Sagen und Geschichten, die man sich erzählte von Räubern und Nachtmahren. Schließlich fürchtete er sich fast ein wenig.
Da ging es wie im Märchen. Endlich schimmerte ein Lichtchen durch die Bäume. Wir trieben die müden Pferde an und ritten darauf zu. Wir hatten es gerade richtig getroffen. Es war die Zollstation K’out’apu an der Grenze des deutschen Schutzgebietes, eine Station des chinesischen Seezolls, aber von Beamten deutscher Nationalität besetzt, wie ja der ganze chinesische Seezoll merkwürdigerweise von Europäern in chinesischem Dienst besorgt wird. Die Zollbeamten nahmen uns freundlich auf. Einer stellte mir sogar sein Bett mit Moskitonetz zur Verfügung, während er im Freien die Nacht zubrachte. Ich schlief fast traumlos bis in den Morgen hinein. Da brauchte ich eine geraume Zeit, bis ich mich besonnen hatte, wo ich war und wozu ich hier war. Das ganze Abenteuer kam mir plötzlich so albern vor. Der Gedanke, wieder ein Pferd zu besteigen, schien mir absurd. Mühsam, mit gespreizten Beinen, bewegte ich mich vom Fleck. Die Zollwächter ließen ein kräftiges Frühstück aufwarten und erkundigten sich teilnahmsvoll nach meinem Befinden. Sie verbargen ihre Heiterkeit und zeigten nur Güte, legten auch die Heimkehr nahe. Aber nun konnte ich nicht mehr zurück. Ich dankte für die Gastfreundschaft, biss die Zähne zusammen und schwang mich auf mein Ross, das ich zu möglichster Eile antrieb. Nach einer schmerzlichen Stunde begann ich mich im Sattel wohler zu fühlen, und unvermerkt hatte ich auf diese Weise reiten gelernt.
Im frischen Morgen kamen nun die Ausläufer des Laoschan näher an die Straße heran. Der Verkehr mit Schubkarren und Markteseln erwachte und bald erblickten wir die Mauerzinnen der Kreisstadt Tsimo, zu deren Markung früher das deutsche Pachtgebiet zum größten Teil gehört hatte. Mauern, Tore und Stadtgräben sind das Wahrzeichen aller chinesischen Landstädte. Sie sind bis auf den heutigen Tag keineswegs überflüssig, sondern leisten in Zeiten, da Diebe und Räuber das Land beunruhigen, gar oft sehr nützliche Dienste. Vor der Stadt Tsimo ist das sandige Bett eines Flusses. Diesseits des Flusses liegt eine Vorstadt, in der sich Herbergen für die Reisenden befinden. Wir stiegen in einer dieser Herbergen ab. Die Pferde wurden abgesattelt und bekamen im Hof ihr Futter vorgeschüttet. Ich wurde in den Mittelraum geführt und bekam zum Empfang eine Tasse Tee vorgesetzt. Man darf bei den chinesischen Landherbergen auch nicht den leisesten Gedanken an ein Hotel aufkommen lassen. Die Räume sind schwarz geraucht; primitive Tische und Stühle und im Innenraum ein hölzernes Brettergestell, auf dem man sein Bettzeug ausbreiten kann, wenn man welches mitgenommen hat, bilden das gesamte Mobiliar. Eine rauchende Bohnenöllampe, die an pompejanische Formen erinnert, steht in einer Wandnische. Die Wände sind beschrieben und bemalt von früheren Wandergästen. Oft klebt auch ein altes chinesisches Heiligenbild in einer Ecke, vor dem ein frommer Reisender seine Gebete verrichten kann. Mein Diener war verschwunden. Bald aber prasselte in der Ecke des Hofes ein Feuer auf, und stolz brachte er ein gesottenes Huhn, drei gekochte Eier und etwas Kohlgemüse herein. So wurde ein sehr frugales Mittagsmahl gehalten – mit chinesischen Essstäbchen, da ich keinerlei Reisebesteck mitgenommen hatte.