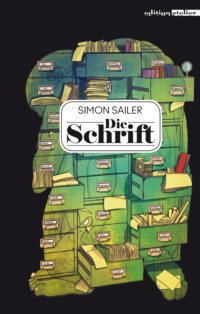Loe raamatut: «Die Schrift»


Für Sarah
Inhalt
Die Schrift
Über den Autor
Wer sich vor zehn Jahren für alte ägyptische Schriften interessierte, kannte Leo Buri. Heute will sich niemand mehr an ihn erinnern. Das heißt: abgesehen von mir. Manchmal frage ich auf einem Kongress oder bei einem Vortrag von jemandem, der ihn gekannt haben muss, nach dem freundlichen Kauz und erhalte ausweichende Antworten. Er sei gestorben, ins Ausland verzogen oder man habe den Namen niemals gehört.
Leo hatte die Gabe, selbst jene für alte Schriften zu interessieren, denen im Grunde alles Alte zuwider war. Ich durfte einmal erleben, wie er zu meinem Freund Peter Kneiff fast einen ganzen Abend lang von einer mittelalten nubischen Hieroglyphe sprach. Peter vertrat mir gegenüber immer die Ansicht, erst wenn die Probleme der gegenwärtigen Gesellschaft gelöst wären, dürfe man sich mit denen lange untergegangener Kulturen befassen. Auf die Möglichkeit hingewiesen, man könne aus den Fehlern der Alten lernen, gestand er diesen einen Punkt naserümpfend und ohne Überzeugung zu. Mit Leo aber plauderte derselbe Peter stundenlang über die Mischung von Laut- und Bildschrift und über das Bedürfnis, ein wichtiges Ereignis für die Nachwelt festzuhalten. Nie habe ich Peter so angeregt ins Gespräch vertieft gesehen wie an jenem Abend, voll kindlich neugieriger Fragen und ungestüm gestikulierend. Plötzlich schien ihn das alte Ägypten sehr viel anzugehen, und dabei wollte er, glaube ich, gar nichts aus der Vergangenheit lernen; eher hatte ich den Eindruck, er wollte es einfach wissen. Es kommt mir deshalb auch nicht wie ein Zufall vor, wenn Peter sich als einziger meiner Bekannten noch an Leo erinnerte und er derjenige war, der mir von Leos Verschwinden berichtete.
Trotzdem hatte der Bericht Löcher, die zu stopfen Peter nicht bereit war. Vor allem ging aus seiner Erzählung nicht hervor, woher er das alles so genau wusste. Hatte er noch Kontakt zu Leo? Dazu wollte Peter nichts sagen und meinte sogar, er könne es nicht. Jetzt kann er es wirklich nicht mehr, weshalb es an mir ist, zumindest das weiterzugeben, was er preisgab. Die Erzählung mag unwahrscheinlich klingen, tatsächlich stützen aber die Dokumente, die ich in Peters Nachlass fand, diese Version der Ereignisse. Es handelt sich dabei vor allem um Schriften und Zeichnungen von Leo selbst, Briefe von Leo an seine Frau sowie Zeitungsartikel und Fotografien. Falls es direkt an Peter adressierte Briefe gegeben haben sollte, waren sie verschollen.
Leo Buri arbeitete damals im Archiv des Instituts für Ägyptologie in Wien. Seine Aufgabe bestand darin, relevante Zeitungsartikel zu sammeln und abzuheften sowie Digitalisierungen von Keilschriften, Hieroglyphen und meroitischen Schriftrollen anzufertigen und zu katalogisieren. Allerdings, so sehr ihn die Nähe der alten Texte auch ehrte, die er als Zeitreisende, Botschafter einer untergegangenen Vergangenheit betrachtete, mehr als ihre stoffliche Erscheinung interessierte Leo Schrift selbst. Deshalb erledigte er die archivarischen Pflichten zwar stets ordentlich, aber rasch, um sich dann seiner eigentlichen Leidenschaft zuzuwenden. Wenn ihn eine Schrift besonders reizte, fertigte er auf eigene Kosten zusätzliche Ausdrucke an, auf denen er Symbole einringelte, Verbindungslinien zeichnete und gezielt Buchstaben oder Teile von Buchstaben nachzog, um ihre Form zu betonen. Oft fertigte er von den bearbeiteten Drucken Kopien an, um sie mit einer weiteren Schicht zu bekritzeln. Ein Vorgang, der sich Dutzende Male wiederholen konnte. Bei einer Abendgesellschaft hatte ich einmal Gelegenheit, einen Blick auf ein solches vielfach beschichtetes Blatt zu werfen. Die Faszination, welche der Anblick in mir auslöste, musste mir anzusehen gewesen sein, denn Leo überließ es mir mit dem Hinweis, es handle sich um eine frühe Iteration. Ich verwahre den Druck noch heute sorgfältig in meinem Schreibtisch und behandle ihn wie eine seltene Grafik eines zu unrecht unbekannten, verstorbenen Künstlers.

Leo erforschte übrigens nicht den Inhalt der Texte. Für die Lebensweise der Ägypter interessierte er sich nur so weit wie zur Enträtselung der Bildzeichen nötig. Er wollte aus den alten Texten etwas über Schrift erfahren, und zwar nicht nur über ägyptische, sondern über jede Schrift. Er sprach zuweilen von seinem Vorhaben, eine eigene Bild-Lautschrift der Neuzeit zu entwickeln, und hielt deshalb immer nach charakteristischen Bildern der Zeit Ausschau. »Es überrascht Sie vielleicht, aber die Faust ist immer noch das elementare Symbol unserer Kultur« und dergleichen Sentenzen pflegte er von sich zu geben. Oder er entdeckte etwas, das ihn sichtlich überraschte: einen Aschenbecher, in dem eine Zigarette abbrannte, deren aschene Spitze herunterhing wie der Stab eines Seiltänzers. Dann zog er sein Notizbuch hervor und zeichnete mit kurzen, schnellen Linien eine Skizze. Er war ein geübter Zeichner, und obwohl er den Stift fast hektisch über das Papier schickte, ließ er kein Detail aus, nicht den Glanz der Keramik und nicht den Schattenwurf der Aschestange. Besonders gut traf er in seinen Zeichnungen die Oberflächen. Ein paar Striche, und man verstand, dass man es mit einem Stück Stoff oder mit der Maserung eines Holzes zu tun hatte. Für mich waren diese Skizzen kleine Kunstwerke, aber ihm waren sie nur Ausgangspunkt, Vorstufe zur eigentlichen Arbeit. Am nächsten Tag im Archiv vereinfachte und abstrahierte er sie und gelangte derart zu einem schlichten Symbol. So schloss er den Vorgang vorläufig ab. Ich sage vorläufig, weil das Symbol in einer Kiste landete, wo es darauf wartete, in das sich ständig erweiternde Schriftsystem entweder integriert zu werden oder in der Schublade der verworfenen Symbole zu enden, aus der kaum eines je entkam.
Nebenbei bemerkt arbeitete Leo fleißig, und noch in der Freizeit kreisten seine Gedanken um die Schriften. Dennoch klappte er allabendlich um fünf vor vier die Mappen zusammen und verstaute sie in seinem Schrank in der Archivecke. Er hatte vier tiefe Laden und darauf etwas Platz für Ordner, mehr brauchte Leo nicht. Die Originale holte er täglich neu aus der Bibliothek und die Fotografien benötigten wenig Platz. Die unbeschriebenen druckte er nicht einmal aus, sondern sammelte sie auf einer externen Festplatte, die über ein Netzteil separat mit Strom versorgt wurde und beim Laden ratterte und brummte. Alle Dateien hatte Leo nach Schriftsystemen und Epochen sortiert und auf entsprechend benannte Ordner verteilt. Kurz vor vier fuhr er seinen Computer herunter, steckte die Festplatte aus, rollte die Stromkabel ein und schloss alles zusammen in den Schrank. Seine Arbeit bedeutete ihm die Pyramiden von Gizeh und den Leuchtturm von Alexandria, aber er verstand wohl, dass sich außer ihm kaum jemand dafür begeisterte. Ich habe mich oft gefragt, wie manche Leute jahrelang einer Arbeit nachgehen können, für die sie höchstens die Anerkennung eines winzigen Kreises erhoffen dürfen. Wer keinen Ruhm erwartet, ist gegen sein Ausbleiben immun. Eine bessere Erklärung habe ich nicht – ich irre letztlich ohne Karte durch ein Labyrinth.
Um Punkt vier also trat Leo den Heimweg an, um für seine Frau Stefanie, die länger arbeitete als er, Abendessen zu kochen. Seine Frau war Ressortleiterin für Innenpolitik bei einer großen Tageszeitung und kam jeden Abend später als geplant und erschöpft nach Hause. Leos Arbeit war leicht und machte ihm Spaß, weshalb es sich gut anfühlte, ihr zumindest das Vergnügen frischer Eiernockerln, eines Strudels oder eines bunten Salats zu bereiten. Wenn sie den gedeckten Tisch sah, weiteten sich ihre Augen und sie drückte Leo und küsste ihn auf den Mund.

Eines Morgens fand Leo auf seinem Schreibtisch eine Nachricht. Der Brief lag ohne Kuvert auf dem Tisch, war ungefaltet und vom Druck noch warm. Leo fragte Kerstin Stummer, die Archivarin und die Einzige, die um diese Zeit schon arbeitete, ob sie etwas über das Schreiben wisse. Sie sagte, der Zettel sei hinterlegt worden, aber von wem könne sie nicht sagen.
Wie das möglich sei, wollte Leo wissen. »Es war doch vor Ihnen niemand hier, und gestern bin ich als Letzter gegangen.«
»Der Brief lag auf dem Platz, als ich kam«, sagte Kerstin.
Leo hätte sich über die Sache nicht weiter gewundert, wenn der Inhalt des Briefes nicht so eigenartig gewesen wäre. Eine Anrede fehlte, und es stand nur ein Satz:
Bin in den Besitz einer alten Schrift gelangt, die Sie interessieren muss. Kommen Sie nach Ihrer Arbeit zum Donaukanal. Keine Unterschrift. Leo faltete das Blatt zweimal sorgfältig und steckte es in die Sakkotasche. Der Befehlston gefiel ihm nicht. Offenbar wollte ihm jemand etwas verkaufen, ein Dieb vielleicht, ein Grabräuber. Aber warum wendete sich der oder die Unbekannte an ihn? Er verdiente wenig. Jedenfalls wusste, wer immer den Brief geschrieben hatte, wie lange Leo arbeitete und auch, dass er einer alten Schrift nicht widerstehen konnte. Beides war kein Geheimnis.
Leo überlegte, ob er sich Verstärkung holen sollte, jemanden ins Vertrauen ziehen. Er wunderte sich, dass das Treffen so spät angesetzt war. So könnte er den ganzen Tag nutzen, um Vorkehrungen zu treffen. Vielleicht wurde er beobachtet und der Deal würde platzen, wenn er das Haus früher verließe als sonst. Leo überlegte, die Polizei einzuschalten, aber bislang war nichts Illegales geschehen. Außer es handelte sich tatsächlich um ein Angebot zum Verkauf eines gestohlenen Schriftstücks. Aber bewies der Brief das bereits?
Da fiel ihm Peter ein, den er hin und wieder traf. Leo hatte das Gefühl, die Archivarin würde zu ihm herüberschielen. Er legte den Brief zur Seite und tat, als vertiefe er sich in seine Arbeit. Ganz so, als wäre der Brief eine bereits vergessene Nebensache. Nachdem er zwanzig Minuten dahingewerkelt hatte, unfähig sich recht zu konzentrieren, ging er auf die Toilette und wählte Peters Nummer.
»Hallo, alter Ägypter«, meldete sich Peter.
»Hallo, Peter«, flüsterte Leo und räusperte sich.
»Bist du krank?«
»Ich bin auf der Toilette und kann nicht frei sprechen.«
»Du klingst gehetzt.«
»Ich brauche deine Hilfe, Peter, zumindest deinen Rat.«
Peter erklärte sich zu allem bereit.
»Auf meinem Schreibtisch«, sagte Leo, »lag diesen Morgen ein Brief. Jemand bietet mir eine ›alte Schrift‹ an. Ich soll nach der Arbeit zum Donaukanal kommen.«
»Sonst nichts?«
»Keine Anhaltspunkte, keine Anrede, keine Unterschrift.«
Peter gab zu, dass es seltsam war.
»Soll ich die Polizei verständigen?«
»Wo am Donaukanal ist der Treffpunkt?«
»Steht dort nicht.«
»Dann folgt dir jemand von der Arbeit.«
»Meinst du?« Leo sah sich um.
»Sonst könnten sie dich nicht finden.«
»Du glaubst, es sind mehrere?«
»Das habe ich nur so gesagt.«
»Peter, bist du noch dran?«
»Warte, ich denke.«
Leo wartete.
»Wir machen es so«, sagte Peter schließlich. »Du machst einfach deine Arbeit wie immer und verlässt das Haus wie immer. Das ist um vier, nicht?«
»Punkt vier, ja.«
»Dann gehst du zum Donaukanal, und zwar zu dieser Stelle gegenüber der Urania.« Peter schnalzte ein paar mal schnell und leise mit der Zunge. »Ich werde im Café Urania sitzen und mir die Sache ansehen. Wenn etwas schiefgeht, gibst du mir ein Signal und ich verständige die Polizei.«
»Was für ein Signal?«
»Du streckst dich einfach«, schlug Peter vor. »Als wärst du müde und verspannt, die Arme hoch über den Kopf, damit ich es gut sehe.«
Leo willigte ein, fragte noch, ob alles gut gehen würde. Peter beruhigte ihn, er müsse sich keine Sorgen machen, er werde vorher die Gegend erkunden, es bestehe keine Gefahr.
Auch den Rest des Tages hatte Leo Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren. Die Archivarin räumte Dokumente von einem Schrank in den anderen und saß ansonsten an der Rezeption und las Facebook. Manchmal lachte sie auf. Dann hatte ihr ein Tiervideo besonders gefallen; ihre Wall war voller Tiervideos.
Abgesehen von Karin war nur Professor Kinnel im Archiv, eine Spezialistin für meroitische Schrift: eine junge Schrift, die den Bildcharakter der ägyptischen Hieroglyphen abgelegt hat und Buchstaben mit Silbenzeichen kombiniert. Die Schrift hatte man decodiert, aber man verstand die Sprache nicht. Kinnel redete immerzu davon, die meroitische Sprache zu entschlüsseln. Ihre Vorlesungen drehten sich dementsprechend hauptsächlich um linguistische Fragen. Manchmal aß Leo mit ihr in der Kantine zu Mittag und ließ sich von den Fortschritten berichten. Anscheinend näherte sie sich der Lösung des Problems. Soweit ich weiß, nähert sie sich noch heute. Die Schwierigkeit liegt vor allem darin, dass wir so wenig über das Leben der Meroer wissen. Manchmal frage ich mich, ob eines Tages Archäologen einer fernen Zukunft die Trümmer unserer Hochkultur untersuchen und angesichts der Flut von Dokumenten und Daten an der kryptischen deutschen Sprache verzweifeln werden. Und dann gäbe es eine wie Greta Kinnel, die es sich in den Kopf setzen würde, die Facebook-Wall von Kerstin Stummer zu begreifen.
Heute aß Greta auswärts mit einer Freundin. Das tat sie sonst nie, und Leo fragte sich, ob ihr Verhalten mit dem Brief zusammenhängen mochte. Womöglich steckte sogar sie hinter der Sache. Andererseits hasste die brave Forscherin Geheimnisse. Wobei – Leos Augenlid zuckte – die besten Geheimnistuerinnen wohl eben diesen Eindruck zu erwecken verstanden.
Eine Fliege setzte sich auf die Fotografie einer demotischen Hieroglyphe. Leo wischte mit der flachen Hand über das Blatt, wobei ein frischer Strich verschmierte. Die Fliege wich aus, zeichnete eine Acht in die Luft und setzte sich diesmal auf Leos Arm. Als Kind konnte er Fliegen erschlagen, aber aus irgendeinem Grund gelang es ihm nicht mehr. Entweder waren die Fliegen schlauer und schneller geworden oder er langsamer. Er ließ die Fliege an seinem linken Unterarm lecken und zeichnete sie dabei. Kein schlechtes Schriftzeichen, eine Fliege, dachte Leo.

So vertrieb er sich den Tag, zeichnete schließlich noch das Muster der Deckenpaneele und die Maserung des Schreibtisches. Zwanzig vor vier kribbelten seine Beine, und er musste auf und ab gehen, um sich davon abzuhalten, früher einzupacken als gewohnt. Die Fliege lag am Fensterbrett, die Beinchen steif verschränkt nach oben gestreckt. Leo fiel ein, dass er sich zu Hause verspäten würde und nicht kochen könnte. Er schrieb seiner Frau eine vage Textnachricht, verschloss die Sachen im Schrank und schlüpfte in seine für die Jahreszeit eigentlich zu warme Daunenjacke. Er verabschiedete sich freundlicher als sonst von der Archivarin und Professor Kinnel, die ebenfalls freundlicher als sonst zurückgrüßten.
Trotz des kühlen Windes saßen an jenem Oktobernachmittag noch Menschen vor den Cafés auf den Straßen. Es war vom Institut aus nur ein kurzer Fußweg zur Urania, wo der Wienfluss in den Donaukanal einmündete und immer ein paar Fischer verseuchte Karpfen aus dem Wasser zogen. Leo sah mit Sorge einen alten Bekannten auf ihn zukommen. Er kannte Walter Immensteiner noch aus der Studienzeit und war gelegentlich bei ihm zum Tee. Immensteiner war Historiker, sie hatten zusammen ein Seminar über untergehende Hochkulturen besucht. Leo interessierten die Ägypter, Immensteiner vor allem das Römische Reich.
Leo hob die Hand, als Immensteiner in Rufweite kam, und begrüßte ihn.
»Leo«, grüßte Immensteiner zurück und erkundigte sich nach dessen Befinden und Bestimmungsort.
»Es geht mir ausgezeichnet«, sagte Leo. »Ist es nicht ein wunderbarer Tag für einen Spaziergang?« Er wollte schon weitergehen, doch dann besann er sich seiner Höflichkeit: »Und selbst? Was treiben die Kinder?«
Immensteiner bestätigte die eigene Gesundheit und berichtete knapp von seiner Tochter, die gerade einen Preis beim Fußball gewonnen hatte. Dann blickte er bekümmert auf seine Uhr, klopfte zweimal dagegen und verabschiedete sich, zu Leos großer Erleichterung. Schon im Fortgehen drehte er den Kopf über die Schulter und sprach eine Einladung zum Tee aus: »Nächsten Sonntag um fünf?«
»Vielleicht kommt auch meine Frau«, sagte Leo und ging seines Weges.
Kurz nach vier. Es gab keinen Grund, sich zu hetzen. Als er die Urania passierte, bemühte er sich, nicht verstohlen in Richtung Terrasse zu blicken, wo Peter hoffentlich schon in Stellung saß. Leo ging langsam, den Blick nach vorne gerichtet. Die Daunenjacke spannte am Nacken, und er hätte sich fast gestreckt und dadurch, ohne es zu wollen, das Signal gegeben. Er schüttelte den Kopf, um sich aufzuwecken, ging über die Brücke, die Rampe hinunter, die zum Kanal führte, und setzte sich auf eine Parkbank. Der grüne Lack war an einigen Stellen abgesplittert und abgerieben. In das freiliegende Holz hatten wahrscheinlich Jugendliche Botschaften und Symbole geschnitzt. »S+L forever«, Stefanie und Leo, schmunzelte Leo. Nicht unwahrscheinlich, dass unter den zahllosen Initialen passende dabei waren. Er fand auch »L+P«, Leo und Peter.
Eine bieder aussehende Frau kam geradewegs auf die Bank zu. Sie bewegte sich steif und trug das Haar hochgesteckt. Leo glaubte einen Moment, Greta Kinnel zu erkennen, aber diese Frau hatte ein dünneres Gesicht und war größer als die Kollegin. Eigentlich ähnelte sie Professor Kinnel nicht im Geringsten, sondern ging nur wie sie. Leo war kurzsichtig und verabsäumte es schon seit einer Weile, seine Brille anzupassen. Deshalb konnte es vorkommen, dass ihn Personen aus der Ferne an jemanden erinnerten, mit dem sie aus der Nähe betrachtet keinerlei Ähnlichkeit verband.
Die Frau setzte sich neben ihn auf die Bank, faltete umständlich eine Ausgabe der Zeit auf und vertiefte sich in den Wirtschaftsteil. Das Feuilleton legte sie zwischen Leo und sich auf die Bank. Die Schlagzeile lautete: »Umstrittene Ausstellung in Kairo«.
»Können Sie mir sagen, wie spät es ist?«, erkundigte sich Leo.
Die Frau warf einen Seitenblick auf seine Uhr, bevor sie auf die ihre sah, Auskunft gab und ein Stück von Leo wegrutschte.
»Beschäftigen Sie sich mit Ägypten?«, fragte er weiter, indem er auf den Zeit-Artikel zeigte.
»Nein … ach so, nein.«
Leo war sein Verhalten plötzlich unangenehm. Die Frau musste denken, er wolle sie kennenlernen. Er hätte so tun können, als würde er seine Uhr stellen, kam es ihm. Vermutlich hätte das nichts geändert. Die dumme Frage nach Ägypten. Am liebsten wollte er gehen, aber damit hätte er das schiefe Bild nur verfestigt. Außerdem musste er in der Gegend bleiben, und das würde erst recht unheimlich wirken.
Er entschied sich für die Flucht nach vorne: »Darf ich?« Leo griff nach dem Feuilleton.
»Bitte«, sagte die Frau.
Leo las den Artikel, ab und zu aufsehend, um festzustellen, ob sich jemand näherte. Es näherte sich niemand: Ein Pärchen spazierte vorbei, Jogger liefen den Kanal entlang und scheuchten die Tauben auf, die Krümel vom Beton pickten. Der Artikel berichtete von einer Ausstellung im Ägyptischen Museum in Kairo, die Raubgut zeigte, welches Archäologen in Zusammenarbeit mit internationalen Behörden zurückzuholen gelungen war. Der Druck des Artikels wirkte fleckig, die Buchstaben waren unterschiedlich dick. Gerne hätte Leo seinen Kugelschreiber hervorgezogen und in den Text Hervorhebungen eingefügt. Er dachte an den Stift in seinem Notizbuch, aber seine Banknachbarin hielt ihn auch so schon für verrückt genug. Er sah verlegen auf die Uhr: schon fast fünf.
»Dürfte ich diese Seite vielleicht mitnehmen?«, fragte Leo.
»Darf ich sehen?« Sie beugte sich vor. »Das Feuilleton können Sie nehmen, das lese ich nie.«
Leo bedankte sich und stand auf, rollte die Zeitung ein und klemmte sie unter den Arm. Er wich einer besonders hurtigen Joggerin aus, schlenderte ein wenig flussabwärts und kehrte, als nichts passierte, zur Urania zurück.
Peter saß vor einer halb aufgegessenen Sachertorte und einer frischen Melange. Er lehnte sich weit zurück und hielt die Arme hinterm Kopf verschränkt.
Leo setzte sich zu ihm und bestellte seinerseits eine Melange.
»Zumindest ist dir vor lauter Anspannung nicht der Appetit vergangen.«
Peter ging nicht auf die Bemerkung ein, sondern erkundigte sich stattdessen nach der Dame auf der Bank.
Leo zuckte mit den Schultern. »Ehrlich gestanden, glaube ich nicht, dass die Nachricht von ihr stammt.«
»Und die Zeitung?«
Leo schilderte, wie es sich zugetragen hatte, worauf ihm Peter die Zeitung aus der Hand nahm und den besagten Artikel begutachtete. Er räumte ein, dass der Druck ungleichmäßig war.
»Es muss nichts bedeuten«, sagte Leo.
»Es bedeutet sogar ziemlich sicher nichts«, sagte Peter. »Du hast nach etwas gesucht, das ins Bild passt, und irgendetwas findet sich immer.« Er brach mit der Gabel ein Stück von seiner Sachertorte, bedeckte es mit Schlagobers und führte es zum Mund. Dann spülte er den Bissen mit einem Schluck Kaffee herunter.
»Das kannst du nicht wissen«, sagte Leo. »Es ist schon ein seltsamer Zufall, dass sie mir gerade einen Artikel über ägyptische Grabräuber hinlegt.«
»Sie hat ihn dir nicht hingelegt, sie hat einfach die Zeitung neben sich gelegt. Hast du nicht gesagt, sie hätte extra noch geschaut, welchen Teil du überhaupt lesen wolltest?«
»Das war, sozusagen, Tarnung.«
Peter nippte nachdenklich an seinem Kaffee. »Natürlich ist dieser Zufall für sich allein betrachtet unwahrscheinlich. Aber so unwahrscheinlich auch wieder nicht. Eins zu tausend? Und wie viele Dinge passieren täglich, jede Minute? Die wahrscheinlichen ignorieren wir und die unwahrscheinlichen behandeln wir wie Orakel.«
Leo richtete sich in seinem geschwungenen Plastikstuhl auf und ließ sich wieder fallen: »Das ist doch hier etwas anderes.«
»Was sagt denn der Code?«
»Ich muss erst in Ruhe daran arbeiten.«
Peter schüttelte den Kopf: »Das ist doch keine Schnitzeljagd. Wenn dir jemand etwas verkaufen will, wird sich die Person an dich wenden.« Er drückte die vom Schlagobers aufgeweichten Krümel zwischen die Rillen seiner Gabel und schleckte sie ab, gurgelte mit dem letzten Schluck lauwarmer Melange und schluckte. »Übrigens ist dir niemand gefolgt. Ich habe erst die Gegend ums Institut erkundet und dann bin ich dir nach. Niemand hatte den gleichen Weg wie du.«
Tasuta katkend on lõppenud.