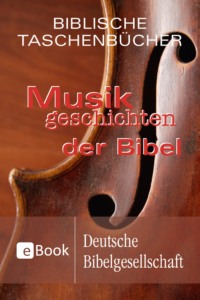Loe raamatut: «Musikgeschichten der Bibel»

Inhaltsverzeichnis
Wer Ohren hat zu hören, der höre! – Vorwort
Musik im Himmel und auf Erden
Heilig, heilig, heilig – Jesajas Vision
Das große Gotteslob – Psalm 148
Musikalische Gottesbegegnung – Die Einweihung des Tempels
Was Gott nicht hören will – Loblieder ohne rechtes Handeln
Ein neues Lied für Himmel und Erde – Das Lamm Gottes
Alltagsmusik und Festmusik
Gesungener Geschichtsunterricht – Deboras Siegeslied
Ein Lied zur Heimkehr aus dem Krieg – Danklied des Königs für Rettung und Sieg
Pädagogik in Liedform – Das Lied des Mose
Tafelmusik – Sirachs Ratschläge
Ein Lied zur Hochzeit – Die Hochzeit des Königs
Ein biblisches Musikfestival – Die Einweihung der Stadtmauer
Wahre Festlichkeit – Der Oberste Priester Simeon
Musik in Freud und Leid
Trommeln vor Freude – Mose und Mirjam
Siegesfeier mit Gesang und Tanz – Judit
Das Lied eines Schuldbewussten – Davids Bitte um Vergebung
Eine königliche Totenklage – Davids Klagelied über Saul und Jonatan
Hoffnung in der Klage – Klagelieder
Tanz in der Bibel
Kultischer Tanz – Der Tanz um das Goldene Kalb
Ekstatischer Tanz I – Gottes Geist ergreift Saul
Ekstatischer Tanz II – Saul bei den Propheten
Unwürdiger Tanz? – David tanzt vor der Bundeslade
Vergeblicher Tanz – Die Entscheidung am Karmel
Verführerischer Tanz – Der Tanz der Salome
Musik mit besonderer Wirkung
Kriegsmusik mit Durchschlagskraft – Die Mauern Jerichos fallen
Hörnerschall als Kriegslist – Gideons Sieg
Gesang ersetzt Waffen – Joschafats Sieg
Musik mit Heilkraft – David und Saul
Musik als Quelle der Inspiration – Elischas rettende Eingebung
Musik sprengt Ketten – Paulus und Silas im Gefängnis
Hymnen und Lobgesänge
Singen, Jauchzen, Loben – Ein neues Lied für den HERRN
Magnifikat – Lobgesang der Maria
Benedictus – Lobgesang des Zacharias
Gloria – Engelsgesang zu Jesu Geburt
Nunc dimittis – Lobgesang des Simeon
Das schönste aller Lieder – Das Hohelied der Liebe
Ohne Musik ist alles nichts – Nachwort
Reihe Biblische Taschenbücher
Impressum
Wer Ohren hat zu hören, der höre!
Vorwort
Schon früh begegnet uns in der Bibel Musik. Wir lesen von Jubal, einem Nachfahren Kains, als dem Stammvater aller Zither- und Flötenspieler (1Mose/Genesis 4,21). Ungewöhnlich und gleichzeitig vielsagend ist die explizite namentliche Erwähnung, wirkten doch Musiker bis weit ins Mittelalter hinein vornehmlich in der Anonymität. Die Namensnennung unterstreicht die besondere Bedeutung, die der Musik als einer frühen Kulturleistung des Menschen sowie ihrem Ahnherren in der Bibel zugebilligt werden. Jubal repräsentiert einen der drei Urberufe: Neben den Hirten und Schmieden waren die Musiker offenbar von Anfang an dabei. Von Anbeginn an ist die Musik Teil der menschlichen Zivilisation.
Menschsein ohne Musik, das scheint es auch in der Bibel nicht zu geben. Wir wissen zwar nicht genau, ob schon Adam und Eva gesungen haben. Unwahrscheinlich ist es aber nicht. Wenn Menschen zusammenkommen und zusammen leben, dann singen und musizieren sie – oftmals noch bevor sie miteinander sprechen. Keine Gemeinschaft und keine Gesellschaft existieren ohne Musik. Menschheitsgeschichtlich kommt das Singen vor dem Sprechen, die Musik als »organisierter Klang« (Edgar Varèse) vor der Sprache.
Musik ist zum Hören bestimmt. Das Hören aber – und besonders das genussvolle Hören von Musik – ist nicht selbstverständlich. Es ist ein komplizierter Sinn. Das Hören nur weniger gesungener Takte verlangt dem Gehirn viele Millionen Operationen ab. Langsam nur hat sich das Gehör entwickelt. Unter den Sinnesorgangen ist es ein Spätentwickler – dafür aber ausgesprochen leistungsfähig: Die Hörzellen reagieren bereits auf Reizenergien, die etwa zehn Millionen Mal kleiner sind als die, die z.B. bei Berührungsempfindungen benötigt werden.
Das Hören hat für den Menschen erhebliche Bedeutung. Es warnt ihn vor Gefahr. Es verbindet ihn mit der Welt, mit allem, was zu ihm gehört. Ein akustischer Reiz wird durch das Hören zu einem individuellen Klangereignis. Jeder Mensch hört anders. Hören ist ein Einverleiben, die persönliche Inbesitznahme eines Geräuschs oder Tons und die sehr individuelle Verknüpfung mit spezifischen Emotionen. Was wir hören, das wird ein Teil von uns.
Insofern ist das Hören auch in religiöser Hinsicht wichtig. Das Evangelium soll gehört werden. Im Gottesdienst ist ein ganz wichtiger Aspekt das Zuhören (Kohelet/Prediger 4,17), und nicht nur dort! Jesus selbst hat gesagt: »Wer Ohren hat, soll gut zuhören!« (Markus 4,9)
Christinnen und Christen sind Menschen mit wachen Ohren, Menschen, die gerne hören und gut zuhören (sollten). Bei Jesaja heißt es: »Jeden Morgen lässt er [Gott] mich aufwachen mit dem Verlangen, ihn zu hören. Begierig horche ich auf das, was er mir zu sagen hat. Er hat mir das Ohr geöffnet und mich bereitgemacht, auf ihn zu hören.« (Jesaja 50,4-5) Hören ist ein Grundvollzug des Glaubens: »Hört auf mich, dann werdet ihr leben!« (Jesaja 55,3) Wer Gottes Wort hört, der lässt es durch sich hindurchklingen. Glauben erwächst aus dem Hören. »Sie können nur zum Glauben kommen, wenn sie die Botschaft gehört haben«, schreibt Paulus (Römer 10,14). Und Gott selbst hat sein Volk aufgerufen: »Höre, Israel!« (5Mose/Deuteronomium 6,4).
Die Glaubensgeschichte ist auch eine Hörgeschichte. Immer wieder offenbart sich Gott auf akustischem Wege. Und viele Menschen glauben, ihn gerade in der Musik spüren zu können. »Gott wohnt in der Musik«, sagt ein altes italienisches Sprichwort. Viele werden das bestätigen können.
Während es ausdrücklich verboten ist, sich ein Bild von Gott zu machen (2Mose/Exodus 20,4), so ist es im Gegenteil wichtig, Menschen über das Ohr – durch Worte, aber auch durch eigens gestaltete Klangwelten und Musik – zum Glauben zu bringen. Hierfür sind und waren auch Spezialisten nötig. Einige Musikerpersönlichkeiten aus der Bibel kennen wir, wenn auch nicht deren genaue Lebensläufe: den bereits erwähnten Jubal zum Beispiel, dann natürlich König David, aber auch Asaf, den Anführer des Chores von David, zugleich Verfasser einiger Psalmen und Mitausgangspunkt einer ganzen Tempelmusikerdynastie. Die Bibel überliefert in 1Chronik 25,1-7 die Namen dieser Tempelmusiker, die mit Gesang und dem Spiel von Becken, Harfen und Lauten Gott preisen sollten. Sie alle waren zu ihrer Zeit berühmte Männer, Spezialisten und Könner auf ihrem Gebiet, dem sie sich voll und ganz und ohne Ablenkung widmen konnten: »Die levitischen Sippen, die für den Gesang am Tempel verantwortlich waren, wohnten in den Kammern am Tempel. Sie waren von aller anderen Arbeit befreit, weil sie Tag und Nacht zu ihrem Dienst bereit sein mussten.« (1Chronik 9,33)
288 Sänger werden erwähnt und viele verschiedene Instrumente – das ist eine erhebliche Infrastruktur, die große Vielfalt erlaubt, um auf die unterschiedlichen Befindlichkeiten der Menschen und die verschiedenen Anforderungen des liturgischen Dienstes reagieren zu können.
Vielfalt und Wandel – das sind zwei Begriffe, die programmatisch stehen können für die biblische Musikkultur. Musik in der Bibel ist alles andere als eintönig. Sie erscheint in vielerlei Form, in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen. Die immer gleiche Musik für jeden Anlass gibt es in der Bibel nicht. In Psalm 150 wird diese Mannigfaltigkeit deutlich:
Halleluja – Preist den HERRN!
Rühmt Gott in seinem Heiligtum!
Lobt Gott, den Mächtigen im Himmel!
Lobt Gott, denn er tut Wunder,
seine Macht hat keine Grenzen!
Lobt Gott mit Hörnerschall,
lobt ihn mit Harfen und Lauten!
Lobt Gott mit Trommeln und Freudentanz,
mit Flöten und mit Saitenspiel!
Lobt Gott mit klingenden Zimbeln,
lobt ihn mit schallenden Becken!
Alles, was atmet,
soll den HERRN rühmen!
Preist den HERRN – Halleluja!
Was kommt da nicht alles zum Einsatz? Es klingt alles, was das antike Instrumentarium hergibt: Hörner, Harfen und Lauten, Trommeln und Flöten, Zimbeln und Becken – und dazu wird getanzt. Vielfältig ist die Klangwelt der Bibel also in jedem Fall, und dennoch soll sie nicht bei sich stehenbleiben. In Psalm 149,1-5 heißt es:
Halleluja – Preist den HERRN!
Singt dem HERRN ein neues Lied,
preist ihn, wenn ihr zusammenkommt,
alle, die ihr zu ihm haltet!
Freu dich, Volk Israel: Er ist dein Schöpfer!
Du Gemeinde auf dem Zionsberg,
juble ihm zu: Er ist dein König!
Rühmt ihn mit festlichem Reigentanz,
singt ihm zum Takt der Tamburine,
ehrt ihn mit eurem Saitenspiel!
Denn der HERR ist freundlich zu seinem Volk,
er erhöht die Erniedrigten durch seine Hilfe.
Alle, die zum HERRN gehören, sollen jubeln,
weil er sie zu Ehren gebracht hat!
Sie sollen vor Freude singen,
auch in der Nacht!
Neu sollen das Lied und die Musik sein. Und immer wieder aufs Neue gesungen werden. Da wird nicht musikalischem Stillstand das Wort geredet, nicht die Pflege eines überkommenen Repertoires, sondern im Gegenteil eine fortlaufende Erneuerung der Musik zum Lobe Gottes gefordert. Nicht unentwegt dasselbe, sondern – je nach Anlass, Zeit, Ort – etwas Anderes, etwas Neues.
Es ist sicher bedauerlich, dass die Musik des alten Israel und der frühen Christenheit heute nicht mehr rekonstruierbar ist. Für unsere (musik-)religiöse Existenz aber ist das letztlich nicht wichtig. Wir müssen nicht wissen, welche Melodien David gesungen hat oder wie genau das vielfältige Instrumentarium dieser Zeit geklungen hat. Musikhistorisch ist das sicher spannend, aber unsere liturgische und außerliturgische Musik dürfte (wenn wir ernst nehmen, was in der Bibel steht) eine solche Einsicht nicht beeinflussen.
Die Wirkung einer bestimmten Musik ist nicht universell, also unabhängig von Ort und Zeit. Und natürlich würden wir, geprägt durch unsere jahrhundertelange Musikkultur und ein vielfältiges Musikleben, auf die Klänge einer »Ugab« – einer antiken Flöte – ganz anders reagieren als die Menschen der letzten vorchristlichen Jahrhunderte. Und ob wir, gewöhnt an die Dynamikskala von Lautsprechern und großen sinfonischen Orchestern, den Klang der Harfe als ebenso »rauschend« wie Jesaja empfinden würden (Jesaja 14,11), ist eher unwahrscheinlich. Was Ijob berührt hat, kann uns moderne Hörerinnen und Hörer kaltlassen. Und so wie wir heute kaum noch verstehen, was eigentlich 1913 der große Skandal bei der Aufführung von Igor Strawinskys Sacre du Printemps war, würden wir vielleicht achselzuckend auf die Musik reagieren, die so beruhigend auf Saul wirkte.
Wie weise ist da doch der biblische Aufruf, nicht zwanghaft an Altem festzuhalten, sich Neuem gegenüber nicht zu versperren und auf diese Weise auch immer wieder zu prüfen, ob die Musik den Anforderungen und Erwartungen der Gegenwart genügt. Aus dem Psalmwort spricht die Aufforderung zur immerwährenden Innovation, zum steten Wandel religiöser Musik- und Musizierpraxis.
Musik erscheint in der Bibel nicht als ein den Menschen überlassener Bestand konkreter Stücke oder Instrumente als Teil des göttlichen Schöpfungswerks. Und den Zehn Geboten ist auch kein musikalisches Regelwerk angehängt. Es ist die Fähigkeit zur Musik, die wir Gott verdanken, die uns aber auch dazu verpflichtet, kreativ mit ihr umzugehen. Die Musik ist nach biblischem Verständnis eine Zivilisationsleistung des Menschen, an der Gott Freude hat (»Er, der den Menschen Ohren gab, sollte selbst nicht hören?«, Psalm 94,9), die er in seinen Besitz nimmt und in den Dienst der Liturgie stellt.
Musik erscheint in unterschiedlichen Zusammenhängen: in ganz weltlichen, aber eben immer auch in religiösen. In diesem Sinne ist Musik nicht per se gut. Entscheidend ist die Haltung, aus der heraus musiziert wird, der Zweck, zu dem sie eingesetzt wird. Auch die Gottlosen haben Musik – da macht uns die Bibel nichts vor. An rein musikalischen Fakten jedoch lässt sich deren Musik nicht erkennen. Jede Musik, jeder Stil kann dem Bösen dienen – aber eben auch dem Guten. Die Idee eines »Kirchenstils« ist der Bibel fremd. Viel wichtiger ist, wie man Musik macht, aus welchem inneren Antrieb. Sämtliche Versuche, einzelne Musikrichtungen als grundsätzlich unchristlich zu brandmarken, sind vor dem Hintergrund der biblischen Offenheit der Musik gegenüber zum Scheitern verurteilt. Wer aus der richtigen Haltung heraus – was auch immer – musiziert, der kann nichts falsch machen. Und er kann auch keine falsche Musik spielen: »Denn durch das Wort Gottes und durch unser Dankgebet wird [alles] rein und heilig«, schreibt Paulus (1Timotheus 4,5). Das gilt ganz bestimmt auch für die Musik.
Musik im Himmel und auf Erden
Einmal im Jahr werden sie herausgeholt: kleine Engelsfiguren aus Holz, fein geschnitzt, viele von ihnen haben ein Musikinstrument in der Hand. Mit ganzen Engelsorchestern können manche Haushalte aufwarten und nehmen damit die Vorstellung auf, dass zumindest einem Teil der himmlischen Heerscharen vornehmlich musikalische Aufgaben zukommt. In Literatur und Malerei begegnen uns immer wieder musizierende Engel. Dass Engel singen – und zwar schön –, steht außer Frage. Sie verstehen ihr Handwerk. Und ihr Geschmack ist erlesen. Ob sie wirklich – wie der Theologe Karl Barth in Wolfgang Amadeus Mozart meinte – Mozarts Musik bevorzugen? Oder – »eia, eia« (EG 70,5) – lallen sie vielleicht eher? Vielleicht klingt ihre Musik ja auch für jeden anders, gerade so, wie man es braucht?
So weit unsere Vorstellung von himmlischer Musik. Ein Blick in die Bibel zeigt aber noch eine andere Seite. Das wenige, was wir dort über die Musik der Engel konkret erfahren, ist keineswegs nur gefällig. Richtig harmonisch wird der Posaunenschall, mit dem die Engel zum Jüngsten Gericht rufen, wohl nicht sein. Und auch bei Ezechiël stellt sich die himmlische Klangkulisse nicht so dar, wie wir uns musikalischen Wohlklang vorstellen: Sie ist beherrscht vom »Rauschen der Flügel«, das »wie die Brandung des Meeres, wie ein Heerlager, wie die Donnerstimme des allmächtigen Gottes« dröhnt (Ezechiël 1,24). Das muss nicht unbedingt Missklang bedeuten, aber man merkt doch: Engelsmusik ist nicht nur Harfenglissando und Gesäusel.
Entsprechend vielfältig sind die Versuche, Engelsmusik nachzuahmen. So unklar ihre konkrete klangliche Gestalt, so inspirierend ist offenbar die Vorstellung, dass Engel musizieren und wir als Menschen es ihnen darin gleichtun können. Wer Musik auf Erden macht, der orientiert sich vielleicht auch an himmlischen Vorbildern. Eduard Mörike dichtete: »Wer sich die Musik erkiest, / hat ein himmlisch Gut bekommen. / Denn ihr erster Ursprung ist / von dem Himmel selbst genommen, / weil die Engel insgemein / selbsten Musikanten sein.« (Altes Verslein, vertont in Hugo Distlers Mörike-Chorliederbuch)
Das Singen auf Erden als Abbild, Aufnahme und Weiterführung der himmlischen Kantorei ist ein wesentlicher Impuls für jedes kirchenmusikalische Tun. Weit verbreitet ist die Idee einer gemeinsamen himmlischen und irdischen Liturgie: Menschen und Engel musizieren gemeinsam und preisen auf diese Weise ihren Schöpfer – im Himmel und auf Erden.
Heilig, heilig, heilig
Jesajas Vision
Nur wenige haben – vom sprichwörtlichen Sinn einmal abgesehen – bisher Engel singen hören. Einer von ihnen war Jesaja. Wohl während eines Gottesdienstes im Jerusalemer Tempel ereilt ihn eine Vision von Gottes Herrlichkeit. Teil der sich ihm eröffnenden Szenerie ist eine Schar Feuerwesen mit jeweils sechs Flügeln – die sogenannten Serafen, keine Engel im landläufigen Sinn, sondern kaum fassbare Mischwesen, denen offenbar die Aufgabe zukommt, Gottes Größe unaufhörlich zu preisen. Im biblischen Text ist dieser Lobpreis zwar als ein »Rufen« beschrieben, doch wie anders als gesungen kann man sich ihr »Heilig, heilig, heilig« vorstellen?
Beeindruckend jedenfalls wird es gewesen sein. Jesaja hat es nicht mehr losgelassen. Sein ganzes prophetisches Tun ist geprägt von dieser Erfahrung. Und seit dem 5. Jahrhundert stimmen wir in diesen Gesang der Engel ein, wenn wir Abendmahl feiern. Im »Sanctus« des Gottesdienstes berühren sich musikalisch Himmel und Erde. Engelsgesang und Menschengesang werden eins. (Jesaja 6)
Es war in dem Jahr, als König Usija starb. Da sah ich den Herrn; er saß auf einem sehr hohen Thron. Der Saum seines Mantels füllte den ganzen Tempel. Er war umgeben von mächtigen Engeln. Jeder von ihnen hatte sechs Flügel; mit zweien bedeckte er sein Gesicht, mit zweien den Leib, zwei hatte er zum Fliegen.
Die Engel riefen einander zu:
»Heilig, heilig, heilig ist der HERR,
der Herrscher der Welt,
die ganze Erde bezeugt seine Macht!«
Von ihrem Rufen bebten die Fundamente des Tempels und das Haus füllte sich mit Rauch.
Vor Angst schrie ich auf: »Ich bin verloren! Ich bin unwürdig, den HERRN zu preisen, und lebe unter einem Volk, das genauso unwürdig ist. Und ich habe den König gesehen, den Herrscher der Welt!«
Da kam einer der mächtigen Engel zu mir geflogen. Er hatte eine glühende Kohle, die er mit der Zange vom Altar genommen hatte. Damit berührte er meinen Mund und sagte: »Die Glut hat deine Lippen berührt. Jetzt bist du von deiner Schuld befreit, deine Sünde ist dir vergeben.«
Dann hörte ich, wie der Herr sagte: »Wen soll ich senden? Wer ist bereit, unser Bote zu sein?«
Ich antwortete: »Ich bin bereit, sende mich!«
Da sagte er: »Geh und sag zu diesem Volk: ›Hört nur zu, ihr versteht doch nichts; seht hin, so viel ihr wollt, ihr erkennt doch nichts!‹ Rede zu ihnen, damit ihre Herzen verstockt werden, ihre Ohren verschlossen und ihre Augen verklebt, sodass sie mit ihren Augen nicht sehen, mit ihren Ohren nicht hören und mit ihrem Verstand nicht erkennen. Ich will nicht, dass sie zu mir umkehren und geheilt werden.«
»Wie lange soll das dauern, Herr?«, fragte ich.
Der HERR antwortete: »Bis die Städte zerstört sind und die Häuser leer stehen und das ganze Land zur Wüste geworden ist. Ich werde die Menschen fortschaffen und das Land wird leer und verlassen sein. Und ist noch ein Zehntel übrig, so wird es ihnen gehen wie den Trieben, die aus dem Stumpf einer gefällten Eiche oder Terebinthe wachsen: Sie werden abgefressen!«
Der Stumpf aber bleibt und aus dem Stumpf wird neues Leben sprossen zu Gottes Ehre.
Das große Gotteslob
Psalm 148
»Erd und Himmel sollen singen, von dem Herrn der Herrlichkeit«, so heißt es in einem neueren Kirchenlied (EG 499,1).
Gottes Herrlichkeit ruft auf zum Lobpreis. Dieser Gedanke bestimmt auch Psalm 148. Alle Welt soll Gott ein »Halleluja« singen: die himmlischen Mächte ebenso wie die Geschöpfe unten auf der Erde. Durch diesen Gesang werden alle eins: Mensch und Natur, Männer und Frauen, Alt und Jung. Ja sogar vermeintlich destruktive Kräfte werden einbezogen: Ungeheuer im Meer, Blitze, Hagel, Schnee und Stürme.
Lobpreis, wohin man hört! Allumfassend und selbstverständlich und unaufgebbar. Rechter Glaube zeigt sich so auch musikalisch. Alles, was ist, ist zum Singen aufgerufen: Engel, Sonne, Mond, Sterne, Natur, Mensch und Tier. Jeder Einzelne. Immer und immer wieder. (Psalm 148)
H
alleluja – Preist den HERRN!
Preist den HERRN, alle seine Geschöpfe,
preist ihn droben im Himmel!
Lobt ihn, alle seine Engel!
Lobt ihn, ihr himmlischen Mächte!
Lobt ihn, Sonne und Mond!
Lobt ihn, ihr leuchtenden Sterne!
Lobt ihn, ihr Weiten des Himmels
und ihr Gewässer über dem Himmelsgewölbe!
Sie alle sollen den HERRN rühmen,
denn sein Befehl rief sie ins Dasein.
Er stellte sie für immer an ihren Platz
und setzte ihnen eine Ordnung,
die sie niemals übertreten dürfen.
Preist den HERRN, alle seine Geschöpfe,
preist ihn unten auf der Erde!
Lobt ihn, ihr Ozeane,
ihr Ungeheuer im Meer!
Lobt ihn, Blitze, Hagel, Schnee und Wolken,
ihr Stürme, die ihr seinen Befehl ausführt!
Lobt ihn, ihr Berge und Hügel,
ihr Obstbäume und Wälder!
Lobt ihn, wilde und zahme Tiere,
ihr Vögel und alles Gewürm!
Lobt ihn, ihr Könige und alle Völker,
ihr Fürsten und Mächtigen der Erde!
Lobt ihn, ihr Männer und Frauen,
Alte und Junge miteinander!
Sie alle sollen den HERRN rühmen!
Denn sein Name allein ist groß;
der Glanz seiner Hoheit
strahlt über Erde und Himmel.
Sein Volk Israel steht ihm nahe;
durch ihn ist es groß und mächtig geworden.
Darum bleibt es ihm treu und preist ihn!
Preist den HERRN – Halleluja!