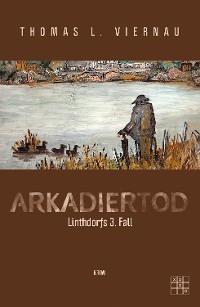Loe raamatut: «Arkadiertod»
Aradiertod
Impressum
Personenregister
Der Entenfütterer
Preußisches Nachtstück
Die Kieselblatt-Akten
Linthdorfs Weihnachten
Visionen einer Königin
Scholetzkis Fundsachen
Tod im Rauch
Der Schachspieler
Kellergespräche
Die Arkadische Gesellschaft
Der Bogenschütze
Wo ist Fräulein Seidelbast?
Linthdorfs Silvester
Schachmatt
Die Flucht
Die große Leere
Das Attentat
Totenstille
Der Verrat
Ein Neujahrsmärchen
Kalte Seelen
Tempus fugit
Drei Könige
Das Protokoll
Endspiel
Über den Autor
Thomas L. Viernau
Aradiertod
Linthdorfs 3. Fall
Kriminalroman
XOXO Verlag
Impressum
Bibliografische Information durch die Deutsche Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://www.d-nb.de abrufbar.
Print-ISBN: 978-3-96752-012-5
E-Book-ISBN: 978-3-96752-512-0
© 2020 XOXO Verlag
Umschlaggestaltung: Grit Richter
Coverbild: Thomas L. Viernau
Buchsatz:
Alfons Th. Seeboth
Hergestellt in Bremen, Germany (EU)
XOXO Verlag ein IMPRINT
der EISERMANN MEDIA GMBH
Gröpelinger Heerstr. 149
28237 Bremen
Alle im Roman vorkommenden Personen sind rein fiktiv. Sollte es zufällige Ähnlichkeiten mit lebenden Personen geben, so ist das nicht beabsichtigt.
Personenregister
Ermittler:
KHK Theo Linthdorf
Ermittler beim Landeskriminalamt Potsdam
KHK Bernd Voßwinkel
Ermittler beim Berliner Landeskriminalamt
Dr. Nägelein
Vorgesetzter Linthdorfs
KOK Grell-Hansen
Ermittler beim Landeskriminalamt Potsdam
KOK Petra Ladinski
Ermittler beim Landeskriminalamt Potsdam
Arkadische Gesellschaft zu Berlin-Brandenburg e.V. - Mitglieder:
Arno Brackebusch (67), Botaniker
Harald Felgentreu (63), Historiker
Cecilia Gieshübler (70), Restaurantleiterin
Robert Gundermann (66), Restaurator
Roswitha Hradschek (70), Archivarin
Felicitas Jeschken (64), Gärtnerin
Winfried Klessenthin (75), Historiker
Alwin Krippenstapel (71), Museologe
Gerda Pittelkow (63), Ingenieurin
Martin Rehbein (65), Techniker
Trude Sellenthin (66), Köchin
Lothar Wedderkopp (72), Graphiker
Gustav Woytasch (68), Lektor
Liane Wüllersdorf (69), Gärtnerin
Justus Ziegenhals (64), Jurist
Weitere Personen:
Dr. Anton Ingolf Scholetzki,
Leiter des Archivs im Schloss Lindstedt
Ina-Maria Seidelbast, wissenschaftliche Mitarbeiterin
Jürgen Rappenstiel, Mitarbeiter im Finanzamt Potsdam
Klaus Höllerbach, Mitarbeiter im Potsdamer Kulturdezernat
Ebbo Hubwarth, Chef von Höllerbach
Lottchen Hubwarth, Ehefrau von Ebbo Hubwarth
Dr. Harry Treibel, Staatssekretär ohne eigenen Geschäftsbereich im Brandenburger Innenministerium
Rolf und Ljudmilla Schwalbentrog, Nachbarn von Harald Felgentreu
Rüdiger Tannfuß, stellvertetender Abteilungsleiter im Brandenburger Innenministerium
Gerlinde Tannfuß, Gattin von Rüdiger Tannfuß, Freundin von Ina-Maria Seidelbast
Werner Malzbrandt, Apfelbauer aus Phöben
Dorothea Bunzmann-Höll, Sekretärin von Malzbrandt
Familie Röbeck, Fischer aus Werder/Havel
Zuzanna Hierrero, Kaltmamsell in der Kantine
Louise Elverdink, Komapatientin in der Charité
Charlotte Rauchfuss, Schwester von Louise Elverdink
Freddi Krespel, Invalidenrentner aus Berlin
Arkadier 1806:
Ottmar von Lindhorst, Archivar im Geheimen Staatsarchiv des Königreichs Preußen
Anselm Paulmann, Konrektor am Grauen Gymnasium
Erasmus Spykher, Geheimer Hofrat im Justizministerium des Königreichs Preußen
Eugen Eisenbaum, Medizinalrat und Militärarzt an der Pépinière zu Berlin
Alois von Vach, Justizrat beim Kammergerichtshof
Cyprian Drosselmeyer, Privatsekretär des ehemaligen Ministers von Hardenberg
Bogislav von Hummel, Königlicher Geheimrat und Sondergesandter des Preußischen Königs
Preußische Gartenmeister:
Carl Friedrich Nietner, zuständig für die Gärten am Neuen Palais
Christian Wilhelm Nietner, zuständig für Park Schönhausen
Carl Julius Sello, oberster Chef des Küchengartens von Sans,Souci. Christian Louis Sello, zuständig für die Orangerie
Carl Friedrich Fintelmann, zuständig für die Charlottenburger Gärten Johann Jacob Krutisch, zuständig für die Melonerie in Sans,Souci.
Johann Zacharias Saltzmann, zuständig für die Schlossterrassen
Artisten und Spezialisten 1806:
Ivor, Bogenschütze
Coppelio, Hypnotiseur und Zauberer
Johann Nepomuk Mälzel, Mechanicus und Erfinder
Henning von Kunckel, schwedischer Mathematiker
Ernst Theodor Wilhelm Hoffmann, Assessor, benannte sich später um in Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, Geheimer Kammergerichtsrat, Schriftsteller, Komponist, Karikaturist
Rosalie und Aurelie Lämmerhirt, zwei Pastorentöchter Adelheid von Korff, Freundin der beiden Lämmerhirt-Schwestern
Weitere historische Persönlichkeiten 1806:
König Friedrich Wilhelm III. von Preußen
Königin Luise, Gattin von Friedrich Wilhelm III.
Fürst Karl August von Hardenberg, Staatsminister im preußischen Kabinett, später Staatskanzler
Major Karl Friedrich von dem Knesebeck, Offizier der Preußischen Armee, später Feldmarschall
Gräfin Julie von Voß, erste Hofdame, Vertraute der Königin
Napoleon Bonaparte, Kaiser der Franzosen
Alle im Roman vorkommenden Personen sind rein fiktiv. Sollte es zufällige Ähnlichkeiten mit lebenden Personen geben, so ist das nicht beabsichtigt.
Der Entenfütterer
Geben Sie Acht,
es sind Preußen.
Die wollen immer alles
besser wissen.
Goethe in einem Brief, 1822
Arkadien und Arkadier
Ursprünglich bezeichnet Arkadien eine Landschaft auf der griechischen Halbinsel Peloponnes. Das antike Arkadien ist eher karg und gebirgig, eine wilde, nur dünn besiedelte Gegend, ziemlich trocken, staubig und steinig. Vorherrschend sind weiss-graue Kalkfelsen und dorniges Gestrüpp.
Die Bewohner der öden Landschaft waren nomadisierende Ziegenhirten. Sie führten ein hartes, einfaches Leben, sehr nah an der Natur. In den Stadtstaaten, weit weg von der stillen Welt in den grünen Küstenstreifen des antiken Griechenlands angesiedelt, wurde schon damals das karge Hinterland als mystisch verklärter Ort angesehen. Reisende berichteten von den arkadischen Gefilden und deren Bewohnern als einem kleinen Paradies.
Vergil, ein römischer Dichter, besang ein paar Jahrhunderte später die arkadischen Gefilde in seinen Hirtengedichten. Er hatte Arkadien nie gesehen und auch nie die wirklichen Bewohner des Landstrichs kennen gelernt. Aber er studierte Aufzeichnungen der alten Hellenen über Arkadien. In seinen Augen erstand ein neues Arkadien, ein Land des Überflusses und der Harmonie. Grüne Gärten, Wiesen, Bäume, dazwischen Vögel und wilde Tiere in friedlicher Eintracht und Hirten, die sich als Wächter des Paradieses gerierten. Natürlich stand für Vergil das antike Italien Pate für sein literarisches Arkadien.
Im Mittelalter vergaßen die Menschen Arkadien und die Idee der natürlichen Harmonie von Natur und Mensch. Erst mit der Renaissance entdeckten die Künstler das Sujet der arkadischen Gefilde wieder. Arkadien wurde zum Leitthema der höfischen Kunst. Später im Barock kam es zu einer Steigerung. Arkadien wurde als ein verfeinertes Lebensgefühl begriffen. Barockkünstler gestalteten Schlösser und Parks im Sinne arkadischer Naturverbundenheit. Schäferspiele, Picknicks im Grünen, Kammermusik in Gartenpavillons und kunstvolle Blumenarrangements, dazu die zeitgemäße Malerei, deren Vertreter unzählige arkadische Landschaften auf die Leinwand zauberten und eine Musik, die versuchte sphärische Harmonien zu erzeugen und dabei die verzückten Zuhörer in eine idealisierte Welt zu entführen. Das barocke Arkadien hatte mit dem antiken Arkadien nicht mehr viel zu tun.
Später lebte Arkadien als ein schwacher Widerhall der barocken Pracht in den bürgerlichen Vaudeville-Gartentheaterstücken fort. Die Romantiker ließen ihre blaue Blume in einem arkadischen Garten erblühen und fügten der Idee der friedlichen Eintracht noch den Gedanken der Vergänglichkeit aller Schönheit hinzu. Melancholie durchzog die arkadischen Gefilde. Heute ist Arkadien vergessen. Nur ein paar Geschichtskenner und Kunstliebhaber können mit dem Begriff noch etwas anfangen. Eigentlich schade …
Vor meiner Tür die Trauerweiden auf dem Damm,
früh legt der Morgen um sie eine Nebelschicht.
Steh‘ an der Brücke, sprech‘ die Wandrer an,
sehn‘ mich ins Uferdorf, besonnt vom Abendlicht.
Qi Bai Xi 1920
Potsdam, Havelufer der Berliner Vorstadt
Freitag, 22. Dezember 2006

Eigentlich waren es Blesshühnchen, die an dem trüben Vormittag auf der Havel herumpaddelten. Kleine, schwarze Vögelchen mit einem weißen Fleck, eben der Blesse, überm Schnabel. Hastig schwammen sie in der kleinen Ausbuchtung der Havel hin und her. Der Grund für ihre Aufregung war eine große, dunkle Gestalt am Ufer. Aus einem alten Baumwollbeutel holte der Mann im Mantel Brotreste hervor, zerkleinerte sie bedächtig und warf sie ins Havelwasser. Jedes Mal, wenn er wieder eine Handvoll Brösel mit Schwung ins Wasser beförderte, stürzten sich die Blesshühnchen gierig auf die Leckerbissen.
Es war einer dieser kalten, trüben Dezembertage, die bei vielen Menschen eine Winterdepression hervorriefen. Auch die Aussicht auf die nahen Feiertage konnte das unbestimmte Gefühl von Melancholie nicht lindern.
Der Mann, der am Ufer stand und den schwarzen Vögelchen bei ihrer Hatz nach den Brotkrumen zusah, hatte seinen Hut tief ins Gesicht gezogen. Seine Miene war nur zu erahnen. Die Brille verwehrte den direkten Blick in seine Augen.
Er kam nun schon seit drei Wochen jeden Vormittag an diese Stelle. Mal waren Stockenten da, mal kamen auch ein paar stattliche Havel-schwäne vorbei, Blesshühnchen gab es immer. Möwen segelten über dem Futterplatz und fischten ebenfalls nach den begehrten Happen. Ein Beobachter, falls es ihn den gäbe, bekäme den Eindruck, dass sich hier ein Ritual vollzöge. Alle Handgriffe des Entenfütterers wurden bedächtig und sorgfältig gemacht, als ob es gälte, einem omi-nösen Flussgott zu opfern, dessen Diener, als Vögel verkleidet, die Opfer-gaben freudig annahmen. Fast eine Stunde stand der Mann am Ufer und beobachtete die Wasservögel bei ihrem Tun. Wind bauschte seinen Mantel wie ein dunkles Segel. Erstaunlicherweise saß der schwarze Hut fest auf seinem Kopf und schien den physikalischen Gesetzen zum Trotz dem Havelwind keinerlei Widerstand entgegenzusetzen.
Ein Blick auf die Armbanduhr, der Entenfütterer rollte seinen Baum-wollbeutel zusammen und spazierte Richtung Glienicker Brücke weiter.
Etwas hatte seine Aufmerksamkeit gefordert. Drüben am anderen Havelufer, auf der Glienicker Seite, die bereits zur Stadt Berlin gehörte, waren Blaulichtfahrzeuge auf der Havelpromenade zu sehen. Das nervöse Aufzucken der blauen Rundumleuchten zerstörte die stille Harmonie des trüben Dezembertags. Missmutig wandte sich der Entenfütterer ab.
Kein Tag ohne Blaulicht!
Er hasste inzwischen die Fahrzeuge, obwohl er wusste, dass ihr Einsatz über Leben und Tod entscheiden konnten. Aber es waren einfach zu viele geworden. Früher gab es mal ein oder zwei Einsätze, die durch die Straßen Berlins jagten. Jetzt kamen sie im Stundentakt. Als ob der normale Verkehr nicht schon genug für Hektik sorgte!
Kopfschüttelnd bröselte er die letzten Krumen ins dunkle Havelwasser und stapfte davon. Inzwischen waren neben den roten Feuerwehrfahrzeugen auch weiße Rettungsfahrzeuge eingetroffen. Er konnte die silber-grünen Autos der Berliner Polizei erkennen. Es schien wohl doch ein mittlerer Katastropheneinsatz zu sein.
Wer weiß, vielleicht war ein unvorsichtiger Mensch ins kalte Havelwasser gefallen. Einen Verkehrsunfall konnte man an diesem Ort ausschließen. Die kleine Havelpromenade war nur für Radfahrer und Fußgänger zugänglich.
Der Entenfütterer kannte die andere Uferseite ebenso gut wie die hiesige. Ihm war das gesamte Areal vertraut. Er liebte die Gegend, die geprägt war von den prächtigen Kulissen der Hohenzollernschlösser und der dazu gehörigen Parklandschaften. In den Hochglanzprospekten der Tourismusbranche wurde die gesamte Region auch als das preußische Arkadien bezeichnet.
Der Mann im schwarzen Mantel wusste über die Bezeichnung der Unterhavelseenlandschaft Bescheid. Er verfolgte die Publikationen zu den alten preußischen Bauten in Potsdam, Berlin und deren Umgebung aufmerksam. Bei seinen Spaziergängen durch die Parklandschaft kehrte er oft in den kleinen Souvenirläden ein. Die Verkäuferinnen kannten ihn. Jedes Mal, wenn etwas Neues auf dem Markt erschien, benachrichtigten sie ihn. Dankbar kaufte er alles, was ihm angeboten wurde. Zuhause hatte er innerhalb von zehn Jahren eine beachtliche Bibliothek aufgebaut.
Aber im Moment war das nicht so wichtig. Der Entenfütterer war unglücklich. Alles hatte für ihn seine Bedeutung verloren. Der große Mann fühlte sich leer und ausgebrannt. Eine Erkenntnis, die außer ihm selbst noch niemand bemerkt hatte. Sein Äußeres wirkte wie immer auf seine Mitmenschen vollkommen harmonisch und ausgewogen. Weder sein Gesichtsausdruck noch seine Körpersprache verrieten seinen inneren Zustand.
Seine Situation hatte etwas mit seinen Nachmittagsterminen zu tun. Jeden Tag fuhr er mit der S-Bahn von Potsdam zurück nach Berlin-Mitte, stieg im Bahnhof Friedrichstraße aus und lief ins Charité-Viertel. Dort lag in einem Zimmer der Neurologie eine Frau. Kabel führten zu diversen Apparaten, die auf kleinen Displays zitternde Kurven erzeugten und ein Sauerstoffschlauch sorgte für Luftzufuhr. Die Frau lag im Koma.
Pünktlich um Sechzehn Uhr erschien der Entenfütterer in ihrem Zimmer, setzte sich behutsam auf den blauen Kunststoffstuhl, der als einziges Mobiliar im Raum stand. Dann saß er da, beobachtete die Frau zwischen den Kabeln, legte ab und zu mal seine Hand auf ihre Schulter, darauf hoffend, dass sie seine Nähe spüre.
Doch es passierte nichts. Das Wunder blieb aus.
Die Frau blieb stumm in ihrem unheimlichen Schlafzustand. Der Mann spürte die Ohnmacht gegenüber dem medizinischen Patt. Weder lebendig noch tot – ein unerträgliches Zwischenstadium, immer wieder Hoffnung erzeugend, die jedoch täglich bei jedem Besuch Zunichte gemacht wurde. Der Mann auf dem blauen Stuhl wusste nicht, wie lange er das noch so durchhalten würde.
Etwas war an dem trüben Dezembernachmittag jedoch anders. Gerade als der große Mann den Raum verlassen wollte, kamen zwei weitere Besucher in das Zimmer.
Ein zwölfjähriger Junge und eine Frau, vielleicht Ende dreißig, Anfang vierzig. Bisher war außer ihm noch nie jemand zu dieser Uhrzeit erschienen. Der Junge war ihm bekannt, es war der Sohn der Frau im Krankenlager. Doch die Frau in seiner Begleitung kannte er nicht, dennoch erinnerte ihn ihr Gesicht. Sie war ziemlich groß, trug eine Brille und eine Wollmütze. Sie schaute den Mann im Zimmer fragend an. »Nanu? Besuch?«
Er war geschockt. Was da vor ihm stand war eine ziemlich originalgetreue Kopie der Frau im Bett. Nicht ganz so groß, etwas kräftiger und mit rotblondem Haar, das unter der Mütze in üppigen Locken hervorquoll, aber ansonsten der Frau im Koma zum Verwechseln ähnlich. Sie lächelte den Mann an. »Oh, wir dachten …«
Der Junge lächelte ihn kurz an. »Tante Charlotte, das ist er. Das ist Theo Linthdorf.«
Die Frau versuchte ebenfalls ein Lächeln. »Louise hat mir von Ihnen erzählt. Schön, Sie endlich mal kennenzulernen. Allerdings, unter diesen Umständen wollte ich nicht …« Sie stockte. Das Lächeln war wieder aus ihrem Gesicht verschwunden.
Linthdorf wunderte sich. Louise hatte ihm gegenüber bisher nicht erwähnt, dass sie eine Schwester hatte. Er beeilte sich, den Hut vom Kopf zu reißen und ihr seine Hand entgegen zu strecken. »Linthdorf, Theo Linthdorf mein Name. Ich habe ihre Schwester …«
Sie unterbrach ihn: »Ja, ich weiß. Rauchfuss. Charlotte Rauchfuss. Ich bin Louises Schwester. Wir sind nur zwei Jahre auseinander. Ich kümmere mich um Bastian, also, jemand muss sich ja um den Jungen kümmern …«
Er nickte und schaute etwas ratlos auf die beiden Besucher. »Ja, also, ich muss dann mal wieder … Also, dann … Frohe Weihnachten! Auch wenn’s im Moment nicht ganz so … Also, ja! Auf Wiedersehen.«
Linthdorf bemerkte, dass er Probleme hatte, sich halbwegs zu artikulieren. Er war im Augenblick nicht in der Verfassung um geistvolle Konversation zu betreiben. Die Frau schien Verständnis für sein Gestammel zu haben. Ihr war die Situation ebenfalls entglitten. Auf die Anwesenheit eines Mannes im Zimmer ihrer Schwester war sie nicht eingestellt. Erleichtert verabschiedete sie sich von Linthdorf, erwiderte die Weihnachtsgrußfloskel und sah dem enteilenden Riesen hinterher.
Linthdorf rannte fast aus dem Krankenhaus. Die Begegnung hatte ihm noch einmal schmerzlich vorgeführt, wie sehr ihn die vergangenen Ereignisse emotional mitgenommen hatten. In dem Moment, als er der Schwester Louises ins Gesicht sah, hatte er einen tiefen Schmerz gespürt, eine Art Stich, der quer durch alle inneren Organe zog. Ob es die Ähnlichkeit mit Louise war oder die unerwartete Begegnung mit einem Menschen, der ihr auch nah stand?
Linthdorf wusste es nicht, hatte auch keine Energie, darüber nachzudenken. Es war ihm einfach zu viel. Sein mühsam aufrecht erhaltenes Gleichgewicht geriet ins Wanken. Die Auszeit, die er seit drei Wochen nahm, hatte daran nichts ändern können.
Die Ereignisse waren in seinem Kopf präsent, als wären sie gerade passiert. Seine Ohnmacht, als er Louise endlich im Keller gefunden hatte und spürte, dass sie ihm entglitt, die darauffolgende Leere, die bis jetzt von ihm Besitz ergriffen hatte – alles kam in den wenigen Sekunden nach der Begegnung mit Charlotte Rauchfuß mit aller Macht an die Oberfläche.
Endlich war er auf der Straße. Es war dunkel und niemand erkannte ihn. Ein langgezogener Klageton entwich seiner Kehle. Linthdorf war erschrocken über diesen Ton, er klang wie von einem geschundenen Tier, das in der Falle auf seinen Schlächter wartet. Was für ein Ende des Tages …
Preußisches Nachtstück
Prinz Louis war gefallen und Preußen fiel – ihm nach!
Bei Jena
Da hatte der Preuße verspielt,
Die Franzosen hatten wie Teufels gezielt,
Und viel preußisch Blut war geflossen.
Theodor Fontane
I
Berlin, Unter den Linden
Samstagabend, 11. Oktober 1806

Die Stadt war menschenleer. Regen hatte eingesetzt und wusch das staubige Kopfsteinpflaster rein. Die meisten Häuser hatten die Fensterläden geschlossen und wirkten abweisend und unbewohnt.
Der Abend war weit fortgeschritten, aus der Ferne klangen die Glocken von Sankt Marien, Sankt Petri und Sankt Nikolai.
Der Mann im dunklen Paletot zählte die Stundenschläge. Den breiten Hut, einen Zweispitz, der normalerweise von der preußischen Gendarmerie getragen wurde, hatte er tief ins Gesicht gezogen, wohl zum Schutz vor dem immer heftiger werdenden Regen. Er musste schlechte Nachrichten überbringen.
Die Berliner Prachtstraße Unter den Linden lag im Dunklen. Seit der König vor einem Monat ein Ultimatum an den französischen Kaiser Napoleon gestellt hatte, war Preußen de facto im Kriegszustand. Lange hatte sich Friedrich Wilhelm III. gegen einen Eintritt Preußens in den Krieg gegen die französischen Eroberer gewehrt.
Er ahnte wohl, dass seine Armee dieser modernen Maschinerie nicht viel entgegenzusetzen hatte. Aber der moralische Druck auf ihn wurde immer größer je weiter Napoleon Richtung Osten voranschritt.
Viele seiner alten Generäle hatten ihn zwar gewarnt, aber letztendlich hatte sich der König doch dem Druck einiger Berater gebeugt.
Und da war noch der junge Prinz Louis-Ferdinand, ein Heißsporn, Träumer und Freund aller schönen Künste. Er wollte an der Spitze des preußischen Heeres reiten und die Franzosen in die Flucht schlagen.
Ach, Prinz!
Was glaubst du denn, was wir den Franzosen entgegensetzen können?
Unsere Armee ist nur ein Schatten!
Was für ein Irrtum!
Und nun bist du tot!
Schon die erste Bataille im thüringischen Saalfeld brachte dir den Tod, welch‘ ein Unglück für Preußen!
Der Mann, der sich den Weg durch den Regen bahnte, murmelte vor sich hin. Tiefe Furchen waren auf seiner Stirn eingegraben, so als ob er immerzu nur grübeln würde. Sein Ziel war das öde Haus mit der Nummer 9. Inmitten der prächtigen Paläste, die das Aussehen der Straße Unter den Linden in den letzten Jahren merklich aufgewertet hatten, wirkte das unscheinbare Haus neben der berühmten Konditorei Fuchs, wie ein Überbleibsel aus vergangenen Zeiten. Berlin war damals noch ein schmuckloses Nest.
Das öde Haus machte einen unbewohnten Eindruck. Jalousien ließen keinen Blick ins Innere zu. Die niedrige Tür war mit Brettern vernagelt.
Der Mann klopfte vorsichtig an die Jalousie des rechten Fensters, direkt neben der Tür. Dreimal kurz, dreimal lang, ein Geheimcode. Eine Kerze flackerte kurz auf, die Jalousie wurde angehoben und mit einem kühnen Schwung verschwand der Mann im Innern des Hauses.
Bei spärlichem Licht waren eine Handvoll Männer versammelt, die den Ankömmling gleich bedrängten.
»Nun sprecht! Was passierte in Thüringen?«
Der so Bedrängte schüttelte nur den Kopf. »Alles ist hin. Der Prinz ist gefallen, schon beim ersten Scharmützel. Eine Kugel zerfetzte ihm die Brust … Wir hatten keine Chance. Die Franzosen, sie sind uns über.«
Einer der Männer im Halbdunkel schaute seine Mitstreiter fest an. »Es werden schwierige Zeiten auf uns zukommen. Wir müssen uns wappnen. Nicht mehr lange, und Napoleon reitet in Berlin ein. Lasst uns Vorkehrungen treffen.«
Der König hat eine Bataille verloren.
Jetzt ist Ruhe die erste Bürgerpflicht …
Graf von der Schulenburg im Oktober 1806
II
Berlin, Unter den Linden
Donnerstagnachmittag, 16. Oktober 1806
Die Stadt befand sich schon seit über einer Woche in einem eigenartigen Zustand der Lähmung. Ein Kaninchen, das vor der gefräßigen Schlange erstarrt und auf seinen Todesbiss wartet. Die Bewohner huschten wie Schatten durch die Gassen, bemüht, nur nicht aufzufallen. Jeder der hier Verbliebenen war in Gedanken weit weg.
Irgendwo im Thüringischen sollten die Armeen aufeinandertreffen. Der König hatte sein Heer in zwei Teilen gen Süden geschickt. Der Vormarsch der Franzosen und ihrer Verbündeten sollte vor den preußischen Grenzen gestoppt werden.
So war der Plan. Kein genialer Plan, aber dennoch ein Plan, gut genug um den Bürgern so etwas wie ein bisschen Hoffnung zu geben. Alles würde gut gehen. Die preußische Armee galt lange Jahre als ein unbesiegbares Wunderwerk. Ihr Ruhm war zwar schon etwas verblasst, aber viele der siegreichen Generäle aus des Alten Fritzens Zeiten waren noch da. Sie würden es schon richten.
Noch warteten alle auf ein Zeichen. Bisher waren nur spärliche Neuigkeiten durchgesickert. Bei Jena sollte es zu einem großen Gefecht gekommen sein. Dort war das erste Heer auf die Franzosen und deren Mitläufer gestoßen.
Heute früh war ein Bote eingetroffen. Er berichtete von einem zweiten Gefecht unweit des Dorfes Auerstedt. Hier sollte das zweite, größere Heer die Franzosen stellen. Drei Tage kämpften nun schon die Armeen.
Am Nachmittag kam ein zweiter Bote in die Stadt. Er war verwundet, blutete stark, stammelte nur. Wahrscheinlich fieberte er in einer Art Delirium. Was er bruchstückhaft von sich gab, war alles andere als ermutigend.
»Alles ist hin! Wir sind verloren. Die waren uns über.«
Etwas Branntwein brachten die Lebensgeister des Boten zurück. Doch was er berichtete, war erschreckend. Beide Preußenheere vernichtend geschlagen.
Napoleons Kavallerie habe alle in Grund und Boden geritten und seine Kanonen würden doppelt so schnell schießen wie die preußischen. Die Generäle Blücher und Scharnhorst wären die einzigen, die noch nennenswerten Widerstand leisteten. So sei wenigstens noch ein halbwegs geordneter Rückzug möglich. Der König sei auf der Flucht, Richtung Oder, zur Festung Küstrin.
Die Festungen Erfurt und Magdeburg hätten sich bereits kampflos ergeben. Napoleons Einmarsch in Preußens Herz Berlin, nur noch eine Frage der Zeit.
Panik machte sich breit. Ein Briefträger riss sich sein Schild mit dem preußischen Adler vom Arm, das ihn als Staatsbeamten auswies. Von den Fassaden wurden überall die Schwarzen Adler entfernt. Alles was auch nur entfernt an preußische Hoheitszeichen erinnerte, wurde von den beflissenen Berlinern übermalt oder abgehangen. Die königliche Kunstausstellung, die erst vor wenigen Wochen geöffnet hatte, schloss ihre Pforten. Man sah, wie eilig Portraitbüsten der königlichen Familie herausgetragen wurden.
Kopfschüttelnd standen ein paar Leute herum und beobachteten das konfuse Treiben ihrer Mitbürger. Wie konnte man nur so schnell die Seiten wechseln? Gab es denn überhaupt kein Ehrgefühl?
Eine sehnige Dame, die vor einem Modesalon herumwirtschaftete und bemüht war, ihr Aushängeschild mit dem schwarzen Preußenadler abzumontieren, lamentierte lautstark herum.
»Wir müssen seh’n wo wir bleiben. Der König haut einfach ab, doch wir müssen uns arrangieren. Keine Zeit für Sentimentalitäten!«
Sie sprach mit gewollt hochdeutschem Sprachduktus und versuchte, ihre Berliner Herkunft zu verleugnen.
Angewidert wandten sich die herumstehenden Männer ab. So etwas hatten sie sich in ihren schlimmsten Alpträumen nicht vorgestellt. Berlin kroch zu Kreuze. Einem Eroberer, der den preußischen Ungehorsam nicht vergessen würde.
Was für ein bitterer Tag war das!
Der Mann mit dem Zweispitz und dem zerfurchten Gesicht stand mitten in der kleinen Gruppe ratlos dreinschauender Männer, die Berlins vorzeitige Kapitulation miterleben mussten. Er musste hier weg. Die Stimmung kippte und er ahnte, dass er nicht mehr sicher war in der Stadt.
Er nickte seinen Begleitern kurz zu. Dann machte er sich auf den Weg. Durchs Brandenburger Tor, quer durch den Tiergarten, nach Charlottenburg und von da weiter Richtung Glienicke, über die Havel in die alte Residenz Potsdam.
Der Besuch Napoleons in der Gruft fand am oder bald nach dem 24. Oktober 1806 statt.
Die Worte: »... lebte er noch, so wären wir nicht hier« soll er angesichts des Degens Friedrich II., ich glaube, dann auf Sanssouci, gesprochen haben.
Hier in der Gruft sagte er nur: »Sic transit gloria mundi.« Draußen fragte er ..., was die Statuen neben der Gruft bedeuteten. Gey sprach etwas von heidnischen Gottheiten, allegorischen Figuren, Symbolen der Kriegskunst etc., als ob Napoleon nie von Mars und Minerva gehört hätte, worauf der Kaiser ihn anstarrte und dann mit einem lauten, langgezogenen »Bah« antwortete.
Theodor Fontane in
»Wanderungen durch die Mark Brandenburg«
Band 6 »Flecken und Dörfer im Lande Ruppin«
III
Potsdam, Park Sans,Souci.
Nacht vom Dienstag zum Mittwoch,
21. zum 22. Oktober 1806

Seit den Zeiten Friedrichs des Großen war der Park Sans,Souci. verwaist. Sein Nachfolger, der als dicker Lüderjahn bekannte Friedrich Wilhelm II., ein Genussmensch, der mit seiner Maitressenwirtschaft Preußen an den Rand des Bankrotts gebracht hatte, zeigte dem Park die kalte Schulter.
Sans,Souci. war das Werk seines ungeliebten Onkels, des Königs Friedrich II. Er, Friedrich Wilhelm II., hatte seinen eigenen Park erbauen lassen: den Neuen Garten. Und zwar ganz so, wie es ihm gefiel. Das Marmorpalais wurde sein Herzstück, in dem er sich auch am liebsten aufhielt. Die gotisch anmutende Privatbibliothek, die einer antiken Ruine nachempfundene königliche Küche und der geheimnisvolle Eiskeller, dessen Pyramidenform allen Rätsel aufgab, waren die Renommierbauten des eitlen Frauenhelden.
Der jetzige König, Friedrich Wilhelm III., war wiederum das ganze Gegenteil seines Vaters. Der hochgewachsene junge Mann, der etwas steif und linkisch in seiner blauen Uniform daherkam, machte kurzerhand Schluss mit der Günstlingswirtschaft, entließ die Minister seines Vaters, allen voran die beiden Hauptverantwortlichen für die Misere: den Finanzminister von Woellner und den Staatsminister von Bischoffwerder, beides auch die führenden Köpfe der unheimlichen Rosenkreuzer-Gesellschaft, in der sein Vater ebenfalls mittat.
Die beiden machte er verantwortlich für die Misswirtschaft. Genauso die Maitresse des Herrn Papa, die Encke, eine Musikantentochter. Sie war als Gräfin Lichtenau bei Hofe etabliert und wurde kurzerhand verbannt.