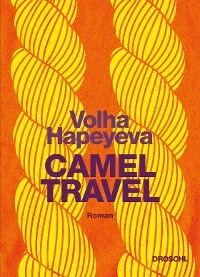Loe raamatut: «Camel Travel»

Volha Hapeyeva
Camel Travel
Roman
Aus dem Belarusischen von Thomas Weiler
Literaturverlag Droschl
Kapitel 1 Issyk-Kul
»Sehr geehrte Fluggäste, unsere Maschine ist in der Heldenstadt Frunse gelandet, die Außentemperatur beträgt 23 Grad über Null, bitte behalten Sie noch Platz, bis die Maschine endgültig zum Stillstand gekommen ist …«
»Huiuiui, Heldenstadt«, dachte ich. »Ist ja ein Ding.«
Flugangst war noch nie ein Problem für mich gewesen, meine Mutter hatte mich an Flugzeuge gewöhnt, als ich noch in ihr drin zur Miete wohnte. Deshalb ließ mich auch diese Reise durch die Wolken völlig kalt. Aber »Heldenstadt« in Verbindung mit dem Zauberwort »Frunse« klang dann doch geheimnis- und eindrucksvoll. Überhaupt war meine gesamte Kindheit überreich mit militärisch-patriotischen Themen gespickt, auch wenn wir schon in den ausgehenden Achtzigern waren und die Sowjetunion munter vor die Hunde ging. Aber das ein oder andere habe ich doch noch mitgenommen aus dem alten Regime. Meine allererste Lehrerin (dieser Elativ kam standardmäßig auf Postkarten oder bei Bildunterschriften zum Einsatz, offenbar mit dem Ziel, den farblosen und wenig prestigeträchtigen Beruf der Unterstufenlehrerin poetisch aufzuladen) hatte in der Schule gesagt, wenn die Staatshymne erklinge, habe man aufzustehen und sie im Stehen schweigend anzuhören. Die Worte dieser Frau, damals eine personifizierte Gottheit für mich, waren Gesetz. Hörte ich zu Hause im Fernsehen die Hymne, sprang ich auf und stand bis zum letzten Ton im Wohnzimmer stramm.
Um uns beständig daran zu erinnern, was Partei und Kommunismus für uns getan hatten (angeblich hatten sie unser Leben glücklicher gemacht und uns in eine lichte Zukunft geführt), waren jederzeit die passenden Attribute zur Hand. So trugen wir als Oktoberkinder diese Sternabzeichen. Es gab unterschiedliche Ausführungen, und wir konnten aussuchen, welches wir uns an den Träger unserer Schulschürze heften wollten. Irgendwann bekam ich zufällig mit, dass das Bild in dem Stern Lenin darstellte, den jungen Wolodja Uljanow, da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen, ich trug einfach ein Sternchen mit was drin. Die Details ergaben also einen Sinn. Ich hatte wohl nicht einmal kapiert, dass Lenin ein Mensch war, vor allem wegen der Losung in unserer Fibel, die in riesigen Lettern besagte:
Lenin lebte,
Lenin lebt,
Lenin wird leben.
Im Vorwort zu dieser Fibel wurden gleich sämtliche Prioritäten gesetzt und erklärt, wen die Kinder in welchem Maße zu lieben hätten: »Du lernst lesen und schreiben. Als Erstes schreibst du die Wörter, die uns allen am liebsten und teuersten sind: Mutter, Heimat, Lenin.« Diese Heimat war mir zu groß und abstrakt, für zusätzliche Verwirrung sorgte in meinem Kindskopf das Vorhandensein zweier Länder (BSSR und UdSSR), zweier Hauptstädte (Minsk und Moskau) und zweier Hymnen (der BSSR und der UdSSR) – um sechs Uhr früh wurde im örtlichen Rundfunk die Hymne der BSSR gespielt, schaltete man auf einen gesamtsowjetischen Sender um, hörte man die Hymne der UdSSR. Als lebten wir parallel in zwei Dimensionen oder im Bauch einer russischen Holzmatrjoschka. Die Dinger konnte ich noch nie leiden, weil sie so schwer aufgingen und so scheußlich kreischten, wenn der rohe Holzrand der oberen Hälfte gegen den der unteren rieb. Meine Lieblingsmatrjoschka war die letzte, weil die nicht aufging und nicht quietschte, glatt und winzig, wie die BSSR im Vergleich zur UdSSR. Die unendlichen Weiten der großen Heimat machten mir Angst, ich wollte mich nicht abfinden mit Matrjoschkaprinzip und Zweitrangigkeit.
An der Identifikationsfrage hatten sich die Ideologen damals gründlich abgearbeitet, und falls doch einmal Zweifel aufkamen, schlugen wir einfach das Heft auf, in das wir unsere Aufgaben schrieben, und lasen die Regeln der Oktoberkinder:
Oktoberkinder sind die Jungen Pioniere von morgen.
Oktoberkinder sind fleißig. Sie lernen eifrig, lieben die Schule und achten die Älteren.
Oktoberkinder sind ehrlich und wahrheitsliebend.
Oktoberkinder vertragen sich. Sie lesen und zeichnen, sie spielen und singen, und sie halten zusammen.
Nur die, die immer strebsam sind, verdienen den Namen Oktoberkind.
In sowjetischen Kinderfilmen liefen die Schüler zu meiner Irritation oft ständig in Schuluniform und mit Pionierhalstuch herum. Wenn unsere Schulklasse einmal einen Ausflug machte, ins Theater oder in die Schwimmhalle ging, trugen alle ihre gewöhnliche Kleidung, niemand wäre auf die Idee gekommen, sich das rote Halstuch umzubinden oder die Uniform anzuziehen. Mir war wirklich unbegreiflich, wie die Filmleute so etwas zeigen konnten, das doch nicht der Wahrheit entsprach. Wenn am Ende des Films dann die Jahreszahl eingeblendet wurde, versuchte ich mich immer damit zu beruhigen, dass das eben früher so war, inzwischen aber ein bisschen anders ist.
Wenn ich meine Mutter irgendwohin begleitete oder in der Küche herumhing, während sie das Abendessen kochte, war meine Lieblingsfrage: »Mama, kennst du Lenin?«
Ich wollte ihr unbedingt erzählen, was ich in der Schule erfahren hatte.
»Nein, kenn ich nicht«, antwortete sie regelmäßig, was mich furchtbar aufregte.
»Wie denn das, Mama, alle kennen Lenin!« So schnell gab ich mich nicht geschlagen.
Mama blieb eisern: »Wir sind nicht persönlich miteinander bekannt.«
Mit politischen Gesprächen zu Hause war es also nicht weit her. Meine Mutter las andere Literatur, von Lenin und der Partei hielt sie sich fern. Aus mir hätte dagegen eine echte, aufrichtige und ergebene Kommunistin werden können, meine Naivität und der Respekt vor den Autoritäten Schule und Lehrerin hatten den Boden bereitet. Aber die Sowjetunion zerfiel, und ich kam über die Pionierin nicht hinaus. Doch das war später, jetzt sind wir in Issyk-Kul, bei Großtanten und Großonkel, anderen Tanten und Onkel, deren Kindern, in einem anderen Land und meinem letzten Sommer vor der Einschulung.
In Frunse wohnten wir bei meinem Großonkel. Der Rest der Familie war gerade weggefahren, sodass wir die Wohnung nur noch mit einem Freund der Familie teilen mussten, den sie nirgends mehr untergekriegt hatten: einem kleinen Hund. Dieser Pekinese fing immer wütend an zu kläffen, wenn ich ihm auf die Schnauze pustete. Spannend war auch der Kassettenrekorder. Aus ihm sang häufig eine männlich heisere Reibeisenstimme. Mein Lieblingsstück aus deren Repertoire war das Lied über den Nachtfalter Puttana. Das hatte gleich mehrere Gründe: Erstens dachte ich, das wäre so ein Bild, und das Lied handle von einem unglücklichen Schmetterlingsmädchen, von dem ich nicht wusste, ob es mehr Schmetterling oder mehr Mädchen war. Die Zeile wer kann denn was dafür klang besonders hoffnungslos und höhnisch, indem sie andeutete, dass nichts und niemand der Ärmsten helfen würde. Das Schicksal der armen Puttana (damals war Puttana für mich eine Schmetterlingsart oder -familie, etwas wie Admiral oder Pfauenauge) erschütterte mich zutiefst, ich litt tatsächlich mit ihr. Wenn ich durch die Wohnung spazierte, schmetterte ich dieses Lied inbrünstig und ohne jede Scham. Die scheelen Blicke der Erwachsenen wollten mir etwas mitteilen, aber das interessierte mich nicht. Zweitens war die Melodie so simpel und eingängig und der Text so voller Tragik, dass das Lied einfach ein Meisterwerk sein musste. Nach den Schmetterlingen kam ein Lied über Kätzchen oder Kater (in dieselbe Richtung). Mein Kindskopf nahm alles sofort für bare Münze – Kätzchen waren Kätzchen und Schmetterlinge Schmetterlinge und nicht etwa Frauen für Männerspielchen. Das ging an meinem Unterbewusstsein nicht spurlos vorbei, seither kann ich mich über jeden aufregen, der Frauen als Objekte missbraucht und Kinderseelen betrügt. Ich will nicht ausschließen, dass der Silberstaub des Feminismus (wie der Feenstaub bei Peter Pan, der die Kinder fliegen ließ) mich schon damals bestäubte, im fernen Kirgisien.
Als ich einmal vor die Haustür wollte, drängten mich ein paar einheimische Jungs in die Ecke und verhörten mich, wo ich überhaupt her wäre. Ich sagte, ich sei aus Belarus, da verlangten sie, ich solle zum Beweis etwas auf Belarusisch sagen. Die minderjährigen Räuber waren offenbar begeisterte Linguisten. Ich ließ mich nicht unterkriegen und trug ihnen als Rezitativ das Lied aus dem Sandmännchen vor: »pakrysie na rasie patuchajuć zorki spluški«.* Diese Ladung fremder Vokabeln muss sie nachhaltig beeindruckt haben, jedenfalls ließen sie mich fortan in Ruhe. Ich selbst habe lange nicht verstanden, was diese zauberhaften »spluški« waren, empfand aber schon damals Dankbarkeit für meine Sprache, da sie mich vor den Halbstarken gerettet hatte.
Ich saß auf der Bank vor dem Haus und ließ die Beine baumeln. Da kam eines der Nachbarmädchen in den Hof, mit einem Zapfen. Na und, ein Zapfen, ist doch nichts dabei. Von wegen! Dieser Zapfen war so groß wie ein Meerschweinchen, er passte nicht mal in eine Hand.
»Schau dir den mal an«, sagte sie und hielt mir ihren Schatz hin.
»Mannomann, das ist mal ein Zapfen!« Ich bekam den Mund nicht wieder zu.
»Da sind noch Nüsschen drin, die kann man rauspicken, knacken und essen.« Und sie pickte ein paar für mich heraus. Ich biss den harten kleinen Kern auf und hatte erstmals diesen besonderen Geschmack auf der Zunge.
»Wo hast du denn den Zapfen her?«, wollte ich wissen.
»Die bringt der Opa mir mit, der fährt dort extra mit der Arbeit hin.«
Wir saßen auf der Bank vor dem Haus und betrachteten den Zapfen. Kein Zapfen, den ich bisher gefunden hatte, kam größenmäßig an diesen heran, außerdem waren sie alle leer gewesen, gegen die Eichhörnchen hatte ich keine Chance. Langsam versank die Sonne hinter den Hochhäusern in der Nachbarschaft, und ich sehnte mich kein bisschen nach Minsk, hatte ich doch zum ersten Mal in meinem Leben einen echten Zedernzapfen in der Hand.
Bei diesem Besuch machten wir nicht nur in Frunse Station, das heute Bischkek heißt, sondern auch bei einem Bruder meines Großonkels in einem Dorf am Issyk-Kul. Mir ging einfach nicht in den Kopf, dass das ein See sein sollte, denn solange wir mit dem Bus fuhren, wollte er einfach kein Ende nehmen, wie ein Meer oder ein sehr langer Fluss. Issyk-Kul bedeutet »heißer See«, er friert nämlich im Winter nicht zu. Das Dorf Bystrowka (heute: Kemin) hat sich mir eingeprägt mit seinem riesigen Haus, den vielen Menschen, einem kleinen schwarzen Welpen, den wir Mucha nannten, und den hausgemachten Nudeln. Damals war ich noch keine Pastaliebhaberin, aber alles Ungewöhnliche konnte meine kindliche Aufmerksamkeit wecken. Bei uns machte kein Mensch Nudeln selbst, alle kauften sie im Laden, und beim Kochen zerfielen sie und klebten dann am Boden des Topfes an. Bei dieser Art Nudeln wurde man wohl kaum zur Pastafreundin. In Kirgisien machten sie die Nudeln selbst. Auf einem großen Tisch im Hof wurde der Teig ausgewellt und anschließend in schmale Streifen geschnitten. An den Geschmack kann ich mich nicht mehr erinnern, auch nicht, ob sie am Kochgeschirr klebten wie unsere, aber die Herstellung sehe ich immer noch deutlich vor mir.
Ein einziges Farbfoto ist mir von dieser Wanderung geblieben. Ich auf einem Kamel. Am Strand war ein Fotograf unterwegs, der Fotos mit seinem Kamel anbot. Im Grunde noch ein Kamelfohlen, war es trotzdem fünfmal so groß wie ich. Und meine Tante sagte, ich müsse mich auf ihm fotografieren lassen. Ich war nicht gerade Feuer und Flamme, hatte aber auch nichts dagegen, also kletterte ich auf das Tier und wollte schon in Richtung Kamera schauen, als mir ein Gedanke durch den Kopf schoss, der mit dem bevorstehenden Foto zusammenhing. Er gab mir zu verstehen, dass ich mit meinem Kugelbauch auf dem Foto nicht gerade eine Traumfigur abgeben würde. Ich sah an mir herunter und, heilige Mutter Gottes, er wölbte sich tatsächlich wie ein rundlicher Hügel. Da musste augenblicklich etwas geschehen, also zog ich den Bauch ein, so weit ich konnte. Die rechte Hand erhoben, als wollte ich jemanden grüßen (offenbar diejenigen, die sich später das Foto anschauen würden), blieb mein sechsjähriges Ich mit einem schiefen Lächeln im Gesicht und stark hervortretenden Rippen (den Bauch gut eingezogen, vielleicht sogar zu gut) auf diesem Foto zurück, mit einer sonderbaren Gleichgültigkeit gegenüber seiner Umgebung, mit Komplexen über den eigenen Körper, hoch oben auf dem Kamel.
Das Abenteuer Leben fing gerade erst an.
Kapitel 2 Nina und Wassil
An dem Tag, an dem mein Flugzeug aus der fernen Heldenstadt Frunse in Minsk ankommen sollte, sagte mein Vater meiner Mutter, er könne mich nicht abholen. Am Nachmittag, meine Mutter war einkaufen und wollte schon zum Flughafen fahren, um mich in Empfang zu nehmen, sah sie meinen Vater. Er ging Arm in Arm mit einer anderen Frau spazieren. Klar konnte er mich nicht abholen, er hatte Wichtigeres zu tun. Mama unternahm nichts, sprach ihn nicht an und machte ihm keine Szene, sie fuhr einfach zum Flughafen und holte ihre Tochter ab.
Anschließend trennten sich die beiden. Und Mama und ich hatten unterschiedliche Nachnamen. Dass Papa jetzt nicht mehr mit Mama zusammenlebte, belastete mich überhaupt nicht. Ich musste ihn nicht mehr zu seinen Freunden mit Bierfahne begleiten und dann mitansehen, wie Mama sich sorgte und herumschrie, wenn wir erst um Mitternacht zurückkamen. Jetzt herrschte Stille, niemand kommandierte herum, und in unserem Gorisont zeichnete sich kein grünes Fußballfeld mehr ab. Fußball im Fernsehen hatte ich noch nie gemocht, viel lieber spielte ich auf dem Platz selbst in der Abwehr.
Die anderen Kinder in der Schule beneideten mich, denn kaum jemand fand das eheliche Verhältnis der Eltern zufriedenstellend. Fast jeden Tag bekamen sie lautstarke Streitereien und Moll-Konzerte für Eltern und Streichorchester zu hören. Aber die Gene lassen sich nicht aus dem Pass entfernen. Es war nicht zu übersehen, wie ähnlich ich meinem Vater war, sowohl äußerlich als auch in bestimmten Angewohnheiten. Besonders gerne erwähnte und betonte das Mamas Mama. Sie suchte meine Gesichtszüge und meine Statur geradezu nach Merkmalen ab, die meine Verwandtschaft zu Papas Mama bezeugten: die Nasenform, den schlanken Wuchs etc., als wolle sie mich nicht akzeptieren, als könne sie mit diesen ausgesuchten biologisch-anthropologischen Charakteristika rechtfertigen, dass ich nicht in ihr System von Lebensregeln passte. Babuljas Profession hatte in ihrem Charakter und bei den Menschen in ihrem Umfeld tiefe Spuren hinterlassen. Ihr gesamtes Berufsleben hatte sie als Dorfschullehrerin für belarusische Sprache und Literatur verbracht.
»Ba, sag mal, Ba, was wolltest du eigentlich werden, als du klein warst?«, startete ich mit untergeschlagenen Beinen auf dem Schemel mein Babulja-Verhör.
»Nichts«, brummte Babulja.
»Wieso nichts? Alle Kinder wollen doch Kosmonauten oder Ärzte werden«, beharrte ich und rief ihr die klassischen Berufswünsche sowjetischer Kinder in Erinnerung.
»Na, jedenfalls ganz bestimmt nicht Lehrerin«, antwortete Babulja.
»Aber was denn dann?« Ich ließ nicht locker.
»Mutter wollte ich werden. Bin ich ja auch«, seufzte sie freudlos und stampfte weiter Kartoffeln für die Schweine, verärgert über ihren Kindertraum. Als hätte man sie betrogen, ihr erzählt, Muttersein wäre gut und sogar ziemlich beneidenswert, wohingegen dann alles ganz anders aussah. Babulja war viermal niedergekommen. Im April, im Mai und zweimal im Februar.
»Und wieso bist du dann Lehrerin geworden?«
»Meine Freundin Rajka wollte, dass wir zusammen studieren, sie hat mich mit zu den Philologen geschleppt.«
»Und wo wolltest du hin?«
»In die Mathematik.«
Ich weiß nicht, ob Babulja als Mathematiklehrerin glücklicher mit ihrem Leben und ihrer Arbeit gewesen wäre, aber sie fühlte sich offenbar als verhindertes Mathegenie.
Ihr Mann (mein Opa) war in dieser Hinsicht auch nicht glücklicher. Die Entscheidung, was er aus seinem Leben machen wollte, verlief in seinem Fall noch tragischer. Sein Vater war nämlich Lehrer und wollte, dass sein Sohn in seine Fußstapfen trat. Obwohl Dsjadulja davon geträumt hatte, Soldat zu werden, Späher, studierte er Russische Sprache und Literatur, weil mein Urgroßvater das so wollte. An der Hochschule lernten sie sich dann kennen: Nina, die statt Mathematik Kolas und Kupala* multipliziert mit den artikulatorischen Charakteristika der Vokalphoneme studierte, und Wassil, der Majakowski und die Besonderheiten der Synekdoche paukte, anstatt sich lautlos durch unbekanntes Terrain zu bewegen und Kryptogramme zu entschlüsseln. Träume sind gut, aber häufig muss man mit sich selbst und seinem Umfeld ringen, bis sie Wirklichkeit werden können, deshalb ist es einfacher, keine zu haben – dann kann man sich die Enttäuschung ersparen.
Als Rentner lag Dsjadulja die ganze Zeit auf dem Sofa und dachte über etwas nach, oder er saß an der Haltestelle gegenüber ihrem Häuschen. Die Hauswirtschaft war ihm so gleichgültig wie seine ganze Umgebung. Er war der Größte in unserer Familie, das hat mir mächtig gut gefallen. Als Dsjadulja mitbekam, dass ich ins Ausland geschickt werden sollte, fragte er:
»Weißt du wenigstens, wie man mit Messer und Gabel isst?«
Ich schüttelte den Kopf, weil ich in den vergangenen neun Jahren immer bestens ohne Messer zurechtgekommen war. Da sagte er, er würde es mir beibringen, und das tat er auch. Wir trainierten an Salzgurken mit Honig, einem gastronomischen Oxymoron, aber ich fand es toll. Dsjadulja dachte sich häufig solche Sachen aus und lachte immer, wenn er mir von seinen Kreationen erzählte. Einmal tischte er mir selbstgemachtes Halwa auf. Jeden Herbst wuchsen im Garten viele Kürbisse, die Kerne wurden aufgehoben und getrocknet. An den Winterabenden enthülste Dsjadulja dann die getrockneten Kerne und drehte sie durch die Kaffeemühle, das ergab so ein Mehl, das mit Honig vermengt sehr gut schmeckte, wie Halwa.
»Hier, für dich«, sagte er und bröckelte mir den Großteil seiner Vorräte hin, »da hast du in der Stadt auch mal was Gutes.«
Der Schnellkurs in Sachen Etikette bei Tisch war erfolgreich absolviert, und Dsjadulja konnte beruhigt sein: Seine Enkelin würde den Ruf der Lehrerfamilie aus dem belarusischen Dorf nicht ruinieren.
Tasuta katkend on lõppenud.