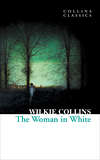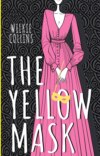Loe raamatut: «Der Mondstein», lehekülg 11
Dreizehntes Capitel
Ich fand Mylady in ihrem Wohnzimmer, sie fuhr auf und sah Verdrießlich aus, als ich ihr meldete, daß Sergeant Cuff sie zu sprechen wünschte.
»Muß ich ihn sprechen,« fragte sie, »können Sie mich nicht vertreten, Gabriel?«
Ich wußte nicht, was ich daraus machen sollte, und ließ diesen Eindruck vermuthlich deutlich auf meinem Gesicht sehen.
Mylady hatte die Güte, sich darauf näher zu erklären.
»Ich fürchte, meine Nerven sind angegriffen,« sagte sie. »Der Polizei-Sergeant aus London hat etwas in seinem Wesen, das mir, ich weiß nicht warum, widersteht. Ich habe ein Vorgefühl als ob er Verwirrung und Unglück in’s Haus bringen würde. Sehr thöricht und mir sehr Unähnlich, aber es ist einmal so.«
Ich wußte nicht, was ich darauf antworten sollte. Je mehr ich von Sergeant Cuff gesehen hatte, desto besser gefiel er mir.
Nachdem Mylady mir so ihr Herz geöffnet hatte, nahm sie sich, als eine Frau von großer Entschlossenheit, die sie war und wie ich sie bereits geschildert habe, wieder zusammen.
»Wenn ich ihn sehen muß, so muß ich es eben über mich ergehen lassen, ich kann mich aber nicht überwinden, ihn allein zu sprechen. Führen Sie ihn herein, Gabriel, aber bleiben Sie im Zimmer, solange er bei mir ist.«
Das war das erste Mal seit ihren Mädchenjahren, daß ich Mylady von ihren Nerven hatte reden hören. Ich ging zurück in’s Boudoir. Herr Franklin schlenderte in den Garten und trat zu Herrn Godfrey, dessen Abfahrtsstunde herannahte.
Sergeant Cuff und ich gingen direct zu Mylady. Bei seinem Anblick ward Mylady noch blässer als vorher, im Uebrigen aber beherrschte sie sich und fragte den Sergeanten, ob er etwas dagegen habe, wenn ich im Zimmer bliebe. Sie hatte die Güte hinzuzufügen, daß ich nicht nur ihr alter Diener, sondern auch ihr erprobter Rathgeber sei, und daß ich bei jeder die Familie betreffenden Angelegenheit die Person sei, die sie am liebsten zu Rathe ziehe.
Der Sergeant antwortete höflich, daß ihm meine Anwesenheit besonders angenehm sei, da er etwas über die Dienerschaft im Allgemeinen zu sagen und meine Erfahrungen in diesem Punkte bereits nützlich gefunden habe. Mylady wies uns zwei Stühle an und wir nahmen Platz, um unsere Conferenz zu beginnen.
»Ich habe mir über den vorliegenden Fall schon eine Meinung gebildet,« begann Sergeant Cuff, »welche vorläufig für mich behalten zu dürfen ich um Ihre Erlaubnis; bitte, Mylady. Ich habe hier zunächst zu melden, was ich in Fräulein Verinder’s Wohnzimmer entdeckt habe und was ich mit Ihrer Erlaubniß, Mylady, demnächst zu thun gedenke.«
Er berichtete dann über die Malerei mit ihrer über gewischten Stelle und über die Schlüsse, die er daraus ziehe, gerade wie er sich gegen Seegreaf ausgesprochen hatte, nur in gewählteren Ausdrücken.
»Eines,« schloß er, »ist sicher. Der Diamant ist nicht in dem Schubfach des Schränkchens. Ein Anderes ist so gut wie sicher: Die Spuren der Farbe müssen sich auf einem Kleidungsstücke irgend einer Person in diesem Hause befinden. Dieses Kleidungsstück müssen wir herausfinden, ehe wir einen Schritt weiter gehen.«
»Und diese Entdeckung,« bemerkte Mylady, »wird vermuthlich die Entdeckung des Diebes mit sich bringen.«
»Bitte um Vergebung, Mylady, ich behaupte nicht, daß der Diamant gestohlen ist; ich beschränke mich für jetzt darauf, zu sagen, daß er vermißt wird. Die Entdeckung des befleckten Kleidungsstückes kann möglicherweise zur Wiederauffindung führen.«
Mylady sah mich an. »Verstehen Sie das?« fragte sie.
»Sergeant Cuff wird es wohl verstehen,« erwiderte ich.
»Aus welche Weise denken Sie das befleckte Kleidungsstück zu finden?« fragte Mylady, sich wieder zum Sergeanten wendend. »Meine braven Diener und Dienerinnen, die seit Jahren in meinem Hause sind, haben sich, mit Beschämung spreche ich es aus, gefallen lassen müssen, ihre Zimmer und Sachen von dem andern Beamten durchsuchen zu lassen. Ich kann und will nicht zugeben, daß ihnen zum zweiten Male in dieser Weise zu nahe getreten wird.« (Sie war eine Herrin, eine Frau, wie man ihrer unter Zehntausend nicht Eine findet.)
»Das ist eben der Punkt, den ich mit Ihnen, Mylady, zu besprechen wünsche. Der erste Beamte hat die Untersuchung dadurch unendlich erschwert, daß er die Dienstboten hat merken lassen, er habe Verdacht auf sie. Wenn ich ihnen zum zweiten Male Veranlassung gebe zu glauben, daß man sie in Verdacht hat, so ist nicht abzusehen, was sie mir nicht alles in den Weg legen werden, besonders die Frauenzimmer. Andererseits müssen ihre Sachen durchaus noch einmal untersucht werden, aus dem einfachen Grunde, daß die erste Durchsuchung ihr Augenmerk lediglich aus den Diamanten richtete, während die zweite sich auf das befleckte Kleidungsstück erstrecken muß. Ich bin vollkommen mit Ihnen einverstanden, daß auf die Gefühle der Dienstboten Rücksicht genommen werden muß, aber eben so fest überzeugt, daß die Kleiderschränke durchsucht werden müssen.«
»Das klappt nicht« Das war der Sinn von dem, was Mylady in gewählteren Worten sagte.
»Ich wüßte ein Mittel der Schwierigkeit zu begegnen,« sagte Cuff, »wenn Sie darauf eingehen wollen, Mylady. Ich schlage vor, daß man den Leuten die Sache vorstellt.«
»Da werden die Frauen auf der Stelle wieder glauben, daß man Verdacht aus sie hat,« rief ich.
»Das werden die Frauen nicht, Herr Betteredge,« sagte Cuff, »wenn ich ihnen sagen kann, daß ich die Garderobe jeder Person, die in der Nacht Vom Mittwoch auf Donnerstag hier geschlafen hat, Mylady mit einbegriffen, untersuchen werde. Dies ist natürlich eine reine Formalität,« fügte er mit einem Seitenblick aus Mylady hinzu. »Aber die Dienstboten werden es als eine sie ehrende Gleichstellung ihrer Herrschaft mit ihnen auffassen, und werden, statt der Untersuchung etwas in den Weg zu legen, es als eine Ehrensache betrachten, dieselbe zu fördern.«
Dies leuchtete mir ein, und auch Mylady konnte sich nach der ersten Ueberraschung der Wahrheit des Gesagten nicht verschließen.
»Sie sind von der Nothwendigkeit der Durchsuchung durchdrungen?« fragte sie.
»Sie ist der kürzeste Weg zum Ziel, Mylady.«
Mylady stand auf, um nach ihrem Kammermädchen zu klingeln.
»Sie sollen,« sagte sie, »die Schlüssel zu meiner Garderobe in der Hand, mit den Leuten reden.«
Sergeant Cuff hielt sie mit einer unerwarteten Frage zurück. »Wäre es nicht besser,« fragte er, »daß wir uns erst der Zustimmung der übrigen Damen und Herren versicherten?«
»Die einzige andere Dame im Hause ist meine Tochter,« antwortete Mylady überrascht; »die einzigen Herren meine Neffen, Herr Blake und Herr Ablewhite. Von allen Dreien ist nicht das geringste Bedenken zu besorgen.«
Ich machte Mylady darauf aufmerksam, daß Mr. Godfrey im Begriff stehe, abzureisen. Kaum hatte ich dies gesagt, als Herr Godfrey in’s Zimmer trat, um Abschied zu nehmen; mit ihm kam Herr Franklin, der ihn zur Station begleiten wollte. Mylady machte die Herren mit der vorliegenden Schwierigkeit bekannt. Herr Godfrey beseitigte, so viel an ihm war, dieselbe auf der Stelle. Er rief Samuel aus dem Fenster zu, seinen Koffer wieder hinaufzutragen, und übergab seinen Schlüssel dem Sergeanten. »Mein Gepäck kann mir nachgeschickt werden, sobald die Untersuchung beendigt ist.« Der Sergeant nahm den Schlüssel mit den gebührenden Entschuldigungen.
»Ich bedaure,« sagte er, »Ihnen wegen einer Formalität Unbequemlichkeit zu verursachen. Aber das Beispiel ihrer Herrschaft wird bei den Domestiken Wunder thun.«
Nachdem Herr Godfrey sehr zärtlichen Abschied von Mylady genommen, hinterließ er eine Botschaft für Miß Rachel, deren Ausdruck es mir zweifellos machte, daß er ihr Nein nicht für endgültig halte, und daß er ihr die Heirathsfrage bei der nächsten Gelegenheit wieder vorzulegen gedenke.
Herr Franklin erklärte dem Sergeanten, als er mit seinem Vetter fortging, daß alle seine Kleider, wie Alles was er besitze, in seinem Zimmer unverschlossen daliege und ohne Weiteres durchsucht werden könne. Sergeant Cuff dankte verbindlichst. Wie der Leser gesehen hat, hatte Cuff das bereitwilligste Entgegenkommen bei Mylady, bei Herrn Godfrey und bei Herrn Franklin gefunden. Es erübrigte nur noch, auch Fräulein Rachel’s Zustimmung einzuholen, bevor wir die Domestiken zusammenberiefen, um mit der Durchsuchung der Sachen zu beginnen.
Mylady’s unerklärliche Abneigung gegen den Sergeanten trat bei unserer Conferenz, als wir wieder allein waren, noch stärker hervor. »Wenn ich Ihnen noch die Schlüssel meiner Tochter heruntergeschickt haben werde,« sagte sie zu ihm, »so habe ich, denke ich, Alles gethan, was Sie augenblicklich von mir verlangen.«
»Um Vergebung, Mylady, bevor wir beginnen, möchte ich Sie, wenn es Ihnen recht ist, um Ihr Wäschebuch bitten. Das befleckte Kleidungsstück kann möglicher Weise zur Leibwäsche gehören. Wenn die Durchsuchung der Kleider nichts ergiebt, so muß ich dieselbe auf alle im Hause befindliche und zur Wäsche geschickte Leibwäsche erstrecken Wenn ein Stück fehlt, so wird wenigstens die Vermuthung nahe liegen, daß es das befleckte, und daß es geflissentlich gestern oder heute fortgebracht sei. Herr Seegreaf,« fügte Herr Cuff zu mir gewandt hinzu, »lenkte die Aufmerksamkeit der Mägde auf die übergewischte Stelle an der Thür, als sie sich zusammen in das Zimmer gedrängt hatten. Das wird sich vielleicht auch noch als einer von den vielen Mißgriffen des Herrn Seegreaf herausstellen.«
Mylady befahl mir, zu klingeln und das Waschbuch zu beordern. Sie blieb bei uns, bis es gebracht war, für den Fall daß Sergeant Cuff, nachdem er es durchgesehen, noch eine Frage an sie zu richten haben sollte.
Das Waschbuch ward von Rosanna Spearman gebracht. Das Mädchen sah an jenem Morgen noch jämmerlich blaß und verstört aus, war aber doch wieder wohl genug, um ihre gewöhnliche Arbeit verrichten zu können. Herr Cuff betrachtete das Gesicht und die verwachsene Schulter des Mädchens sehr aufmerksam.
»Haben Sie mir noch irgend etwas zu sagen,« fragte Mylady mit dem Ausdruck des sehnlichsten Verlangens, sich von der Gesellschaft des Sergeanten befreit zu sehen.
Der große Cuff schlug das Wäschebuch auf, fand sich in wenigen Augenblicken darin zurecht und schlug es wieder zu. »Ich muß Sie noch mit einer letzten Frage behelligen, Mylady. Ist das junge Mädchen, welches das Buch soeben hereinbrachte, schon so lange wie die übrigen Dienstboten in Ihrem Hause?«
»Weshalb fragen Sie danach?«
»Als ich sie zuletzt sah, saß sie eines Diebstahls wegen im Gefängniß« Es blieb nichts übrig, als ihm die Wahrheit zu sagen. Mylady betonte sehr entschieden das gute Verhalten Rosanna’s in ihrem Dienst und die gute Meinung, welche die Hausmutter in der Besserungs-Anstalt von ihr gehabt hatte. »Ich hoffe, Sie hegen keinen Verdacht gegen sie,« schloß Mylady.
»Ich erlaubte mir schon zu bemerken, Mylady, daß ich bis jetzt Niemanden hier im Hause in Verdacht habe, einen Diebstahl begangen zu haben.«
Darauf erhob sich Mylady, um hinauf zu gehen und Fräulein Rachel um ihren Schlüssel zu bitten.
Der Sergeant kam mir zuvor, die Thür zu öffnen, indem er sich tief verbeugte; Mylady fuhr zusammen, als sie an ihm vorüberging. Wir warteten und warteten, aber keine Schlüssel kamen. Sergeant Cuff machte keinerlei Bemerkung. Er blickte mit seinen melancholischen Augen zum Fenster hinaus, steckte seine magern Hände in die Taschen und pfiff »Die letzte Rose« trübselig vor sich hin. Endlich trat Samuel herein, ohne die Schlüssel, aber mit einem Zettel für mich. Ich holte meine Brille mit einiger Verlegenheit hervor, denn ich fühlte, daß Cuff’s scharfe Augen fest auf mich gerichtet waren. Das Papier enthielt zwei bis drei von Mylady mit Bleistift geschriebene Zeilen. Sie benachrichtigte mich, daß Fräulein Rachel sich entschieden weigere, ihre Garderobe durchsuchen zu lassen, und auf die Frage nach ihren Gründen lediglich mit Thränen geantwortet habe. Als Mylady in sie gedrungen, habe sie geantwortet: »Ich will nicht, weil ich nicht will, und ich werde mich nur der Gewalt fügen« Ich begriff, daß Mylady nicht mit einer solchen Antwort ihrer Tochter Sergeant Cuff gegenüberzutreten wünsche. Wäre ich nicht für die liebenswürdigen Schwächen der Jugend zu alt gewesen, so wäre ich selbst bei dem Gedanken, ihm mit dieser Antwort gegenüberzutreten, erröthet.
»Haben Sie Nachrichten über Fräulein Verinder’s Schlüssel?« fragte Cuff.
»Das Fräulein weigert sich, ihre Garderobe durchsuchen zu lassen.«
»Ei,« sagte der Sergeant; in seiner Stimme verrieth sich etwas von Erregung, von welcher sein Gesicht keine Spur zeigte. Sein »Ei« klang, als ob etwas eingetroffen sei, was er erwartet hatte. Seine Aeußerung ärgerte und erschreckte mich, warum, weiß ich nicht.
»Müssen wir die Untersuchung aufgeben?«
»Ja,« erwiderte der Sergeant, »sie muß aufgegeben werden, weil Ihr Fräulein sich weigert, sich derselben gleich den übrigen Hausbewohnern zu unterziehen. Wenn wir nicht alle Garderoben im Hause durchsuchen können, so nützt die ganze Durchsuchung nichts. Schicken Sie Herrn Ablewhite’s Gepäck mit dem nächsten Zuge nach London und geben Sie das Wäschebuch mit meiner Empfehlung und meinem Dank dem jungen Mädchen zurück, das es vorhin herein brachte.«
Er legte das Wäschebuch auf den Tisch, nahm sein Federmesser aus der Tasche und fing an, sich mit demselben die Nägel zu putzen.
»Die Sache scheint Sie nicht zu überraschen,« fragte ich.
»Nein,« antwortete Cuff, »nicht sehr.«
Ich versuchte ihm eine Erklärung zu entlocken »Warum widersetzt sich wohl Fräulein Rachel Ihrer Untersuchung? Wäre es gerade nicht in ihrem Interesse, Ihnen behilflich zu sein?«
»Warten Sie ein wenig, Herr Betteredge, warten Sie nur ein wenig!«
Klügere Leute als ich, oder Leute, die weniger auf Fräulein Rachel gehalten, hätten vielleicht seine Absicht durchschaut. Mylady’s Abneigung gegen ihn war, wie ich mir später gedacht habe, vielleicht dadurch zu erklären, daß sie seine Absicht, wie es in der Schrift heißt, »in einem dunkeln Spiegel schaute.« Gewiß ist, daß ich dieselbe noch nicht erkannte.
»Was ist nun zu thun?« fragte ich.
Sergeant Cuff beendete seine Arbeit an dem Nagel, an dem er eben beschäftigt war, sah denselben mit einem Blick melancholischen Interesses an und klappte sein Federmesser zu.
»Kommen Sie mit mir in den Garten,« sagte er, »und lassen Sie uns die Rosen noch ein wenig ansehen.«
Vierzehntes Capitel
Der nächste Weg nach dem Garten, wenn man aus Mylady’s Wohnzimmer kam, führte längs dem Gebüsch hin, das der Leser schon kennt. Zum besseren Verständnis; dessen, was ich jetzt zu erzählen habe, füge ich hinzu, daß dieser Weg Herrn Franklin’s Lieblings-Spaziergang war. Wenn er sich im Freien aufhielt und wir ihn sonst nirgends finden konnten, so fanden wir ihn meistentheils schließlich hier. Ich kann nicht leugnen, daß ich ein etwas hartnäckiger alter Mann bin. Je fester Sergeant Cuff seine Gedanken vor mir verschloß, desto fester beharrte ich bei dem Versuch, in dieselben einzudringen. Als wir in den besagten Weg einlenkten, versuchte ich ihn aus andere Weise zu überlisten. »Wie die Sachen jetzt stehen,« sagte ich, »wäre ich an Ihrer Stelle mit meinem Latein zu Ende.
»Wenn Sie an meiner Stelle wären,« sagte der Sergeant, »so würden Sie sich eine Meinung gebildet haben, und wie die Sachen jetzt stehen, jeden Zweifel, den Sie vielleicht noch an der Richtigkeit Ihrer Schlüsse gehegt hätten, vollständig beseitigt finden. Gleichviel, Herr Betteredge, für jetzt, worin diese Schlüsse bestehen. Ich habe Sie nicht gebeten, mich hierher zu führen, um mich von Ihnen wie ein Dachs aus dem Loche locken zu lassen, sondern um mir eine Auskunft von Ihnen zu erbittert. Sie hätten mir dieselbe ohne Zweifel auch eben so gut im Hause geben können. Aber Thüren und Lauscher haben eine natürliche Neigung, sich einander zu nähern, und in meinem Beruf pflegen wir eine gesunde Vorliebe für frische Luft zu haben.«
Ich mußte es mir wohl vergehen lassen, diesen Mann zu überlisten. Ich ergab mich in mein Schicksal und wartete so geduldig wie möglich der Dinge, die da kommen würden.
»Wir wollen auf die Gründe Ihres Fräuleins nicht näher eingehen,« fuhr er fort. »Wir wollen uns damit begnügen zu sagen, es ist schade, daß sie sich weigert, mir behilflich zu sein, weil sie dadurch die Untersuchung schwieriger macht, als sie sonst gewesen sein würde. Wir müssen jetzt versuchen, das Geheimniß des Flecks aus der Malerei, welches, das können Sie mir aufs Wort glauben, identisch mit dem Geheimniß des Diamanten ist, auf anderem Wege zu ergründen. Ich habe beschlossen, die Domestiken kommen zu lassen, um anstatt ihrer Garderoben ihre Gedanken und Handlungen zu durchsuchen. Bevor ich jedoch damit beginne, möchte ich noch eine oder zwei Fragen an Sie richten.« Sie sind ein guter Beobachter. Haben Sie seit der Entdeckung des Verlustes des Diamanten bei irgend einem der Dienstboten, abgesehen von den ganz natürlichen Wirkungen des Schrecks, dem Zusammenstecken der Köpfe, dem Flüstern u. s. w. irgend etwas Auffallendes bemerkt: einen besonderen Streit unter ihnen, eine ungewöhnliche Gemüthserregung ein unerwartetes Aufbrausen oder ein plötzliches Unwohlsein und dergleichen?«
Ich hatte eben noch Zeit, an Rosanna Spearman’s gestriges Unwohlsein bei Tische zu denken, aber nicht mehr Zeit zum Antworten, denn plötzlich blickte Cuff seitwärts nach dem Gebüsch und sagte leise zu sich: »Halloh!«
»Was giebt’s?« fragte ich.
»Ein rheumatisches Zucken im Rücken,« sagte der Sergeant mit lauter Stimme, als ob er wünsche, daß eine dritte Person uns höre. »Das Wetter wird sich bald ändern!« Ein paar Schritte weiter brachten uns an die Ecke des Hauses; wir machten rechtsum kehrt, traten auf die Terrasse und gingen die Mitteltreppe hinab in den Garten. Hier wo man einen freien Ueberblick nach allen Seiten hin hatte, stand Sergeant Cuff still.
»A propos wegen der jungen Person Rosanna Spearman,« fing er an, »es ist nach ihrem Aeußern nicht sehr wahrscheinlich, daß sie einen Liebhaber hat. Aber um ihrer selbst willen muß ich Sie doch gleich fragen, ob das arme Ding, wie alle andern Mädchen, einen Schatz hat.«
Was in aller Welt konnte ihn veranlassen, mir unter den gegenwärtigen Umständen diese Frage zu stellen? Statt aller Antwort sah ich ihm starr in’s Gesicht.
»Ich habe Rosanna Spearman im Vorübergehen im Gebüsch versteckt gesehen.«
»Als Sie Halloh riefen?«
»In demselben Augenblick. Wenn sie einen Schatz hat, so hat das Verstecken nichts zu bedeuten, hat sie aber keinen, so ist es, wie die Dinge hier stehen, ein höchst verdächtiger Umstand, und ich werde zu meinem Bedauern genöthigt sein, demgemäß vorzugehen.«
Was sollte ich darauf sagen? – Ich wußte, daß der Weg am Gebüsch Herrn Franklins Lieblingsspaziergang war, ich wußte, daß er höchst wahrscheinlich bei seiner Rückkehr dorthin gehen würde, ich wußte, daß Penelope hundertmal Rosanna sich dort hatte herumtreiben sehen, und daß sie immer behauptet hatte, der einzige Zweck des Mädchens dabei sei, Herrn Franklins Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Wenn meine Tochter Recht hatte, so ist es nur zu wahrscheinlich, daß Rosanna in Erwartung von Herrn Franklin’s Rückkehr auf der Lauer stand. Ich befand mich also in der unangenehmen Alternative, entweder Penelopes Meinung als die meinige auszusprechen, oder das unglückliche Geschöpf den Folgen, den ernsten Folgen des Verdachts von Sergeant Cuff auszusetzen.
Aus reinem Mitleiden für das Mädchen – auf Ehre und Gewissen, aus reinem Mitleiden gab ich dem Sergeanten den nöthigen Aufschluß, und erzählte ihm, daß Rosanna närrisch genug gewesen sei, sich in Herrn Franklin zu verlieben.
Sergeant Cuff lachte niemals – bei den seltenen Gelegenheiten, wo ihn etwas ergötzte, zuckte er ein wenig mit den Mundwinkeln – weiter nichts So zuckte er jetzt.
»Würden Sie nicht richtiger gesagt haben, sie ist närrisch genug, häßlich und nur ein Dienstmädchen zu sein?« fragte er. »Das Verlieben in einen Mann von Herrn Blakes Aussehen und Benehmen scheint mir bei Weitem nicht das Närrischste an ihrem Betragen. Indessen bin ich froh, die Sache aufgeklärt zu sehen. Es gewährt immer eine Beruhigung, wenn man klar sieht. Ja, ich werde die Sache für mich behalten, Herr Betteredge. Ich habe gern Nachsicht mit menschlichen Schwächen obgleich ich in meinem Beruf nicht viel Gelegenheit habe, diese Tugend zu üben. Glauben Sie, daß Herr Blake eine Ahnung von der Leidenschaft des, Mädchens für ihn hat? Wenn sie hübsch wäre, würde er es rasch genug gemerkt haben. Die häßlichen Mädchen haben ein trauriges Loos in dieser Welt, hoffen wir, daß es ihnen in der anderen besser gehen wird.
Nun sehen Sie einmal selbst, wie viel besser sich die Blumen zwischen Gras als zwischen Kies ausnehmen. Nein, ich danke, ich will keine Rose, es schneidet mir ins Herz, sie zu brechen, gerade wie es Ihnen ins Herz schneidet, wissen Sie, wenn im Domestikenzimmer etwas verkehrt geht. Haben Sie etwas Auffallendes an irgend einem der Dienstboten unmittelbar nach dem Verlust des Diamanten bemerkt?«
Bis jetzt war ich ganz gut mit dem Sergeanten ausgekommen; aber die Schlauheit, mit der er diese Frage herbeigeführt hatte, machte mich behutsam. Offen gestanden, sagte es mir durchaus nicht zu, ihm seine Fragen über meine Mitdienstboten zu beantworten.
»Ich habe nichts bemerkt,« sagte ich, außer daß wir Alle, ich selbst nicht ausgenommen, den Kopf verloren hatten.«
»O,« erwiderte Cuff, »ist das Alles, was Sie mir mitzutheilen haben?«
Ich antwortete mit, wie ich mir schmeichelte, undeutlicher Miene: »Alles!«
»Herr Betteredge,« sagte er, » geben Sie mir die Hand. Sie gefallen mir ganz außerordentlich!«
Warum er gerade den Augenblick, wo ich ihn hinterging, wählte, mir diesen Beweis seiner Hochachtung zu geben, übersteigt meine Fassungskraft. Ich war stolz, es erfüllte mich in der That mit einigem Stolz, daß der berühmte Cuff einmal seinen Mann gefunden hatte!
Wir gingen wieder ins Haus, wo mich der Sergeant bat, ihm ein Zimmer anzuweisen und ihm die zum Hause gehörenden Dienstboten, einen nach dem andern in der Reihenfolge ihres Ranges zu schicken. Ich führte den Sergeanten in mein eigenes Zimmer und rief dann die Dienstboten in die Halle zusammen.
Rosanna war unter ihnen und zeigte in ihrem Benehmen nichts Auffallendes. Sie war in ihrer Weise nicht weniger scharfblickend als der Sergeant in seiner und ich glaube beinahe, daß sie gehört hatte, was er über die Dienstboten im Allgemeinen gerade bevor er ihrer ansichtig wurde, zu mir gesagt hatte. Jedenfalls sah sie jetzt aus, als ob sie in ihrem Leben von einem Weg am Gebüsch nie etwas gehört habe. Ich schickte die Leute, einen nach dem andern, wie Sergeant Cuff gewünscht, zu ihm hinein.
Die Köchin war die erste, an welche die Reihe kam, die in einen Gerichtssaal verwandelte Stube zu betreten. Sie blieb nur eine kurze Weile dort. Ihr Bericht beim herauskommen lautete: »Sergeant Cuff ist in übler Stimmung, aber Sergeant Cuff ist ein vollendeter Gentleman.« Myladys Kammermädchen war die nächste. Sie berichten: »Wenn Sergeant Cuff einem respectablen Mädchen nicht glauben will, so sollte er wenigstens seine Meinung für sich behalten.« Dann kam Penelope; sie blieb nur wenige Augenblicke und berichten: »Sergeant Cuff ist sehr zu bedauern, er muß als junger Mann Unglück in der Liebe gehabt haben.« Auf Penelope folgte das erste Hausmädchen, sie blieb, wie Myladys Kammermädchen, ziemlich lange und berichtete: »Ich habe die Stelle bei Mylady nicht aufgenommen, Herr Betteredge, um mir von einem niedrigen Polizeibeamten in’s Gesicht sagen zu lassen, daß er mir nicht glaubt.« Die nächste war Rosanna Spearman; sie blieb länger als irgend eine der Andern; sie berichtete nichts, sondern hielt ihre todtenbleichen Lippen fest verschlossen. Auf Rosanna folgte der Diener Samuel, der nur wenige Minuten blieb und berichtete: »Der Kerl, der Sergeant Cuffs Stiefel gewichst hat, sollte sich schämen!« Das Küchenmädchen Nancy war die letzte. Sie blieb nur wenige Minuten und berichtete: »Sergeant Cuff ist ein guter Mann, er erlaubt sich keine Späße mit einem armen Mädchen, Herr Betteredge!«
Als ich, nachdem das Verhör vorüber war, in den Gerichtssaal trat, um zu hören, ob etwas von mir gewünscht werde, fand ich den Sergeanten wieder bei seiner Lieblingsbeschäftigung Er sah zum Fenster hinaus und pfiff die »letzte Rose«. »Haben Sie etwas entdeckt, Herr Cuff?«
»Wenn Rosanna Spearman um Erlaubniß bittet, auszugehen, lassen Sie das arme Mädchen gehen, aber sagen Sie mir vorher Bescheid.«
Ich hätte doch wohl besser gethan, über Rosanna und Herrn Franklin zu schweigen. Es war klar, das Unglückliche Mädchen war trotz Allem, was ich dagegen thun mochte, dem Sergeanten verdächtig »Ich hoffe,« wagte ich zu bemerken, »Sie sind nicht der Ansicht, daß Rosanna etwas mit dem Verlust des Diamanten zu thun hat.« Der Sergeant zuckte mit den Mundwinkeln und sah mich scharf an, gerade wie er es im Garten gethan.
»Ich glaube, lieber Herr Betteredge, es ist besser, wenn ich Ihnen darauf nicht antworte. Sie möchten sonst, wissen Sie, Ihren Kopf zum zweiten Male verlieren.«
Jetzt stiegen leise Bedenken in mir auf, ob Sergeant Cuff wirklich seinen Mann an mir gefunden habe. Ich fühlte mich erleichtert, als wir hier durch Klopfen an der Thür und eine Botschaft von der Köchin unterbrochen wurden, Rosanna habe um Erlaubniß gebeten auszugehen, aus demselben Grunde wie gewöhnlich, weil sie Kopfschmerzen habe und gern frische Luft schöpfen wolle. Auf ein Zeichen des Sergeanten sagte ich »ja.« »Wo pflegen die Dienstboten hinaus zu gehen?« fragte er, als der Bote wieder fort war. Ich zeigte es ihm. »Schließen Sie Ihr Zimmer ab und sagen Sie, wenn Jemand nach mir fragt, ich sei hier und gehe mit mir zu Rath.«
Er zuckte wieder mit den Mundwinkeln und verschwand.
Als ich mich so allein fand, trieb mich eine verzehrende Neugierde, zu versuchen, ob ich nicht für mich allein etwas entdecken könne. Es war klar, daß Cuff’s Verdacht gegen Rosanna durch etwas, was er beim Verhör der Dienstboten entdeckt hatte, bestärkt worden war. Nun waren die einzigen beiden Dienstboten, welche außer Rosanna etwas längere Zeit verhört worden waren, Mylady’s Kammermädchen und das erste Hausmädchen, also dieselben, welche bei den Redereien gegen Rosanna die Andern immer angeführt hatten. Nachdem ich mir dies überlegt hatte, suchte ich mich wie zufällig im Domestikenzimmer an die Beiden zu machen und setzte mich zu ihnen an den Theetisch. Denn wohlgemerkt, ein Schluck Thee ist für eine weibliche Zunge so viel wie ein Tropfen Oel für eine ausgehende Lampe. Mein Vertrauen auf den Theetopf als einen Verbündeten ward nicht getäuscht. In weniger als einer halben Stunde wußte ich so viel wie der Sergeant selber. Weder das Kammermädchen noch das Hausmädchen hatten, wie es schien, an Rosanna’s Unwohlsein geglaubt. Diese beiden Teufel (ich bitte den Leser um Verzeihung, aber wie soll man boshafte Frauenzimmer anders nennen) hatten sich am Donnerstag zu wiederholten Malen hinaufgeschlichen Rosanna’s Thür verschlossen gefunden, hatten geklopft und keine Antwort bekommen, hatten gehorcht und nicht das leiseste Geräusch gehört. Als das Mädchen dann zum Thee heruntergekommen und, anscheinend noch leidend, wieder hinaufgeschickt worden war, hatten die besagten beiden Teufel die Thür abermals untersucht und wieder verschlossen gefunden, hatten durch’s Schlüsselloch sehen wollen und es verstopft gefunden, hatten um Mitternacht durch die Thürspalten einen Lichtschein wahrgenommen und hatten um vier Uhr Morgens das Geprassel eines Kaminfeuers vernommen – Kaminfeuer im Zimmer eines Dienstmädchens im Juni! Alles das hatten sie vor dem Sergeanten Cuff ausgesagt, der aber zum Lohn für ihre Beflissenheit, ihn aufzuklären, sie mit einem sauern und argwöhnischen Blick entlassen und ihnen deutlich gezeigt hatte, daß er Keiner glaube. Daher die ungünstigen Berichte über ihn, welche diese beiden Mädchen nach dem Verhör erstattet hatten, daher auch, abgesehen von der Wirkung des Theetopfes ihre Bereitwilligkeit, ihren Zungen über das unfreundliche Benehmen des Sergeanten freien Lauf zu lassen. Da ich schon etwas von der feinen Art und Weise des großen Cuff kennen gelernt und ihn darauf bedacht gesehen hatte, Rosanna unbemerkt zu folgen, schien es mir klar, daß er es nicht für gerathen gehalten habe, Mylady’s Kammermädchen und dem Hausmädchen merken zu lassen, einen wie wesentlichen Dienst sie ihm geleistet hatten. Sie waren gerade die Art von Mädchen, die, wenn er ihre Aussage als glaubwürdig behandelt hätte, übermüthig geworden und im Stande gewesen wären, etwas zu thun oder zu sagen, was Rosanna veranlaßt hätte, auf ihrer Hut zu sein.
Ich ging in den schönen Sommerabend hinaus, wegen des armen Mädchens sehr besorgt, und über die Wendung der Dinge im Allgemeinen sehr ungehalten. Am Gebüsch traf ich Herrn Franklin auf seinem Lieblingsspaziergang. Er war schon eine Zeitlang von der Station zurück und hatte eine längere Unterredung mit Mylady gehabt. Sie hatte ihm die unbegreifliche Weigerung Fräulein Rachel’s, ihre Garderobe untersuchen zu lassen, mitgetheilt, und hatte ihn dadurch in eine so verdrießliche Stimmung versetzt, daß er durchaus nicht geneigt schien, sich über die Angelegenheit zu unterhalten. Zum ersten Male, so lange ich ihn kannte, sah ich ihn diesen Abend mit dem Ausdruck des Familien-Temperaments auf seinem Gesicht.
»Nun, Betteredge, wie behagt denn Ihnen die Atmosphäre von Geheimniß und Verdacht, in der wir jetzt leben? Erinnern Sie sich des Morgens, an dem ich hier zum ersten Mal mit dem Mondstein erschien? Wollte Gott, wir hätten ihn damals in den Zittersand versenkt.«
Nach diesem Ausbruch schwieg er, bis er sich wieder gefaßt hatte. Wir gingen ein paar Minuten schweigend neben einander her, bis er mich fragte, was aus Sergeant Cuff geworden sei. Es war unmöglich ihn mit der Ausflucht, daß der Sergeant in meinem Zimmer mit sich zu Rathe gehe, abzuspeisen, und ich berichtete ihm, was vorgefallen war, namentlich auch, was Myladys Kammermädchen und das Hausmädchen über Rosanna ausgesagt hatten. Herrn Franklins klarer Kopf ersah die Fährte, auf welcher sich Cuffs Verdacht befand, im Nu.
»Sagten Sie mir nicht diesen Morgen, daß der Bäckerjunge gestern auf dem Fußwege nach Frizinghall Rosanna begegnet sei, während wir sie unwohl auf ihrem Zimmer glaubten?«