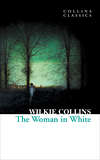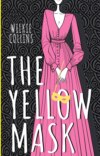Loe raamatut: «Der Mondstein», lehekülg 2
Drittes Capitel
Auf zwei Weisen habe ich versucht, über die Art, wie ich die Geschichte gut anfangen soll, in’s Reine zu kommen; erstens indem ich mir den Kopf zerkratzt habe, was zu nichts führte, zweitens indem ich meine Tochter Penelope zu Rathe, zog, die mich auf eine ganz neue Idee gebracht hat. Penelope ist der Meinung, ich müsse die Begebenheiten von jedem Tage niederschreiben, und da anfangen, wo wir erfahren, daß Herr Franklin Blake zu einem Besuche bei uns erwartet werde, Wenn man einmal auf diese Art sein Gedächtniß auf einen bestimmten Tag fixiert hat, ist es wunderbar, wie das Gedächtniß wenn es einmal einen solchen Anstoß bekommen hat, Einem zu Hilfe kommt. Die einzige Schwierigkeit besteht darin, erst einmal die Daten festzustellen. Das will aber Penelope für mich übernehmen, aus ihrem eigenen Tagebuche zu thun, welches sie schon in der Schule zu führen angehalten wurde und das sie seitdem immer fortgeführt hat. Auf einen daraufhin von mir gemachten Vorschlag, nämlich daß sie statt meiner die Geschichte nach ihrem Tagbuche erzählen sollte, entgegnete Penelope mit einem zornigen Blick und erröthend, daß ihr Tagebuch nur für sie allein sei und daß kein lebendes Wesen außer ihr selbst jemals erfahren solle, was darin steht. Als ich sie fragte, was das zu bedeuten habe, sagte Penelopen »Dummes Zeug!« und ich sagte: »Liebesgeschichten!«
Um, nun also nach Penelopes Plan anzufangen, habe ich zu sagen, daß ich am Mittwoch den 24. Mai 1848 zu Mylady in ihr Wohnzimmer beschieden wurde.
»Gabriel,« sagte Mylady zu mir, »da sind Nachrichten, die Sie überraschen werden. Franklin Blake ist wieder da. Er ist eben eine Zeit lang bei seinem Vater in London gewesen und kommt morgen zu uns, um bis nächsten Monat bei uns zu bleiben und Rachel’s Geburtstag mit zu feiern.«
Wenn ich einen Hut in der Hand gehabt hätte, so hätte mich nur der Respect vor meiner Herrin abhalten können, den Hut vor Freuden an die Decke zu werfen. Ich hatte Herrn Franklin nicht gesehen, seit er als Kind in unserm Hause gelebt hatte. Er war in meiner Erinnerung der herzigste Junge, der je einen Kreisel gedreht oder ein Fenster zerbrochen hat. Fräulein Rachel, die anwesend war und gegen die ich das bemerkte, erwiderte, daß er nach ihrer Erinnerung der abscheulichste Tyrann gewesen sei, der jemals eine Puppe gequält habe, und der grausamste Treiber eines erschöpften kleinen Mädchens beim Pferdspielen, den man in England finden könne. »Ich zittere vor Entrüstung und keuche vor Ermattung, wenn ich an Franklin Blake denke,« waren Rachel’s letzte Worte.
Man wird fragen, wie es kam, daß Herr Franklin die ganze Zeit von seiner ersten Jugend bis zu seinen Mannesjahren im Auslande zubrachte. Meine Antwort ist: Weil sein Vater das Unglück hatte, der nächste Erbe eines Herzogthums zu sein, ohne es beweisen zu können.
Die Sache war kurz folgende:
Mylady’s älteste Schwester heirathete den berühmten Herrn Blake, der eben so bekannt durch seinen Reichthum wie durch seinen großen Proceß war. Wie viele Jahre er die Gerichte des Landes in Anspruch nahm, um den Herzog außer Besitz und sich selbst an seine Stelle zu setzen, wie vieler Advokaten Taschen er bis zum Platzen füllte, wie viele sonst friedliche Leute er zum Streit über die Frage brachte, ob er Recht oder Unrecht habe, das Alles genau zu erzählen, würde über meine Kräfte gehen. Seine Frau und zwei von seinen drei Kindern starben, bevor die Gerichte sich entschlossen, ihn abzuweisen und ihm kein Geld mehr abzunehmen. Als Alles vorbei und der Herzog in seinem Besitz gesichert war, fand Herr Blake, daß die einzige Art, mit seinem Vaterland für die Behandlung, die es ihm habe angedeihen lassen, quitt zu werden, die sei, seinem Lande nicht die Ehre der Erziehung seines Sohnes zu Theil werden zu lassen. »Wie kann ich den Institutionen meines Landes Vertrauen schenken,« war sein Ausspruch, »nachdem ich durch diese Institutionen so schlecht behandelt worden bin.« Wenn man hinzu nimmt, daß Herr Blake alle Knaben, seinen eigenen mit einbegriffen, haßte, so wird man begreifen, daß die Sache nur aus eine Art enden konnte. Der kleine Franklin wurde aus England entfernt und nach dem herrlichen Deutschland geschickt, um Institutionen übergeben zu werden, denen sein Vater, wie er sich ausdrückte, vertrauen könne. Herr Blake selbst blieb, wohlgemerkt, ruhig in England, um für die Besserung seiner Landsleute im Parlament zu wirken und eine Darlegung seiner Proceß Angelegenheit auszuarbeiten, welche noch heute nicht vollendet ist.
Da, Gottlob, das wäre gethan. Mit dem alten Blake brauchen wir uns nun nicht weiter zu befassen. Ueberlassen wir ihn seinem Herzogthum und kommen wir endlich zu dem Diamanten.
Der Diamant bringt uns wieder zu Herrn Franklin zurück, der die unschuldige Ursache davon war, daß dieser verwünschte Edelstein in unser Haus kam.
Unser lieber Junge vergaß uns nicht im Auslande. Er schrieb uns ab und zu, bisweilen an Mylady, bisweilen an Fräulein Rachel, bisweilen an mich. Wir hatten vor seiner Abreise ein Geschäft mit einander gemacht, welches darin bestand, daß er sich von mir ein Knäuel Bindfaden, ein Messer mit vier Klingen und sieben Shilling sechs Pence lieh, die ich bis jetzt noch nicht wieder gesehen habe und wohl auch nicht wieder zu sehen bekommen werde. Seine Briefe an mich hatten hauptsächlich fernere Darlehen zum Gegenstande. Wie es ihm im Auslande ging, wie er an Jahren und Größe zunahm, erfuhr ich immer von Mylady. Nachdem er Alles gelernt hatte, was die deutschen Institutionen ihn lehren konnten, machte er den Franzosen und dann den Italienern einen Besuch. Da machten sie ihn, so weit ich es beurtheilen kann, zu einer Art von Universalgenie. Er schriftstellerte ein wenig, er malte ein wenig, er sang, spielte und componirte ein wenig, immer glaube ich auf anderer Leute Kosten. Das Vermögen seiner Mutter, 700 Lftr. Jährlich, fiel ihm zu, als er mündig wurde, und lief ihm durch die Finger wie durch ein Sieb. Je mehr Geld er hatte, desto mehr brauchte er, in seiner Tasche war ein Loch, das keine Kunst zunähen konnte. Wohin er kam, war er wegen seines lebhaften, liebenswürdigen Wesens beliebt. Er reiste herum und lebte bald hier, bald dort, und seine Adresse, wie er sie selbst aufzugeben pflegte, war: »Europa poste restante.« Zweimal hatte er die Absicht gehabt, zu uns zum Besuche zu kommen, und beide Male stand, mit Respect zu melden, eine unnennbare Dame im Wege und hielt ihn zurück. Sein dritter Versuch endlich gelang, wie man schon aus der Mittheilung Mylady’s gesehen hat. Am Dienstag den 25. Mai sollten wir zum ersten Mal sehen, was für ein Mann unser Herzensjunge geworden sei. Er war von guter Race, er hatte einen hohen Sinn und war nach unserer Rechnung fünfundzwanzig Jahre alt. Jetzt weiß der Leser gerade so viel von Herrn Franklin Blake, als ich von ihm wußte, bevor er wieder in unser Haus kam.
Jener Dienstag war der herrlichste Sommertag, den man sich denken kann, und Mylady und Fräulein Rachel, die Herrn Franklin nicht vor Tisch erwarteten, waren zum Frühstück zu einigen Freunden in der Nachbarschaft gefahren.
Als sie fort waren, ging ich in das für unsern Gast hergerichtete Fremdenzimmer und sah, ob Alles in Ordnung sei. Da ich um jene Zeit nicht nur Mylady’s Haushofmeister, sondern auf meinen besonderen Wunsch auch ihr Kellermeister geworden war, weil es mich verdroß, die Schlüssel zu des verstorbenen Sir John’s Keller in andern Händen zu sehen, ging ich dann in den Keller und holte ein Paar Flaschen von unserm famosen Latour herauf und stellte sie in die warme Sonne, damit sie bei Tisch die rechte Temperatur hätten.
Ich beschloß, mich selbst auch in die warme Sonne´zu setzen, weil ich wußte, daß, was für alten Rothwein gut sei, auch alten Menschen gut thue, und nahm meinen Gartenstuhl, um damit in den Hintergarten zu gehen, als ich durch einen trommelähnlichen Klang, der von der Vorderseite des Hauses her an mein Ohr drang, zurückgehalten wurde. Ich ging nach vorn und sah drei mahagonifarbene Indier in weißen leinenen Kitteln und Beinkleidern, die sich das Haus ansahen. Als ich genauer zusah, fand ich, daß die Indier kleine Handtrommeln um den Hals hängen hatten. Hinter ihnen stand ein kleiner schmächtiger, blondhaariger englischer Junge, der einen Handsack trug. Ich hielt die Kerle für umherziehende Jongleurs und den Jungen für den Träger ihrer Geräthschaften. Einer von den Dreien, der Englisch sprach und, wie ich bekennen muß, sehr feine Manieren hatte, bewies mir durch seine Mittheilungen sofort, daß meine Vermuthung richtig sei. Er bat um die Erlaubniß, vor der Herrin des Hauses seine Kunststücke machen zu dürfen. Ich bin kein Griesgram, ich amüsire mich gern und bin der Letzte, der einem Menschen mißtraut, weil er ein bischen dunklere Haut hat, als ich. Aber Jeder hat seine Schwäche und meine Schwäche besteht darin, daß ich, wenn ich weiß, daß Silbergeräth in der Geschirrkammer offen dasteht, augenblicklich, sobald ich eines umherziehenden Fremden mit besonders feinen Manieren ansichtig werde, an dieses Geschirr denken muß, und ich complimentirte ihn und seine Gesellschaft vom Hause weg. Ich meinerseits kehrte zu meinem Gartenstuhl zurück und verfiel, um die Wahrheit zu gestehen, wenn auch nicht gerade in einen festen Schlaf, doch in einen dem Schlaf ähnlichen Zustand.
Auf einmal wurde ich durch meine Tochter Penelope aufgeschreckt, die angelaufen kam, als ob das Haus in Flammen stände. Und warum? Sie verlangte die sofortige Festnahme der drei indischen Jongleurs und zwar deshalb, weil sie wüßten, wen wir aus London zum Besuch erwarteten, und weil sie gewiß gegen Herrn Franklin Blake etwas Böses im Schilde führten.
Der Name Franklin ermunterte mich. Ich machte die Augen weit auf und bat meine Tochter, sich zu erklären. Es ergab sich, daß Penelope direct aus des Pförtners Wohnung komme, wo sie mit der Tochter des Pförtners geplaudert hatte. Die beiden Mädchen hatten die drei Indier in Begleitung des Jungen aus der Pforte gehen sehen, nachdem ich sie wegcomplimentirt hatte. Die Mädchen kamen auf den Einfall, daß der Junge von den Fremden schlecht behandelt werde, so weit ich einsehen konnte, aus keinem andern Grunde, als weil der Junge hübsch und zart aussah, – und hatten sich an der inneren Seite der Hecke, welche das Gut von der Landstraße trennt, entlang geschlichen und die Fremden durch die Hecke hindurch beobachtet.
Sie sahen da, daß die Kerle sich erst nach allen Seiten umsahen, um sich zu vergewissern, daß sie allein seien, dann drehten sie sich alle Drei um und blickten scharf nach der Richtung des Hauses hin. Dann kauderwelschten sie, stritten sich in ihrer Sprache und sahen sich einander an wie Leute, die ihrer Sache nicht recht sicher sind. Dann wandten sie sich an den kleinen englischen Jungen, als ob sie von ihm Auskunft erwarteten. Endlich sagte der Anführer auf Englisch zu dem Jungen: »Halt’ Deine Hand auf.« Bei diesen Worten, versicherte meine Tochter Penelope, sei es ihr gewesen, als müsse ihr das Herz im Leibe zerspringen. Ich dachte bei mir, daß ihr Corset wohl Schuld daran gewesen sein möge.
Ich sagte aber nur: »Mich schauder’s bei der Geschichte.«
NB. Frauen lieben solche Aeußerungen
Weiter: Der Junge trat zurück, schüttelte mit dem Kopfe, er habe keine Lust die Hand hinzuhalten Der Indier fragte ihn darauf gar nicht unfreundlich, ob er lieber nach London zurückgeschickt und wieder dahin gebracht werden wolle, wo sie ihn in einem offenen Korbe unter freiem Himmel schlafend, als ein hungriges, verlassenes Kind gefunden hätten. Damit, scheint es, war die Schwierigkeit beseitigt. Der kleine Bursche hielt seine Hand widerwillig hin, worauf der Indier aus seiner Brusttasche eine Flasche zog und aus derselben etwas von einer schwarzen Flüssigkeit wie Tinte in die hohle Hand des Kindes goß. Der Indier berührte dabei den Kopf des Jungen, machte Zeichen in der Luft und sagte dann: »Sieh her.« Der Junge stand starr da wie ein Marmorbild und sah auf die Tinte in seiner Hand.
So weit schien mir die Sache nur wie ein Jongleurkunststück mit einer albernen Vergeudung von Tinte, und ich fing an, wieder schläfrig zu werden, als Penelopes fernere Worte mich abermals aufrüttelten.
Die Indier sahen sich nochmals nach allen Seiten um und darauf sprach der Anführer zu dem Jungen die Worte: »Sieh den englischen Herrn, der aus dem Auslande kommt.«
Der Junge sagte: »Ich sehe ihn.«
Der Indier fragte: »Kommt der Fremde heute auf dieser Straße und auf keiner anderen nach diesem Hauses?«
Der Knabe antwortete: »Der Fremde kommt heute auf dieser Straße und auf keiner anderen nach diesem Hause.«
Nach einer kleinen Pause that der Indier eine zweite Frage.
Er fragte: »Hat der englische Herr ihn bei sich?«
Der Knabe antwortete gleichfalls nach einer kleinen Pause: »Ja.«
Die dritte und letzte Frage des Indiers war: »Wird der Fremde, wie er es versprochen hat, gegen Abend hierherkommen?«
Der Junge antwortete: »Das kann ich nicht sagen.«
Der Indier fragte: »Warum?«
Der Junge entgegnete: »Ich bin erschöpft, es wird trübe und wirr in meinem Kopf. Ich kann heute nichts mehr sehen.«
Damit war das Catechisiren zu Ende. Der Anführer sagte etwas auf indisch zu den beiden Andern, indem er bald auf den Knaben, bald nach der Stadt hin wies, wo sie, wie wir nachher erfuhren, Wohnung genommen hatten. Darauf machte er wieder Zeichen über dem Kopf des Kindes, hauchte seine Stirn an und brachte ihn so plötzlich wieder zu sich. Worauf sie sich Alle nach der Stadt zu auf den Weg machten und von dem Mädchen nicht weiter gesehen wurden.
Die meisten Dinge, sagt man, tragen eine Moral in sich, wenn man nur genau zusteht. Was war die Moral von dieser Geschichte?
Die Moral war nach meiner Meinung: erstens, daß der Anführer der Gauklerbande die Dienstboten vor dem Hause von der Ankunft des Herrn Franklin hatte reden hören und das für eine gute Gelegenheit hielt, ein bischen Geld zu machen. Zweitens, das er mit seinen Kameraden und dem Jungen zu obigem Zweck, bis sie Mylady nach Hause kommen sähen, um das Haus herumlungern und ihr dann Herrn Franklins Ankunft prophezeihen wollten. Drittens: daß Penelope einer Probe ihres Hokus Pokus, die sie wie Schauspieler vorher machten, beigewohnt habe. Viertens: daß ich gut thun werde, diesen Abend ein Auge auf das Silbergeschirr zu haben, und fünftens, daß Penelope gut thun werde, sich abzukühlen und ihren Vater in seinem Schläfchen in der lieben Sonne nicht weiter zu stören.
Das schien mir eine verständige Auffassung der Sache, wer aber die Art und Weise junger Mädchen kennt, wird es nicht überraschend finden, daß Penelope für diese Auffassung nicht zugänglich war. Nach ihrer Meinung war die Moral der Sache eine viel ernstere. Die Ernsthaftigkeit meiner Tochter machte mich Verdrießlich.
»Wozu in aller Welt braucht Herr Franklin von diesen Possen etwas zu wissen?« fragte ich sie.
»Frag’ ihn selbst,« erwiderte Penelope »und sieh zu, ob er es auch für Possen hält.«
Mit diesem Trumpf verließ meine Tochter mich. Als sie fort war, überlegte ich mir die Sache und kam zu dem Entschluß, Herrn Franklin die Sache wirklich mitzutheilen, hauptsächlich um Penelope zu beruhigen. Was zwischen ihm und mir darüber verhandelt wurde, als ich noch an demselben Tage spät ihm davon sprach, wird seiner Zeit ausführlich mitgetheilt werden. Da ich aber den Leser nicht zu spannen und später zu enttäuschen wünsche, so erlaube ich mir, bevor ich in meinem Bericht fortfahre, schon hier zu bemerken, daß man in unserer Unterhaltung über die Jongleurs nicht die Spur eines Scherzes finden wird.
Zu meiner größten Ueberraschung nahm Herr Franklin, wie vordem Penelope, die Sache ernsthaft. Wie ernsthaft wird man ermessen, wenn ich erzähle, daß nach seiner Ansicht mit jenem geheimnisvollen »ihn« des Indiers der Mondstein gemeint gewesen sei.
Viertes Capitel
Es thut mir wirklich leid, den Leser bei mir und meinem Gartenstuhl aufhalten zu müssen. Ein alter Mann, der sein Schläfchen im Sonnenschein macht, ist kein interessanter Gegenstand, das weiß ich sehr gut; aber die Dinge müssen nun einmal niedergeschrieben werden, wie sie sich wirklich begeben haben und so muß ich den Leser bitten, sich’s noch eine Weile bei mir gefallen zu lassen, bis wir zu der später am Tage erfolgenden Ankunft des Herrn Franklin Blake gelangen.«
Ehe ich noch Zeit gehabt, wieder einzuschlafen, nachdem meine Tochter Penelope mich wieder verlassen hatte, wurde ich durch ein Geklapper von Tellern und Schüsseln im Domestikenzimmer aufgerüttelt und das bedeutete, daß das Mittagessen fertig sei. Da ich meine Mahlzeiten in meinem eignen Wohnzimmer zu nehmen gewohnt war, so ging mich das Mittagessen der Leute nichts an und ich legte mich wieder in meinen Stuhl zurück, nachdem ich ihnen Allen guten Appetit gewünscht hatte. Eben hatte ich meine Beine wieder ausgestreckt, als ein anderes weibliches Wesen auf mich losstürzte, diesmal nicht meine Tochter, sondern nur das Küchenmädchen Nancy. Ich war ihr mit meinem Stuhl gerade im Wege, und als sie mich bat, ich möge sie vorbeilassen, fand ich daß sie mürrisch aussah, was ich nun einmal als Vorgesetzter der Domestiken aus Princip niemals ohne nachzuforschen vorübergehen lasse.
»Na,« frage ich, »warum läufst denn Du vom Mittagessen fort? Was ist Dir widerfahren, Nancy?«
Sie versuchte mir ohne Antwort zu entwischen, was ich verhinderte, indem ich aufstand und sie beim Ohr ergriff. Sie ist ein hübsches rundes Ding und das Zupfen am Ohr ist meine Gewohnheit, wenn ich den Mädchen mein Gefallen an ihnen bezeigen will.
»Was ist Dir widerfahren?« fragte ich noch einmal.
»Rosanna ist wieder nicht da zum Mittagessen,« antwortete sie, »und ich soll sie holen. Alle schwere Arbeit im Hause fällt mir zu. Lassen Sie mich in Ruhe, Herr Betteredge!«
Die genannte Rosanna war unser zweites Hausmädchen. Da ich für dieses zweite Hausmädchen eine gewisse Sympathie empfand (warum, wird man gleich erfahren), und da ich aus Nancy’s Mienen die Besorgniß schöpfte, daß sie ihre Collegin mit härteren Worten, als gerade nothwendig, herbeiholen werde, fiel mir ein, daß ich nichts Besonderes zu thun habe und daß ich ja Rosanna selbst holen und sie dabei ermahnen könnte, in Zukunft pünktlich zu sein, was sie, wie ich gewiß wußte, gut aufnehmen würde.
»Wo ist denn Rosanna?« fragte ich.
»Natürlich am Strande« antwortete Nancy mit zurückgeworfenem Kopfe. »Sie ist heute Morgen wieder einmal in Ohnmacht gefallen und hat um die Erlaubniß gebeten, ein bischen frische Luft schöpfen zu dürfen. Ich habe keine Geduld mehr mit ihr.«
»Geh Du nur zu Tisch, mein Kind Ich habe Geduld mit ihr, ich will sie selbst holen.«
Nancy, die sich eines guten Appetits erfreute, lächelte beifällig; wenn sie beifällig lächelt, sieht sie sehr gut aus, und wenn sie gut aussieht, fasse ich sie unter’s Kinn, nicht aus Unsittlichkeit, sondern aus Gewohnheit.
Ich nahm also meinen Stock und machte mich auf den Weg nachdem Strande.
Aber nein! wir kommen immer noch nicht weiter, ich muß leider abermals innehalten; aber ich muß hier wahrhaftig erst die Geschichte des Strandes und die Geschichte Rosanna’s erzählen – denn beide stehen mit der Diamantenangelegenheit in naher Beziehung. Ich gebe mir die redlichste Mühe, meinen Bericht ohne Weitschweifigkeit abzufassen, und doch gelingt es mir so schlecht. Aber die Sache ist, daß Personen und Dinge auf so wunderliche Weise in unser Leben eingreifen und uns so, zu sagen zwingen, von ihnen Notiz zu nehmen. Aber wir wollen die Sache leicht nehmen und kurz machen. Nur noch eine kleine Geduld und wir sind mitten in unserer geheimnißvollen Geschichte.
Rosanna, um die Person der Sache voranzustellen, was dem Gebot der einfachsten Höflichkeit gehorchen heißt, war die einzige neue Magd in unserm Hause. Ungefähr vier Monate vor der Zeit, über die ich berichte, war Mylady in London gewesen und hatte dort eine Besserungsanstalt besucht, die zu dem Zwecke errichtet war, um unglückliche Frauenzimmer, nachdem ihre Gefängnißstrafe abgesessen, vor dem Rückfall zu bewahren. Als die Hausmutter sah, daß die Anstalt Mylady interessire, machte sie sie auf ein Mädchen mit Namen Rosanna Spearman aufmerksam und erzählte ihr eine höchst klägliche Geschichte, die ich hier zu wiederholen nicht den Muth habe, denn ich mag weder mich noch meine Leser traurig stimmen. Das Kurze von der Sache war, daß Rosanna Spearman eine Diebin gewesen war, und da sie nicht zu denen gehörte, die in ganzen Gesellschaften Tausende anstatt eines Einzigen berauben, so verfiel sie dem Gesetz, und Gefängniß und Besserungshaus folgten dem Gesetz. Die Meinung der Hausmutter über Rosanna ging dahin, daß sie trotz ihres Vergehens ein seltenes Mädchen sei und nur einer Gelegenheit bedürfe, um sich des Interesses, das ihr eine christliche Dame bezeigen möchte, würdig zu zeigen. Mylady, die eine christliche Dame ist, wenn es je eine gegeben hat, sagte darauf der Hausmutter: »Ich will Rosanna Spearman eine solche Gelegenheit in meinem Dienste geben.«
Eine Woche darauf trat Rosanna Spearman als zweites Hausmädchen bei uns in Dienst. Kein Mensch erfuhr die Geschichte des Mädchens außer Fräulein Rachel und mir. Mylady, die mir die Ehre erzeigt, mich bei den meisten Dingen zu Rathe zu ziehen, fragte mich auch in Betreff Rosanna’s um meinen Rath. Da ich in letzter Zeit so ziemlich in die Gewohnheit des verstorbenen Sir John verfallen war, immer Mylady’s Meinung zu sein, stimmte ich ihr auch von ganzem Herzen in Betreff Rosanna Spearman’s bei.
Eine günstigere Gelegenheit, in ihrer Besserung zu beharren, war nie Mädchen geboten. Keiner unter den Domestiken konnte ihr ihr vergangenes Leben vorwerfen, denn Keiner wußte etwas davon. Sie bekam ihren Lohn und wurde gut behandelt wie die Andern, und von Zeit zu Zeit hatte Mylady ein freundliches Wort der Ermunterung für sie. Dafür zeigte sie sich aber auch dieser freundlichen Behandlung durchaus würdig. Obgleich sie gar nicht stark und den erwähnten Ohnmachten unterworfen war, that sie ihre Arbeit, ohne sich zu beklagen, bescheiden und gut. Aber doch wollten sich die andern dienenden Mädchen nicht recht mit ihr befreunden, ausgenommen meine Tochter Penelope, die immer freundlich, wenn auch nicht befreundet mit Rosanna war.
Ich weiß nicht recht, womit das Mädchen es eigentlich bei den Andern versah. Schön war sie nicht, so daß die Andern etwa hätten neidisch sein können, sie war das häßlichste Mädchen im Hause und noch dazu entstellt durch eine verwachsene Schulter. Was die Andern hauptsächlich gegen sie hatten, war, glaube ich, ihr stilles schweigsames Wesen. In ihren Mußestunden, wo die Andern schwatzten, beschäftigte sie sich mit Lesen oder Handarbeit. Und wenn die Reihe an sie kam, auszugehen, setzte sie in den meisten Fällen schweigend ihren Hut auf und ging ganz allein ihres Weges. Sie stritt sich nie und nahm nie etwas übel, sie hielt sich nur eben so höflich wie hartnäckig in einer gewissen Entfernung von allen Uebrigen. Dazu kam, daß trotz ihrer Häßlichkeit ein gewisses Etwas, weiß nicht, ob in ihrer Stimme oder in ihrem Gesicht, an ihr war, das mehr einer Dame als einem Hausmädchen anzugehören schien. Alles, was ich sagen kann, ist, daß die andern Mädchen von dem Augenblick ihres Eintritts an über dieses gewisse Etwas herfielen und höchst ungerechter Weise behaupteten, Rosanna Spearman gebe sich Airs.
Nachdem ich nun Rosanna’s Geschichte erzähIt habe, brauche ich nur noch über eine von den vielen Sonderbarkeiten dieses eigenthümlichen Mädchens zu berichten, bevor ich an meine Geschichte des Strandes komme.
Unser Haus liegt auf einer Anhöhe an der Küste von Yorkshire und ganz in der Nähe der See, wir haben schöne Spaziergänge nach allen Seiten hin mit Ausnahme einer einzigen, in dieser einen Richtung ist aber der Weg wahrhaft schrecklich. Er führt eine viertel Meile lang durch eine trübselige, kümmerliche Tannen-Anpflanzung, dann durch niedrige Klippen zu der einsamsten und häßlichsten Bucht an unserer Küste.
Die Dünen gehen hier bis ins Wasser hinein und laufen in zwei Felsenzungen aus, die sich einander gegenüberliegend, so weit ins Meer hinein erstrecken, daß man ihr Ende nicht zu verfolgen im Stande ist. Die eine heißt die Nordspitze und die andere die Südspitze. Zwischen beiden liegt der gefährlichste Flugsand an unserer Küste, der sich zu gewissen Jahreszeiten vor- und rückwärts schiebt.
So oft die Fluth herannaht, begibt sich etwas in der Tiefe der Erde, was die ganze Fläche des Flugsands in ein höchst merkwürdiges Schwanken und Zittern versetzt und diese Eigenthümlichkeit hat der Fläche in unserer Gegend den Namen des »Zitterstrandes« verschafft. An einer großen Sandbank, die eine halbe Meile von der Küste vor der Mündung der Bucht liegt, brechen sich die aus der offenen See herankommenden Wellen. Winter und Sommer, wenn die Fluth über den Flugsand hinweggeht, scheint die See die Wellen hinter sich auf der Sandbank zu lassen und fließt, ruhig und gemächlich steigend, über den Strand hin. Es ist das in Wahrheit ein einsamer und schrecklich verlassener Ort. Kein Boot wagt sich je in diese Bucht. Kein Kind aus unserm Fischerdorf Cobb’s Hole kommt je zum Spielen hierher. Selbst die Vögel in der Luft umkreisen, wie mir scheint, den Zitterstrand, wenn ihr Flug sie in seine Nähe bringt, in weitem Bogen.
Daß ein junges Mädchen, wenn es die Auswahl unter einem Dutzend hübscher Spaziergänge hat und jederzeit Gesellschaft haben könnte, wenn sie nur sagen wollte: »Kommt mit,« einen solchen Platz, vorzieht und sich da ganz allein mit einem Buch oder einer Handarbeit hinsetzt, wenn sie Erlaubniß zum Ausgehen bekommt, das klingt doch gewiß unglaublich. Und doch ist es wahr, man mag darüber denken wie man will. Dies war Rosanna Spearman’s Lieblingsspaziergang den sie aufsuchte so oft sie ausging, ausgenommen die seltenen Fälle, wo sie nach Cobb’s Hole ging, um die einzige Freundin zu besuchen, die sie in unserer Nachbarschaft hatte und von der wir später noch mehr hören werden. Und nach diesem Zitterstrand machte ich mich jetzt auf den Weg, um das Mädchen zum Essen zu holen, und damit sind wir glücklich wieder bei unserm Ausgangspunkt angekommen und setzen nun unseren Weg nach dem Strande ungestört fort. In der Tannenpflanzung fand ich keine Spur des Mädchens. Als ich aber durch die Sandhügel an die Küste gelangte, stand sie da mit ihrem kleinen Strohhut und ihrem grauen Mantel, den sie immer trug, um ihre verwachsene Gestalt so viel wie möglich zu verbergen, da stand sie ganz allein, auf den Flugsand und das weite Meer blickend.
Sie schreckte auf, als ich vor sie hintrat, und wandte ihren Kopf von mir weg. Da das Michnichtansehen auch eine Manier ist, die ich als Vorgesetzter der Domestiken principiell nicht dulde, drehte ich ihr Gesicht mir wieder zu und sah, daß sie weinte. Mein seidenes Schnupftuch, eines von sechs Prachtstücken, die mir Mylady zum Geschenk gemacht hatte, steckte in meiner Tasche. Ich zog es heraus und sagte zu Rosanna »Komm mein Kind, setze Dich zu mir auf den Strand. Ich will erst Deine Thränen trocknen und mir dann die Frage erlauben, warum Du geweint hast.«
In meinem Alter ist das Niedersetzen am Strande ein viel schwereres Stück Arbeit, als junge Leute es sich träumen lassen. Bis ich mit mir in Ordnung war, hatte Rosanna ihre Augen schon selbst mit ihrem eigenen ganz ordinairen Batist-Schnupftuch getrocknet. Sie war ganz ruhig und sah sehr unglücklich aus; aber sie setzte sich zu mir. Wenn man ein Mädchen auf die einfachste Weise trösten will, muß man sie auf den Schoß nehmen. Ich befolgte diese goldene Regel. Aber o weh! Rosanna war nicht wie Nancy, das muß wahr sein.
»Nun erzähle mir, mein Kind,« sagte ich, »Warum weinst Du?«
»Ueber die vergangenen Jahre, Herr Betteredge,« antwortete Rosanna ruhig, »mein früheres Leben tritt mir noch bisweilen vor die Seele.«
»Komm, komm, mein Kind,« erwiderte ich. »Dein vergangenes Leben ist völlig ausgewischt: Warum vergißt Du es nicht?«
Sie ergriff einen meiner Rockschöße. Ich bin ein nachlässiger alter Mann und eine gute Portion von meinem Essen und Trinken bleibt aus meinen Kleidern sitzen, die bald von einem, bald von dem andern der Mädchen wieder gereinigt werden. Tags zuvor hatte Rosanna einen Fleck auf meinem Rockschoß mit einem ganz neuen und als vorzüglich gerühmten Fleckwasser ausgemacht. Das Fett war zwar fort, aber die Stelle, wo der Fleck gesessen hatte, war doch noch sichtbar. Das Mädchen zeigte auf die Stelle und schüttelte mit dem Kopfe.
»Der Fleck ist fort, Herr Betteredge,« sagte sie, »aber die Stelle bleibt sichtbar.«
Eine Bemerkung, die sich auf den eigenen Rock eines Mannes stützt, ist nicht leicht zu widerlegen. Ueberdies war in jenem Augenblick etwas in dem Wesen des Mädchens selbst, das meine besondere Theilnahme erweckte. Sie hatte hübsche braune Augen trotz ihrer sonstigen Häßlichkeit, und sie blickte auf mich mit einem Ausdrucke sehnsüchtiger Ehrfurcht vor meinem glücklichen Alter und meinem guten Ruf, Dinge, die für sie auf immer unerreichbar bleiben würden, und das machte mir das Herz schwer. Da ich mich außer Stande fühlte, sie zu trösten, so gab es nur Eines für mich in diesem Augenblick zu thun, und das war, sie zum Essen zu überreden.
»Hilf mir auf,« sagte ich, »denn das Essen wartet auf Dich, Rosanna, und ich bin gekommen, um Dich zu holen.«
»Sie, Herr Betteredge?« fragte sie.
»Sie wollten Nancy an Dich abschicken, aber ich dachte, Du würdest Deine Schelte lieber von mir hinnehmen.«
Statt mir aufzuhelfen, drückte mir das arme Ding verstohlen die Hand. Sie kämpfte stark gegen die wieder aufsteigenden Thränen, und mit Erfolg, was mir Achtung für sie einflößte.
»Sie sind sehr gütig, Herr Betteredge,« sagte sie, »aber ich brauche heute kein Mittagessen lassen Sie mich noch ein wenig hier bleiben.«
»Warum bist Du gern hier,« fragte ich, »was in aller Welt führt Dich immer wieder an diesen elenden Platz?«
»Es zieht mich etwas hierher,« erwiderte das Mädchen und zeichnete dabei mit ihren Fingern Figuren in den Sand. »Ich versuche es immer wieder, wegzubleiben, aber ich kann nicht. Zuweilen,« fuhr sie mit leiser Stimme fort, als ob der Gedanke sie selbst erschreckte, »zuweilen scheint es mir, Herr Betteredge, als ob mein Grab mich hier erwarte.«