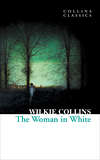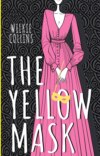Loe raamatut: «Der Mondstein», lehekülg 44
Achte Erzählung
von Gabriel – Betteredge
Ich bin, wie sich der Leser ohne Zweifel erinnern wird, derjenige, der den Anfang unserer Geschichte berichtet hat. Ich soll nun auch derjenige sein, der, als der letzte im Zuge, die Geschichte, so zu sagen, abschließt, aber glaube Niemand, daß ich etwa noch ein Schlußwort in Betreff des Diamanten zu sagen hätte. Ich verabscheue diesen unglücklichen Edelstein und ich verweise den Leser für weitere Nachrichten über den Mondstein, sofern solche im gegenwärtigen Augenblick erwartet werden können, auf andere Gewährsmänner. Mein Zweck bei diesen Zeilen ist, eine Thatsache in der Geschichte der Familie,zu berichten, welche alle Uebrigen mit Stillschweigen übergangen haben und welche ich nicht in dieser Weise geringschätzig bei Seite gesetzt lassen möchte. Die Thatsache welche ich meine, ist die Heirath Fräulein Rachel’s und Herrn Franklin Blake’s. Dieses bedeutsame Ereigniß fand am Dienstag, den 9. October 1849, in unserm Hause in Yorkshire statt. Ich erhielt einen neuen Anzug zu dieser festlichen Gelegenheit und das junge Paar reiste nach Schottland, um dort die Flitterwochen zu verleben.
Ich muß bekennen, daß ich nach dem Familienfeste dergleichen seit dem Tode unserer armen gnädigen Frau in unserem Hause so selten geworden waren, am Abend des Hochzeitstages auf die Gesundheit des jungen Paares einen Schluck zu viel trank.
Wenn Du, lieber Leser, Dir jemals etwas Aehnliches hast zu Schulden kommen lassen, so wirst Du meine Schwäche begreifen und nachsichtig beurtheilen Wenn nicht, so wirst Du wahrscheinlich sagen: »Der widerwärtige alte Mann! Warum erzählt er uns das?« Ich habe aber meine Gründe.
Als ich also meinen Schluck zu viel genommen hatte, – sei nur ruhig! Du hast auch Deine Schwäche, wenn es auch eine andere ist – nahm ich meine Zuflucht zu dem einzigen unfehlbaren Radikalmittel als das Ihr schon den Robinson Crusoe kennt. Wo ich das unvergleichliche Buch aufschlug, weiß ich nicht mehr, wohl aber weiß ich noch sehr gut, wo die gedruckten Zeilen zuletzt in einander zu laufen anfingen. Es war auf Seite 318, eine kleine Stelle über Robinson Crusoe’s Heirath, wie folgt:
»Ich überdachte daß ich ein Weib hatte« – wohlgemerkt, das hatte Herr Franklin auch! – »daß mir mein Weib ein Kind geschenkt hatte« – abermals wohlgemerkt das konnte bei Herrn Franklin auch noch zutreffen! – »und daß meine Frau dann« – Was Robinson Crusoes Frau »dann« gethan oder nicht gethan hatte, verlangte ich nicht weiter zu wissen. Ich strich die Worte in Betreff des Kindes mit meinem Bleistift an und legte ein Stück Papier als Zeichen zwischen die Blätter: »Lieg Du da,« sagte ich, »bis die Heirath zwischen Herrn Franklin und Fräulein Rache! ein paar Monat älter ist, dann wollen wir uns wieder sprechen.«
Die Monate vergingen, und zwar deren mehr als ich mir gedacht hatte, ohne daß sich eine Veranlassung geboten hätte, das Zeichen im Buch aus seiner Ruhe zu stören. Erst in diesem Monat November 1850 trat Herr Franklin in bester Laune in mein Zimmer und sagte: »Betteredge! Ich habe eine Neuigkeit für Sie! Es wird nicht mehr sehr lange dauern, bis sich im Hause etwas ereignet.«
»Betrifft es die Familie, Herr?« fragte ich.
»Gewiß thut es das,« antwortete Herr Franklin
»Hat Ihre liebe Frau irgend etwas damit zu thun, wenn ich fragen darf?«
»Sehr viel,« sagte Herr Franklin, der anfing, etwas überrascht auszusehen.«
»Sie brauchen kein Wort weiter zu sagen, Herr,« antwortete ich. »Gott segne Sie beide! Ich freue mich herzlich über die Nachricht!«
Herr Blake starrte mich an, als ob er vom Blitz gerührt wäre »Darf ich fragen, woher Sie Ihre Nachrichten haben? fragte er. »Ich bin erst vor fünf Minuten unter dem Siegel der strengsten Verschwiegenheit in das Geheimniß eingeweiht worden.«
Das war eine Gelegenheit, Robinson Crusoe herbeizuholen! Das war eine erwünschte Veranlassung, die kleine Stelle über das Kind, welche ich an Herrn Franklin’s Hochzeitstag angestrichen hatte, vorzulesen! Ich las die merkwürdigen Worte mit der« gebührenden Emphase vor und sah ihm dann scharf ins Gesicht» »Nun Herr, glauben Sie jetzt an Robinson Crusoe?« fragte ich mit der der Gelegenheit angemessenen Feierlichkeit.
»Betteredge!« antwortete Herr Franklin mit gleicher «Feierlichkeit, »jetzt glaube ich.« Wir reichten uns die Hände und ich fühlte, daß ich ihn bekehrt hatte.
Nachdem ich diese außerordentliche Begebenheit berichtet habe, trete ich zum zweiten Mal vom Schauplatz dieser Blätter ab. Lache Niemand über die merkwürdige hier erzählte Anekdote Ueber alles andere was ich geschrieben habe, könnt Ihr Euch so viel Ihr wollt lustig machen, aber wenn ich über Robinson Crusoe schreibe, so ist es mir, bei Gott! Ernst, und ich verlange, daß Ihr es auch mit Ernst aufnehmt. Nun bin ich fertig. Meine Damen und Herren, ich empfehle mich Ihnen und schließe die Geschichte ab.
Epilog
Die Auffindung des Diamanten
I
Aussage eines Gehilfen Sergrant Cuff’s
(1849.)
Am 27. Juni vorigen Jahres erhielt ich von Sergeant Cuff den Auftrag, drei Männer zu verfolgen, die des Mordes verdächtig und mir als Indier bezeichnet waren. Am Morgen dieses Tages hatte man sie sich auf der Tower-Werfte am Bord des nach Rotterdam gehenden Dampfschiffes einschiffen gesehen.
Ich verließ London mit einem einer anderen Gesellschaft gehörenden Dampfer, welcher am Donnerstag den 28. Morgens abging.
Bei meiner Ankunft in Rotterdam suchte ich den Capitain des am Mittwoch abgegangenen Dampfschiffes auf. Er theilte mir mit, daß die Indier allerdings als Passagiere auf seinem Schiffe gefahren seien, aber nur bis Gravesend. Hier hatte einer der Drei sich erkundigt, wann sie in Calais ankommen würden. Auf die Mittheilung, daß das Dampfschiffs nach Rotterdam gehe, drückte der Sprecher der Drei die größte Ueberraschung und Bestürzung über das Versehen aus, welches ihm und seinen Freunden begegnet sei. Sie seien, erklärte er, alle bereit, ihre Passage im Stich zu lassen, wenn der Capitain sie nur ans Land setzen wolle. Der Capitain, dem die Fremden leid thaten, und der keinen Grund hatte, sie zurückzuhalten, signalisirte ein Boot von der Küste herbei und ließ die drei Leute das Schiff verlassen.
Da dieses Verfahren der Indier ersichtlich im Voraus unter ihnen verabredet war, um ihre Verfolger irre zu leiten, kehrte ich aus der Stelle nach England zurück. Ich verließ das Dampfboot bei Gravesend und erfuhr, daß die Indier von hier nach London abgegangen seien. Von dort konnte ich ihre Spur wieder bis Plymouth verfolgen. Hier erfuhr ich, daß sie vor 48 Stunden auf dem Ostindienfahrer Bewley-Castle direct nach Bombay abgegangen seien.
Aus diese Nachricht hin veranlaßte Sergeant Cuff, daß die Behörden in Bombay mit der Ueberlandpost von der Sachlage in Kenntniß und in den Stand gesetzt wurden, das Schiff unmittelbar nach seinem Einlaufen in den Hafen von Polizeimannschaft betreten zu lassen. Nachdem das geschehen, war meine Thätigkeit bei der Sache zu Ende. Seitdem habe ich nichts wieder darüber gehört.
II
Aussage des Capitains
(1849.)
Ich bin von Sergeant Cuff ersucht worden, gewisse Thatsachen in Betreff dreier Leute zu Papier zu bringen welche Indier sein sollen und welche im vorigen Sommer als Passagiere auf dem unter meinem Commando stehenden, direct nach Bombay gehenden Schiff »Bewley-Castle« fuhren.
Die Indier trafen uns in Plymouth. Während der Fahrt hörte ich keine Klage über ihr Betragen. Sie hatten ihre Schlafstellen in dem Vordertheil des Schiffs. Ich selbst hatte nur wenig Gelegenheit, von ihnen Notiz zu nehmen.
Gegen Ende der Reise hatten wir das Mißgeschick, in Sicht der indischen Küste drei Tage und drei Nächte lang von einer Windstille befallen zu werden. Ich habe mein Schiffs-Journal nicht bei der Hand und kann mich des Längen- und Breitengrades der Stelle, an der wir still liegen mußten, nicht mehr entsinnen. In Betreff derselben kann ich daher nur ganz im Allgemeinen angeben, daß die Strömung uns dem Lande zutrieb, und daß wir, als der Wind wieder einsetzte, unsern Hafen in 24Stunden erreichten.
Die Disciplin auf einem Schiffe läßt, wie jedem Seefahrenden bekannt ist, bei einer langen Windstille nach. So war es auch aus meinem Schiff. Aus den Wunsch einiger Herren unter den Passagieren wurden verschiedene kleinere Boote herabgelassen. Die Herren unterhielten sich damit, umherzurudern und in der Abendkühle zu baden. Die Boote hätten nach geschehener Benutzung wieder an ihre gewöhnlichen Plätze aufgefunden werden sollen. Statt dessen blieben sie neben dem Schiff an dasselbe befestigt liegen. Bei der herrschenden Hitze und dem Verdruß über die Windstille schienen weder Offiziere noch Matrosen recht aufgelegt, ihre Pflicht zu thun.
In der dritten Nacht wurde von der Wache auf Deck nichts Ungewöhnliches gehört oder gesehen. Als aber der Morgen anbrach, wurde das kleinste Boot vermißt und wurden, wie demnächst gemeldet wurde, auch die Indier vermißt.
Wenn diese Leute das Boot, wie ich überzeugt bin, kurz nach Dunkelwerden gestohlen hatten, so wäre es in Betracht der großen Nähe der Küste, als die Sache am Morgen entdeckt wurde, ein vergebliches Unternehmen gewesen, sie zu verfolgen. Ich bin überzeugt, daß sie, wenn sie auch aus Ermattung und Ungeschicklichkeit noch so langsam ruderten, bei der ruhigen See vor Tagesanbruch die Küste erreicht hatten.
Erst nach der Ankunft in unserm Hafen erfuhr ich, was meine Passagiere für Gründe gehabt hatten, ihre Gelegenheit, von dem Schiffe zu entkommen, wahrzunehmen. Ich konnte den Behörden gegenüber nichts anderes aussagen, als was ich hier berichtet habe. Die Behörden fanden es tadelnswerth, daß ich die Disciplin auf dem Schiffe so lässig gehandhabt habe. Ich habe darüber sowohl gegen die Behörden, als die Eigenthümer des Schiffs mein Bedauern ausgedrückt. Seit jener Zeit hat man, so viel ich erfahren habe, nichts mehr über die Indier gehört. Ich habe daher dem Vorstehenden nichts mehr hinzuzufügen.
III
Die Aussage des Herrn Murthwaite
(1850.)
In einem Briefe an Herrn Bruff
Entsinnen Sie sich noch, sehr geehrter Herr, eines Halbwilden dem Sie im Herbste 1848 auf einem Diner in London begegneten. Erlauben Sie mir, Sie daran zu erinnern, daß dieser Mann Murthwaite hieß und daß Sie damals nach Tische eine lange Unterhaltung mit ihm hatten. Unser Gespräch drehte sich um einen »Mondstein« genannten, indischen Diamanten und eine damals vorhandene Verschwörung zu dem Zweck, sich des Edelsteins zu bemächtigen.
Seit jener Zeit habe ich Central-Asien durchreist und habe mich von dort wieder nach dem Schauplatz einiger meiner früheren Abenteuer im Norden und Nordwesten von Indien begeben. Vor ungefähr 14 Tagen befand ich mich in einem den Europäern wenig bekannten District, der Kattiawar heißt. Hier hatte ich ein Erlebniß, bei welchem Sie, so unglaublich es klingen mag, persönlich interessirt sind.
In der wilden Gegend von Kattiawar, – und von dieser Wildheit werden Sie sich einen Begriff machen können, wenn ich Ihnen sage, daß selbst die Bauern nicht anders als bis an die Zähne bewaffnet auf dem Felde arbeiten, – hängt die Bevölkerung noch fanatisch an der alten indischen Religion, der alten Anbetung des Brahma und Vishnu. Die wenigen mohamedanischen Familien, welche in einzelnen Dörfern im Innern zerstreut leben, scheuen sich Fleisch zu essen. Ein Mohamedaner, der auch nur im Verdacht steht, das geheiligte Thier, die Kuh, getödtet zu haben, wird hier zu Lande von seinen frommen indischen Nachbarn ohne Weiteres erbarmungslos umgebracht. Zwei der berühmtesten, im Gebiet von Kattiawar befindliche Pilgerplätze sind nur geeignet, den religiösen Fanatismus des Volkes noch zu steigern. Einer derselben ist Dwarka, die Geburtstätte des Gottes Krishna, der andere ist die heilige Stadt Somnauth, die schon im 11. Jahrhundert von dem mohamedanischen Eroberer Mohamed von Ghizni geplündert und zerstört wurde.
Zum zweiten Mal auf einer Wanderung durch diese romantische Gegend begriffen, beschloß ich, Kattiawar nicht zu verlassen, ohne mir die prachtvollen Ruinen von Somnauth noch einmal anzusehen. Von dem Orte, wo ich diesen Entschluß faßte, hatte ich nach meiner Berechnung ungefähr drei Tage bis nach der heiligen Stadt zu marschiren.
Ich war noch nicht lange unterwegs gewesen, als ich bemerkte, daß auch andere Leute, zu Zweien oder Dreien, dasselbe Ziel wie ich zu verfolgen schienen.
Gegen die, welche mich ausmachen, gab ich mich für einen indischen Buddhisten aus einer entfernten Provinz aus, der auf einer angelobten Pilgerfahrt begriffen sei. Ich brauche wohl nicht erst zu sagen, daß meine Kleidung meinen Angaben entsprach. Nehmen Sie hinzu, daß ich der Sprache so kundig bin wie meiner Muttersprache und daß ich mager und braun genug bin, um meinen europäischen Ursprung bequem verbergen zu können, und Sie werden begreifen, daß ich die Musterung der Leute nicht als einer ihrer unmittelbaren Landsleute, sondern als ein Fremder aus einer entfernten Gegend ihres Landes leicht bestand.
Am zweiten Tage fanden sich die in derselben Richtung mit mir reisenden Indier zu Fünfzigen und zu Hunderten ein; am dritten Tage war die Menge zu Tausenden angewachsen, die alle langsamen Schrittes nach einem Ziele, der Stadt Somnauth hinstrebten.
Ein kleiner Dienst, den ich einem meiner Pilgergenossen am dritten Reisetage leisten konnte, verschaffte mir die Bekanntschaft gewisser Indier der höhern Kaste. Von diesen Leuten erfuhr ich, daß die Menge zu einer großen religiösen Feierlichkeit herbeiströme, welche auf einem Hügel in einer kleinen Entfernung stattfinden werde. Die Feier sollte dem Mondgott zu Ehren, und zwar während der Nacht veranstaltet werden. Die Volksmenge verhinderte uns anfänglich, vorzudringen, als wir uns dem Orte der Feier näherten. Als wir endlich den Hügel erreichten, stand der Mond hoch am Himmel. Meine indischen Freunde hatten vermöge ihrer besonderen Privilegien Zutritt zu dem Heiligenschrein. Sie erlaubten mir freundlich, mich ihnen anzuschließen. Als wir an denselben gelangten, fanden wir den Schrein durch einen zwischen zwei prachtvollen Bäumen aufgehängten Vorhang unsern Blicken entzogen. Vor den Bäumen bildete ein flacher Felsvorsprung eine Art natürlicher Plattform Vor diese stellte ich mich, neben meine indischen Freunde.
Dem Auge bot sich von hier, wenn es den Hügel hinabblickte, das großartigste durch die Verbindung von Natur und Menschen hervorgebrachte Schauspiel, das ich je gesehen hatte. Die niedern Abhänge der Anhöhe gingen unmerklich in eine Rasen-Ebene über, aus welcher drei Flüsse zusammenstießen, An der einen Seite zog sich das Wasser, so weit das Auge reichte, in zierlichen, bald sichtbaren, bald durch Bäume verdeckten Windungen hin. An der andern Seite schlummerte der wellenlose Ocean in der Stille der Nacht. Bevölkern Sie diese liebliche Scene in Gedanken mit Tausenden menschlicher Wesen, die alle, weiß gekleidet, auf den Abhängen des sich zur Ebene absenkenden Hügels und an den näher gelegenen Ufern der Flußwindungen gelagert sind. Beleuchten Sie diesen Halteplatz der Pilger mit rothen Flammen von Pechkränzen und Fackeln, die von Zeit zu Zeit an den verschiedensten Stellen aus der ungeheuren Menschenmenge hervorleuchten. Denken Sie sich dazu das Mondlicht des Orients, das Alles in unbewölkter Pracht bescheint – und Sie werden sich eine Vorstellung von dem Anblick machen können, der sich mir von dem Gipfel des Hügels aus darbot.
Eine klagende Musik von Saiten-Instrumenten und Flöten lenkte meine Aufmerksamkeit wieder auf den verborgenen Schrein zurück.
Ich drehte mich um und erblickte auf der felsigen Plattform die Gestalten dreier Männer. In dem in der Mitte Stehenden erkannte ich den Mann, mit welchem ich in England gesprochen hatte, als die Indier damals auf der Terrasse vor Lady Verinder’s Haus erschienen. Die beiden neben ihm Stehenden waren ohne Zweifel dieselben, die ihn damals begleitet hatten.
Einer der Indier, neben denen ich stand, sah wie ich stutzte. Flüsternd erklärte er mir die Erscheinung der drei Gestalten auf der Felsplatte.
Es seien Brahminen, sagte er, die im Dienst der Gottheit ihrer Kaste verlustig gegangen seien. Der Gott habe befohlen, daß sie sich durch eine Pilgerfahrt reinigen sollten. In dieser Nacht würden sie ihre Pilgerfahrt antreten. In drei verschiedenen Richtungen würden sie sich als Pilgrimme nach den heiligen Schreinen Indiens auf den Weg machen. Niemals dürften sie einander wieder ansehen; niemals dürften sie von dem Tage, wo sie sich trennten, bis zu dem Tage ihres Todes aus ihrer Wanderung ausruhen.
In dem Augenblick, wo mein Freund mit seiner Erklärung zu Ende war, hörte die klagende Musik auf. Die drei Männer warfen sich vor dem Vorhang, welcher den Schrein verdeckte, auf die Felsplatte nieder. Dann standen sie wieder auf, sahen sich einander an und umarmten sich. Darauf stiegen sie in verschiedenen Richtungen unter die Menge hinab. Das Volk wich in tiefem Schweigen vor ihnen zurück. Langsam schlossen sich die Reihen der gewaltigen Volksmassen wieder. Die Spur der Schritte der drei dem Tode verfallenen Männer durch die Reihen ihrer Mitmenschen war verwischt. Wir sahen sie nicht mehr.
Aufs Neue ertönte die Musik, diesmal laut und jubelnd, von dem verborgenen Schrein her. Die Menge um mich her fuhr schaudernd zusammen und drängte sich dichter.
Der Vorhang zwischen den Bäumen wurde zurückgezogen und der Schrein den Blicken der Menge enthüllt.
Da saß hoch aus seinem Thron, dem die Antilope als Fußgestell diente, seine vier Arme nach den vier Enden der Welt ausgestreckt, schwarz und furchtbar in dem geheimnißvollen Licht des Mondes über uns schwebend, der Gott des Mondes. Und da erglänzte, auf der Stirn der Gottheit, der gelbe Diamant, dessen Glanz mir zuletzt in England von der Brust eines Frauenkleides entgegen geleuchtet hatte!
Ja! Nach Verlauf von acht Jahrhunderten leuchtet der Mondstein wieder weithin über die Mauern der heiligen Stadt, in welcher seine Geschichte beginnt. Wie derselbe wieder seinen Weg nach seinem wilden heimathlande gefunden hat, durch welchen Zufall oder durch welches Verbrechen die Indier wieder in den Besitz ihres heiligen Edelsteines gelangten, – das ist Ihnen bekannt, mir nicht.
Sie haben denselben in England aus dem Gesicht verloren, und zwar, wenn mich meine Erfahrungen von diesem Volke nicht trügen, für immer.
So vergehen die Jahre und wiederholen sich; so kehren dieselben Ereignisse im Kreislauf der Zeiten wieder. Was werden die nächsten Erlebnisse des Mondsteins sein? Wer vermag es zu sagen!